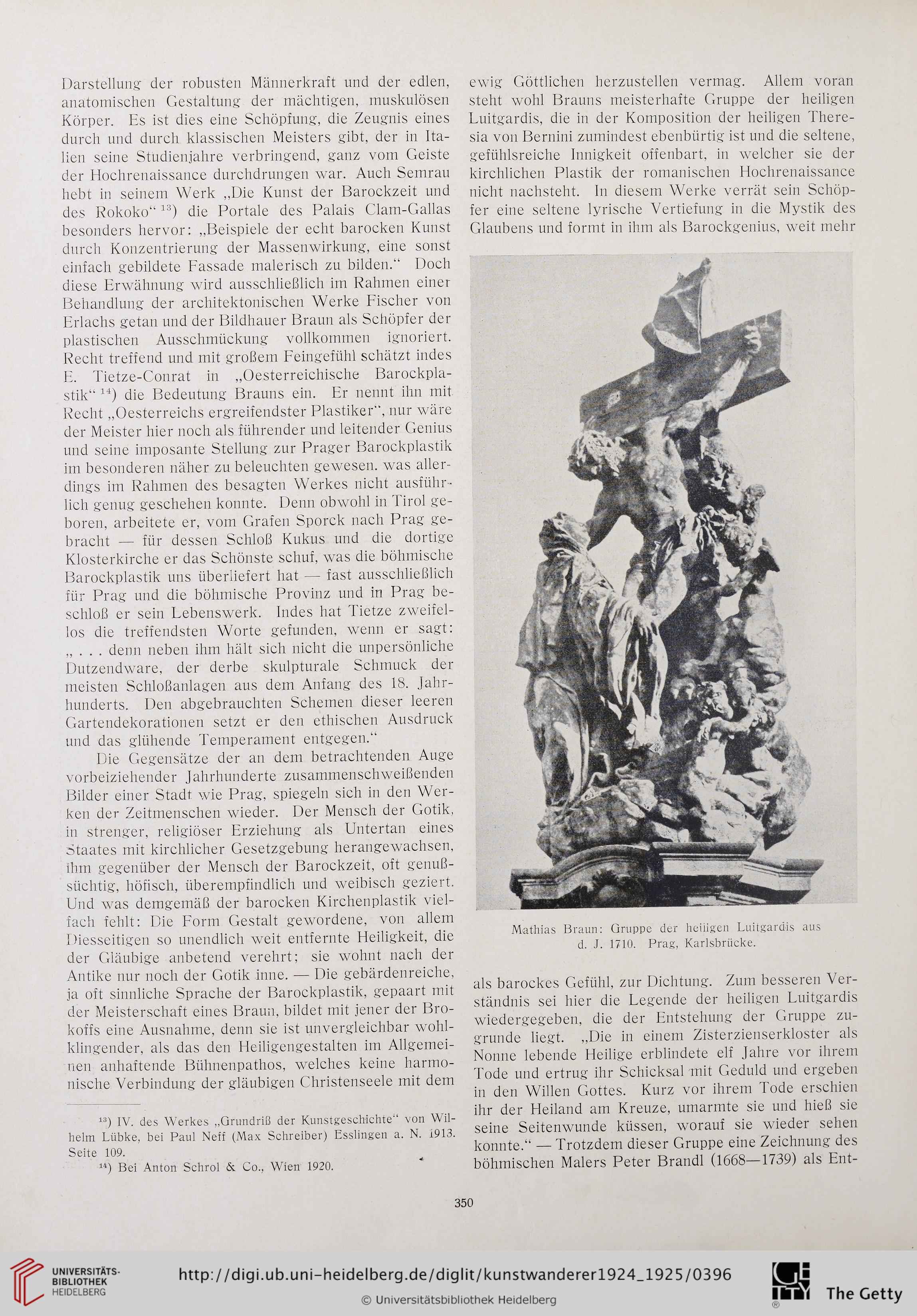Darstellung- der robusten Männerkraft und der edlen,
anatomischen Gestaltung der mächtigen, muskulösen
Körper. Es ist dies eine Schöpfung, die Zeugnis eines
durch und durch klassischen Meisters gibt, der in Ita-
lien seine Studienjahre verbringend, ganz vom Geiste
der Hochrenaissance durchdrungen war. Auch Semrau
hebt iu seinem Werk ,,Die Kunst der Barockzeit und
des Rokoko“13) die Portale des Palais Clam-Gallas
besonders hervor: „Beispiele der eclit barocken Kunst
durch Konzentrierung der Massenwirkung, eine sonst
einfach gebildete Fassade malerisch zu bilden.“ Doch
diese Erwähnung wird ausschließlich im Rahmen einer
Behandlung der architektonischen Werke Fischer von
Erlachs getan und der Bildhauer Braun als Schöpfer der
plastischen Ausschmückung vollkommen ignoriert.
Recht treffend und mit großem Feingefühl schätzt indes
E. Tietze-Conrat in „Oesterreichische Barockpla-
stik“ 14) die Bedeutung Brauns ein. Er nennt ihn mit
Recht „Oesterreichs ergreifendster Plastiker“, nur wäre
der Meister hier noch als führender und leitender Genius
und seine imposante Stellung zur Prager Barockplastik
im besonderen näher zu beleuchten gewesen. was aller-
dings im Rahmen des besagten Werkes nicht ausführ-
lich genug geschehen konnte. Denn obwohl in Tirol ge-
boren, arbeitete er, vom Grafen Sporck nach Prag ge-
bracht — für dessen Schloß Kukus und die dortige
Klosterkirche er das Schönste schuf, was die böhmische
Barockplastik uns überliefert hat -— fast ausschließlich
für Prag und die böhmische Provinz und in Prag be-
schloß er sein Lebenswerk. Indes hat Tietze zweifel-
los die treffendsten Worte gefunden, wenn er sagt:
„ . . . denn neben ihm hält sich nicht die unpersönliche
Dutzendware, der derbe skulpturale Schmuck der
meisten Schloßanlagen aus dem Anfang des 18. Jahr-
hunderts. Den abgebrauchten Schemen dieser leeren
Gartendekorationen setzt er den ethischen Ausdruck
und das gltihende Temperament entgegen.“
Die Gegensätze der an dem betrachtenden Auge
vorbeiziehender Jahrhunderte zusammenschweißenden
Bilder einer Stadt wie Prag, spiegeln sich in den Wer-
ken der Zeitmenschen wieder. Der Mensch der Gotik,
in strenger, religiöser Erziehung als Untertan eines
Staates mit kirchlicher Gesetzgebung herangewachsen,
ihm gegenüber der Mensch der Barockzeit, oft genuß-
süchtig, höfisch, überempfindlich und weibisch geziert.
Und was demgemäß der barocken Kirchenplastik viel-
fach fehlt: Die Form Gestalt gewordene, von allem
Diesseitigen so unendlich weit entfernte Heiiigkeit, die
der Gläubige anbetend verehrt; sie wohnt nach der
Antike nur nocli der Gotik inne. — Die gebärdenreiche,
ja oft sinnliche Sprache der Barockplastik, gepaart mit
der Meisterschaft eines Braun, bildet mit jener der Bro-
koffs eine Ausnahme, denn sie ist unvergleichbar wohl-
klingender, als das den Heiligengestalten im Allgemei-
nen anhaftende Bülmenpathos, welches keine harmo-
nische Verbindung der gläubigen Christenseele mit dem
13) IV. des Werkes „Grundriß der Kunstgeschichteil von Wil-
helm Lübke, bei Paul Neff (Max Schreiber) Esslingen a. N. 1913.
Seite 109.
14) Bei Anton Schrol & Co., Wien 1920.
ewig Göttlichen herzustellen vermag. Allem voran
steht wohl Brauns meisterhafte Gruppe der heiligen
Luitgardis, die in der Komposition der heiligen There-
sia von Bernini zumindest ebenbürtig ist und die seltene,
gefiihlsreiche Innigkeit offenbart, in welcher sie der
kirchlichen Plastik der romanischen Hochrenaissance
nicht nachsteht. In diesem Werke verrät sein Schöp-
fer eine seltene lyrische Vertiefung in die Mystik des
Glaubens und formt in ihm als Barockgenius, weit mehr
Mathias Braun: Gruppe der heiiigen Luitgardis aus
d. J. 1710. Prag, Karlsbriicke.
als barockes Gefühl, zur Dichtung. Zum besseren Ver-
ständnis sei hier die Legende der heiligen Luitgardis
wiedergegeben, die der Entstehung der Gruppe zu-
grunde liegt. „Die in einem Zisterzienserkloster als
Nonne lebende Heilige erblindete elf Jalire vor ilirem
Tode und ertrug ihr Schicksal mit Geduld und ergeben
in den Willen Gottes. Kurz vor ihrem Tode erschien
ihr der Heiland am Kreuze, umarmte sie und hieß sie
seine Seitenwunde küssen, worauf sie wieder sehen
konnte.“ — Trotzdem dieser Gruppe eine Zeichnung des
böhinischen Malers Peter Brandl (1668—1739) als Ent-
350
anatomischen Gestaltung der mächtigen, muskulösen
Körper. Es ist dies eine Schöpfung, die Zeugnis eines
durch und durch klassischen Meisters gibt, der in Ita-
lien seine Studienjahre verbringend, ganz vom Geiste
der Hochrenaissance durchdrungen war. Auch Semrau
hebt iu seinem Werk ,,Die Kunst der Barockzeit und
des Rokoko“13) die Portale des Palais Clam-Gallas
besonders hervor: „Beispiele der eclit barocken Kunst
durch Konzentrierung der Massenwirkung, eine sonst
einfach gebildete Fassade malerisch zu bilden.“ Doch
diese Erwähnung wird ausschließlich im Rahmen einer
Behandlung der architektonischen Werke Fischer von
Erlachs getan und der Bildhauer Braun als Schöpfer der
plastischen Ausschmückung vollkommen ignoriert.
Recht treffend und mit großem Feingefühl schätzt indes
E. Tietze-Conrat in „Oesterreichische Barockpla-
stik“ 14) die Bedeutung Brauns ein. Er nennt ihn mit
Recht „Oesterreichs ergreifendster Plastiker“, nur wäre
der Meister hier noch als führender und leitender Genius
und seine imposante Stellung zur Prager Barockplastik
im besonderen näher zu beleuchten gewesen. was aller-
dings im Rahmen des besagten Werkes nicht ausführ-
lich genug geschehen konnte. Denn obwohl in Tirol ge-
boren, arbeitete er, vom Grafen Sporck nach Prag ge-
bracht — für dessen Schloß Kukus und die dortige
Klosterkirche er das Schönste schuf, was die böhmische
Barockplastik uns überliefert hat -— fast ausschließlich
für Prag und die böhmische Provinz und in Prag be-
schloß er sein Lebenswerk. Indes hat Tietze zweifel-
los die treffendsten Worte gefunden, wenn er sagt:
„ . . . denn neben ihm hält sich nicht die unpersönliche
Dutzendware, der derbe skulpturale Schmuck der
meisten Schloßanlagen aus dem Anfang des 18. Jahr-
hunderts. Den abgebrauchten Schemen dieser leeren
Gartendekorationen setzt er den ethischen Ausdruck
und das gltihende Temperament entgegen.“
Die Gegensätze der an dem betrachtenden Auge
vorbeiziehender Jahrhunderte zusammenschweißenden
Bilder einer Stadt wie Prag, spiegeln sich in den Wer-
ken der Zeitmenschen wieder. Der Mensch der Gotik,
in strenger, religiöser Erziehung als Untertan eines
Staates mit kirchlicher Gesetzgebung herangewachsen,
ihm gegenüber der Mensch der Barockzeit, oft genuß-
süchtig, höfisch, überempfindlich und weibisch geziert.
Und was demgemäß der barocken Kirchenplastik viel-
fach fehlt: Die Form Gestalt gewordene, von allem
Diesseitigen so unendlich weit entfernte Heiiigkeit, die
der Gläubige anbetend verehrt; sie wohnt nach der
Antike nur nocli der Gotik inne. — Die gebärdenreiche,
ja oft sinnliche Sprache der Barockplastik, gepaart mit
der Meisterschaft eines Braun, bildet mit jener der Bro-
koffs eine Ausnahme, denn sie ist unvergleichbar wohl-
klingender, als das den Heiligengestalten im Allgemei-
nen anhaftende Bülmenpathos, welches keine harmo-
nische Verbindung der gläubigen Christenseele mit dem
13) IV. des Werkes „Grundriß der Kunstgeschichteil von Wil-
helm Lübke, bei Paul Neff (Max Schreiber) Esslingen a. N. 1913.
Seite 109.
14) Bei Anton Schrol & Co., Wien 1920.
ewig Göttlichen herzustellen vermag. Allem voran
steht wohl Brauns meisterhafte Gruppe der heiligen
Luitgardis, die in der Komposition der heiligen There-
sia von Bernini zumindest ebenbürtig ist und die seltene,
gefiihlsreiche Innigkeit offenbart, in welcher sie der
kirchlichen Plastik der romanischen Hochrenaissance
nicht nachsteht. In diesem Werke verrät sein Schöp-
fer eine seltene lyrische Vertiefung in die Mystik des
Glaubens und formt in ihm als Barockgenius, weit mehr
Mathias Braun: Gruppe der heiiigen Luitgardis aus
d. J. 1710. Prag, Karlsbriicke.
als barockes Gefühl, zur Dichtung. Zum besseren Ver-
ständnis sei hier die Legende der heiligen Luitgardis
wiedergegeben, die der Entstehung der Gruppe zu-
grunde liegt. „Die in einem Zisterzienserkloster als
Nonne lebende Heilige erblindete elf Jalire vor ilirem
Tode und ertrug ihr Schicksal mit Geduld und ergeben
in den Willen Gottes. Kurz vor ihrem Tode erschien
ihr der Heiland am Kreuze, umarmte sie und hieß sie
seine Seitenwunde küssen, worauf sie wieder sehen
konnte.“ — Trotzdem dieser Gruppe eine Zeichnung des
böhinischen Malers Peter Brandl (1668—1739) als Ent-
350