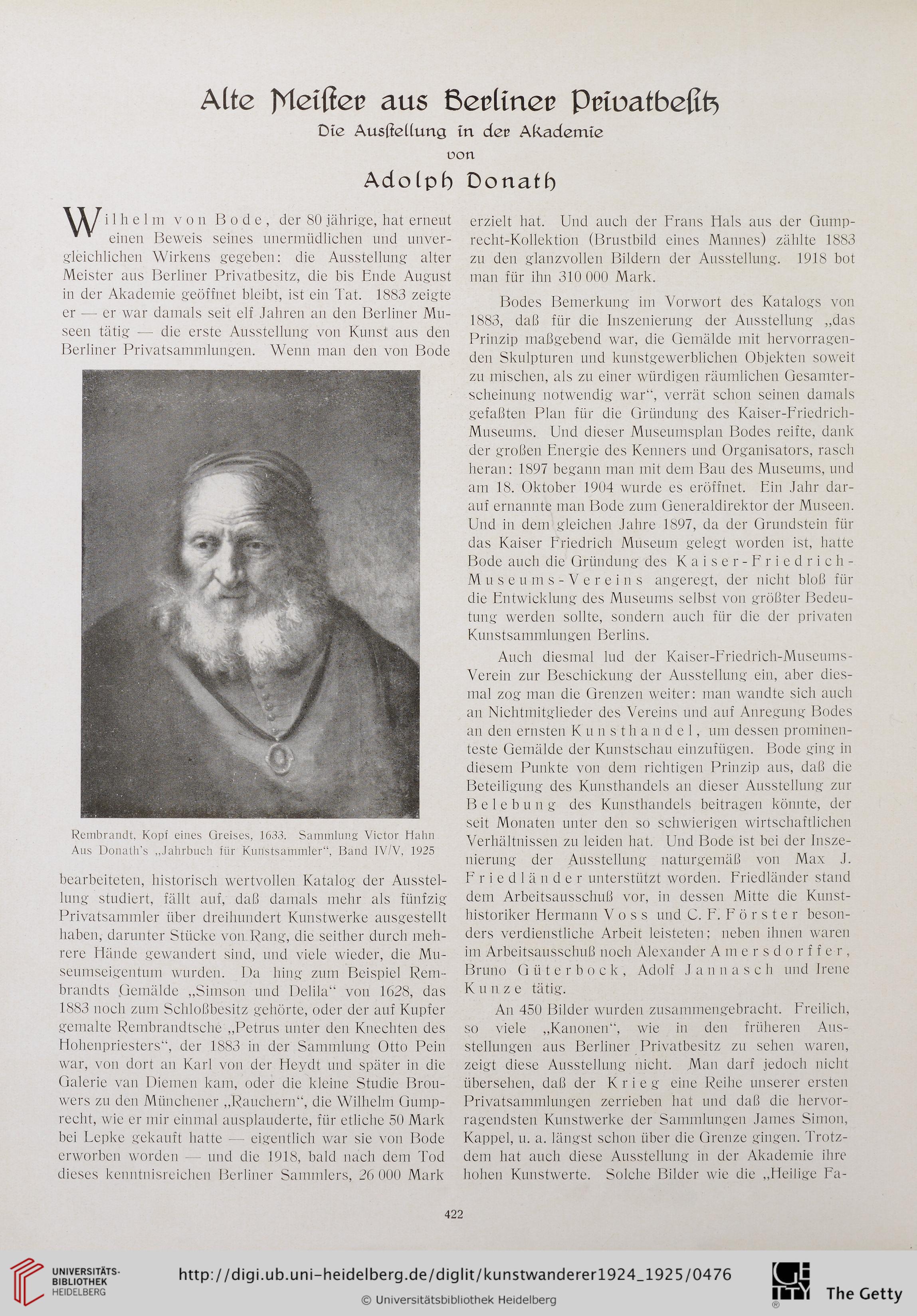Alte jvletßee aus Becttncü PtnüatbeftL
Dte Aus{iettung tn det? Akademte
uon
Adotpb Donatb
ilhelm von Bode, der 80 jährige, hat erneut
v v einen Beweis seines unermüdlichen und unver-
gleichlichen Wirkens gegeben: die Ausstellung alter
Meister aus Berliner Privatbesitz, die bis Ende August
in der Akademie geöffnet bleibt, ist ein Tat. 1883 zeigte
er — er war damals seit elf Jahren an den Berliner Mu-
seen tätig -— die erste Ausstellung von Kunst aus den
Berliner Privatsammlungen. Wenn man den von Bode
Rembrandt, Kopf eines Qreises, 1633. Sammlung Victor Hahn
Aus Donath’s „Jahrbuch fiir Kuristsahnuler“, Band IV/V, 1925
bearbeiteten, historisch wertvollen Katalog der Ausstel-
lung studiert, fällt auf, daß damals mehr als fünfzig
Privatsammler über dreihundert Kunstwerke ausgestellt
haben, darunter Stiicke von Rang, die seither durch meh-
rere Hände gewandert sind, und viele wieder, die Mu-
seumseigentum wurden. Da hing zum Beispiel Rem-
brandts Gemälde „Simson und Delila“ von 1628, das
1883 noch zum Schloßbesitz gehörte, oder der auf Kupfer
gemalte Rembrandtsche „Petrus unter den Knechten des
Hohenpriesters“, der 1883 in der Sammlung Otto Pein
war, von dort an Karl von der Heydt und später in die
Galerie van Diemen kam, oder die kleine Studie Brou-
wers zu den Miinchener „Rauchern“, die Wilhelm Gump-
recht, wie er mir einmal ausplauderte, fiir etliche 50 Mark
bei Lepke gekauft hatte — eigentlich war sie von Bode
erworben worden - und die 1918, bald nach dem Tod
dieses kenntnisreichen Berliner Sammlers, 26 000 Mark
erzielt hat. Und auch der Frans Hals aus der Gump-
recht-Kollektion (Brustbild eines Mannes) zählte 1883
zu den glanzvollen Bildern der Ausstellung. 1918 bot
man fiir ihn 310 000 Mark.
Bodes Bemerkung im Yorwort des Katalogs von
1883, daß fiir die Inszenierung der Ausstellung „das
Prinzip maßgebend war, die Gemälde mit hervorragen-
den Skulpturen und kunstgewerblichen Objekten soweit
zu mischen, als zu einer würdigen räumlichen Gesamter-
scheinung notwendig war“, verrät schon seinen damals
gefaßten Plan fiir die Griindung des Kaiser-Friedrich-
Museums. Und dieser Museumsplan Bodes reifte, dank
der großen Energie des Kenners und Organisators, rasch
heran: 1897 begann man mit dem Bau des Museums, und
am 18. Oktober 1904 wurde es eröffnet. Ein Jahr dar-
auf ernannte man Bode zum Generaldirektor der Museen.
Und in dem gleichen Jahre 1897, da der Grundstein fiir
das Kaiser Friedrich Museum gelegt worden ist, hatte
Bode auch die Griindung des Kaiser-Friedrich-
M u s e u m s - V e r e i n s angeregt, der nicht bloß für
die Entwicklung des Museums selbst von größter Bedeu-
tung werden sollte, sondern auch fiir die der privaten
Kunstsammlungen Berlins.
Auch diesmal lud der Kaiser-Friedrich-Museums-
Verein zur Beschickung der Ausstellung ein, aber dies-
mal zog man die Grenzen weiter: man wandte sich auch
an Nichtmitglieder des Vereins und auf Anregung Bodes
an den ernsten Kunsthandel, um dessen prominen-
teste Gemälde der Kunstschau einzufiigen. Bode ging in
diesem Punkte von dem richtigen Prinzip aus, daß die
Beteiligung des Kunsthandels an dieser Ausstellung zur
B e 1 e b u n g des Kunsthandels beitragen könnte, der
seit Monaten unter den so schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnissen zu leiden hat. Und Bode ist bei der Insze-
nierung der Ausstellung naturgemäß von Max J.
Friedländer unterstiitzt wörden. Friedländer stand
dem Arbeitsausschuß vor, in dessen Mitte die Kunst-
historiker Hermann V o s s und C. F. F ö r s t e r beson-
ders verdienstliche Arbeit leisteten; neben ihnen waren
im Arbeitsausschuß noch Alexander Amersdorffer,
Bruno Giiterbock, Adolf Jannasch und Irene
K u n z e tätig.
An 45Ü Bilder wurden zusammengebracht. Freilich,
so viele „Kanonen“, wie in den friiheren Aus-
stellungen aus Berliner Privatbesitz zu sehen waren,
zeigt diese Ausstellung nicht. JVlan darf jedoch nicht
übersehen, daß der K r i e g eine Reihe unserer ersten
Privatsammlungen zerrieben hat und daß die hervor-
ragendsten Kunstwerke der Sammlungen James Simon,
Kappel, u. a. liingst sclion iiber die Grenze gingen. Trotz-
dem hat auch diese Ausstellung in der Akademie ihre
hohen Kunstwerte. Solche Bilder wie die „Heilige Fa-
422
Dte Aus{iettung tn det? Akademte
uon
Adotpb Donatb
ilhelm von Bode, der 80 jährige, hat erneut
v v einen Beweis seines unermüdlichen und unver-
gleichlichen Wirkens gegeben: die Ausstellung alter
Meister aus Berliner Privatbesitz, die bis Ende August
in der Akademie geöffnet bleibt, ist ein Tat. 1883 zeigte
er — er war damals seit elf Jahren an den Berliner Mu-
seen tätig -— die erste Ausstellung von Kunst aus den
Berliner Privatsammlungen. Wenn man den von Bode
Rembrandt, Kopf eines Qreises, 1633. Sammlung Victor Hahn
Aus Donath’s „Jahrbuch fiir Kuristsahnuler“, Band IV/V, 1925
bearbeiteten, historisch wertvollen Katalog der Ausstel-
lung studiert, fällt auf, daß damals mehr als fünfzig
Privatsammler über dreihundert Kunstwerke ausgestellt
haben, darunter Stiicke von Rang, die seither durch meh-
rere Hände gewandert sind, und viele wieder, die Mu-
seumseigentum wurden. Da hing zum Beispiel Rem-
brandts Gemälde „Simson und Delila“ von 1628, das
1883 noch zum Schloßbesitz gehörte, oder der auf Kupfer
gemalte Rembrandtsche „Petrus unter den Knechten des
Hohenpriesters“, der 1883 in der Sammlung Otto Pein
war, von dort an Karl von der Heydt und später in die
Galerie van Diemen kam, oder die kleine Studie Brou-
wers zu den Miinchener „Rauchern“, die Wilhelm Gump-
recht, wie er mir einmal ausplauderte, fiir etliche 50 Mark
bei Lepke gekauft hatte — eigentlich war sie von Bode
erworben worden - und die 1918, bald nach dem Tod
dieses kenntnisreichen Berliner Sammlers, 26 000 Mark
erzielt hat. Und auch der Frans Hals aus der Gump-
recht-Kollektion (Brustbild eines Mannes) zählte 1883
zu den glanzvollen Bildern der Ausstellung. 1918 bot
man fiir ihn 310 000 Mark.
Bodes Bemerkung im Yorwort des Katalogs von
1883, daß fiir die Inszenierung der Ausstellung „das
Prinzip maßgebend war, die Gemälde mit hervorragen-
den Skulpturen und kunstgewerblichen Objekten soweit
zu mischen, als zu einer würdigen räumlichen Gesamter-
scheinung notwendig war“, verrät schon seinen damals
gefaßten Plan fiir die Griindung des Kaiser-Friedrich-
Museums. Und dieser Museumsplan Bodes reifte, dank
der großen Energie des Kenners und Organisators, rasch
heran: 1897 begann man mit dem Bau des Museums, und
am 18. Oktober 1904 wurde es eröffnet. Ein Jahr dar-
auf ernannte man Bode zum Generaldirektor der Museen.
Und in dem gleichen Jahre 1897, da der Grundstein fiir
das Kaiser Friedrich Museum gelegt worden ist, hatte
Bode auch die Griindung des Kaiser-Friedrich-
M u s e u m s - V e r e i n s angeregt, der nicht bloß für
die Entwicklung des Museums selbst von größter Bedeu-
tung werden sollte, sondern auch fiir die der privaten
Kunstsammlungen Berlins.
Auch diesmal lud der Kaiser-Friedrich-Museums-
Verein zur Beschickung der Ausstellung ein, aber dies-
mal zog man die Grenzen weiter: man wandte sich auch
an Nichtmitglieder des Vereins und auf Anregung Bodes
an den ernsten Kunsthandel, um dessen prominen-
teste Gemälde der Kunstschau einzufiigen. Bode ging in
diesem Punkte von dem richtigen Prinzip aus, daß die
Beteiligung des Kunsthandels an dieser Ausstellung zur
B e 1 e b u n g des Kunsthandels beitragen könnte, der
seit Monaten unter den so schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnissen zu leiden hat. Und Bode ist bei der Insze-
nierung der Ausstellung naturgemäß von Max J.
Friedländer unterstiitzt wörden. Friedländer stand
dem Arbeitsausschuß vor, in dessen Mitte die Kunst-
historiker Hermann V o s s und C. F. F ö r s t e r beson-
ders verdienstliche Arbeit leisteten; neben ihnen waren
im Arbeitsausschuß noch Alexander Amersdorffer,
Bruno Giiterbock, Adolf Jannasch und Irene
K u n z e tätig.
An 45Ü Bilder wurden zusammengebracht. Freilich,
so viele „Kanonen“, wie in den friiheren Aus-
stellungen aus Berliner Privatbesitz zu sehen waren,
zeigt diese Ausstellung nicht. JVlan darf jedoch nicht
übersehen, daß der K r i e g eine Reihe unserer ersten
Privatsammlungen zerrieben hat und daß die hervor-
ragendsten Kunstwerke der Sammlungen James Simon,
Kappel, u. a. liingst sclion iiber die Grenze gingen. Trotz-
dem hat auch diese Ausstellung in der Akademie ihre
hohen Kunstwerte. Solche Bilder wie die „Heilige Fa-
422