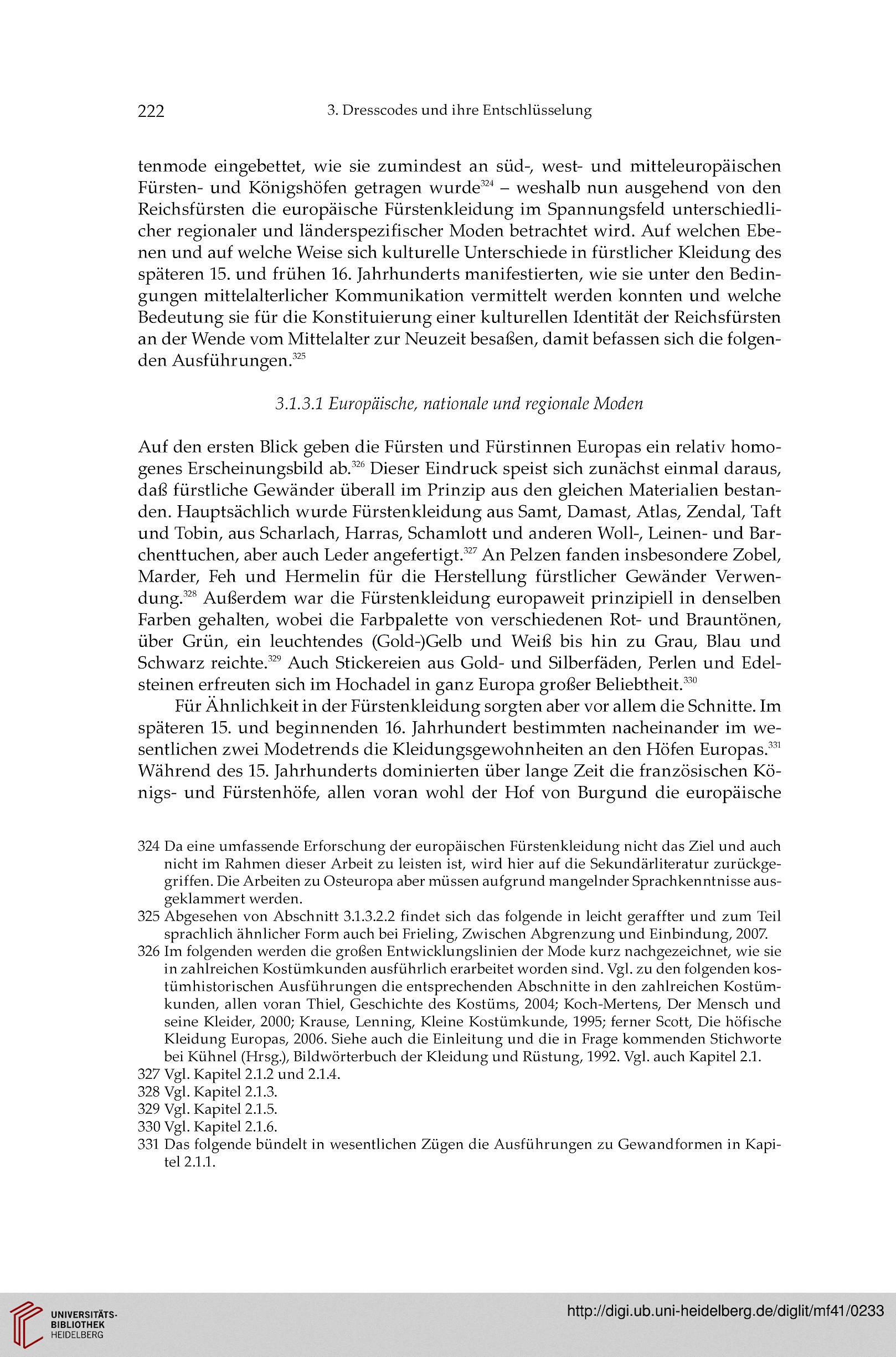222
3. Dresscodes und ihre Entschlüsselung
tenmode eingebettet, wie sie zumindest an süd-, west- und mitteleuropäischen
Fürsten- und Königshöfen getragen wurde324 - weshalb nun ausgehend von den
Reichsfürsten die europäische Fürstenkleidung im Spannungsfeld unterschiedli-
cher regionaler und länderspezifischer Moden betrachtet wird. Auf welchen Ebe-
nen und auf welche Weise sich kulturelle Unterschiede in fürstlicher Kleidung des
späteren 15. und frühen 16. Jahrhunderts manifestierten, wie sie unter den Bedin-
gungen mittelalterlicher Kommunikation vermittelt werden konnten und welche
Bedeutung sie für die Konstituierung einer kulturellen Identität der Reichsfürsten
an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit besaßen, damit befassen sich die folgen-
den Ausführungen.325
3.1.3.1 Europäische, nationale und regionale Moden
Auf den ersten Blick geben die Fürsten und Fürstinnen Europas ein relativ homo-
genes Erscheinungsbild ab.326 Dieser Eindruck speist sich zunächst einmal daraus,
daß fürstliche Gewänder überall im Prinzip aus den gleichen Materialien bestan-
den. Hauptsächlich wurde Fürstenkleidung aus Samt, Damast, Atlas, Zendal, Taft
und Tobin, aus Scharlach, Harras, Schamlott und anderen Woll-, Leinen- und Bar-
chenttuchen, aber auch Leder angefertigt.327 An Pelzen fanden insbesondere Zobel,
Marder, Feh und Hermelin für die Herstellung fürstlicher Gewänder Verwen-
dung.328 Außerdem war die Fürstenkleidung europaweit prinzipiell in denselben
Farben gehalten, wobei die Farbpalette von verschiedenen Rot- und Brauntönen,
über Grün, ein leuchtendes (Gold-)Gelb und Weiß bis hin zu Grau, Blau und
Schwarz reichte.329 Auch Stickereien aus Gold- und Silberfäden, Perlen und Edel-
steinen erfreuten sich im Hochadel in ganz Europa großer Beliebtheit.330
Für Ähnlichkeit in der Fürstenkleidung sorgten aber vor allem die Schnitte. Im
späteren 15. und beginnenden 16. Jahrhundert bestimmten nacheinander im we-
sentlichen zwei Modetrends die Kleidungsgewohnheiten an den Höfen Europas.331
Während des 15. Jahrhunderts dominierten über lange Zeit die französischen Kö-
nigs- und Fürstenhöfe, allen voran wohl der Hof von Burgund die europäische
324 Da eine umfassende Erforschung der europäischen Fürstenkleidung nicht das Ziel und auch
nicht im Rahmen dieser Arbeit zu leisten ist, wird hier auf die Sekundärliteratur zurückge-
griffen. Die Arbeiten zu Osteuropa aber müssen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse aus-
geklammert werden.
325 Abgesehen von Abschnitt 31.3.2.2 findet sich das folgende in leicht geraffter und zum Teil
sprachlich ähnlicher Form auch bei Frieling, Zwischen Abgrenzung und Einbindung, 2007.
326 Im folgenden werden die großen Entwicklungslinien der Mode kurz nachgezeichnet, wie sie
in zahlreichen Kostümkunden ausführlich erarbeitet worden sind. Vgl. zu den folgenden kos-
tümhistorischen Ausführungen die entsprechenden Abschnitte in den zahlreichen Kostüm-
kunden, allen voran Thiel, Geschichte des Kostüms, 2004; Koch-Mertens, Der Mensch und
seine Kleider, 2000; Krause, Lenning, Kleine Kostümkunde, 1995; ferner Scott, Die höfische
Kleidung Europas, 2006. Siehe auch die Einleitung und die in Frage kommenden Stichworte
bei Kühnei (Hrsg.), Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung, 1992. Vgl. auch Kapitel 2.1.
327 Vgl. Kapitel 2.1.2 und 2.1.4.
328 Vgl. Kapitel 2.1.3.
329 Vgl. Kapitel 2.1.5.
330 Vgl. Kapitel 2.1.6.
331 Das folgende bündelt in wesentlichen Zügen die Ausführungen zu Gewandformen in Kapi-
tel 2.1.1.
3. Dresscodes und ihre Entschlüsselung
tenmode eingebettet, wie sie zumindest an süd-, west- und mitteleuropäischen
Fürsten- und Königshöfen getragen wurde324 - weshalb nun ausgehend von den
Reichsfürsten die europäische Fürstenkleidung im Spannungsfeld unterschiedli-
cher regionaler und länderspezifischer Moden betrachtet wird. Auf welchen Ebe-
nen und auf welche Weise sich kulturelle Unterschiede in fürstlicher Kleidung des
späteren 15. und frühen 16. Jahrhunderts manifestierten, wie sie unter den Bedin-
gungen mittelalterlicher Kommunikation vermittelt werden konnten und welche
Bedeutung sie für die Konstituierung einer kulturellen Identität der Reichsfürsten
an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit besaßen, damit befassen sich die folgen-
den Ausführungen.325
3.1.3.1 Europäische, nationale und regionale Moden
Auf den ersten Blick geben die Fürsten und Fürstinnen Europas ein relativ homo-
genes Erscheinungsbild ab.326 Dieser Eindruck speist sich zunächst einmal daraus,
daß fürstliche Gewänder überall im Prinzip aus den gleichen Materialien bestan-
den. Hauptsächlich wurde Fürstenkleidung aus Samt, Damast, Atlas, Zendal, Taft
und Tobin, aus Scharlach, Harras, Schamlott und anderen Woll-, Leinen- und Bar-
chenttuchen, aber auch Leder angefertigt.327 An Pelzen fanden insbesondere Zobel,
Marder, Feh und Hermelin für die Herstellung fürstlicher Gewänder Verwen-
dung.328 Außerdem war die Fürstenkleidung europaweit prinzipiell in denselben
Farben gehalten, wobei die Farbpalette von verschiedenen Rot- und Brauntönen,
über Grün, ein leuchtendes (Gold-)Gelb und Weiß bis hin zu Grau, Blau und
Schwarz reichte.329 Auch Stickereien aus Gold- und Silberfäden, Perlen und Edel-
steinen erfreuten sich im Hochadel in ganz Europa großer Beliebtheit.330
Für Ähnlichkeit in der Fürstenkleidung sorgten aber vor allem die Schnitte. Im
späteren 15. und beginnenden 16. Jahrhundert bestimmten nacheinander im we-
sentlichen zwei Modetrends die Kleidungsgewohnheiten an den Höfen Europas.331
Während des 15. Jahrhunderts dominierten über lange Zeit die französischen Kö-
nigs- und Fürstenhöfe, allen voran wohl der Hof von Burgund die europäische
324 Da eine umfassende Erforschung der europäischen Fürstenkleidung nicht das Ziel und auch
nicht im Rahmen dieser Arbeit zu leisten ist, wird hier auf die Sekundärliteratur zurückge-
griffen. Die Arbeiten zu Osteuropa aber müssen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse aus-
geklammert werden.
325 Abgesehen von Abschnitt 31.3.2.2 findet sich das folgende in leicht geraffter und zum Teil
sprachlich ähnlicher Form auch bei Frieling, Zwischen Abgrenzung und Einbindung, 2007.
326 Im folgenden werden die großen Entwicklungslinien der Mode kurz nachgezeichnet, wie sie
in zahlreichen Kostümkunden ausführlich erarbeitet worden sind. Vgl. zu den folgenden kos-
tümhistorischen Ausführungen die entsprechenden Abschnitte in den zahlreichen Kostüm-
kunden, allen voran Thiel, Geschichte des Kostüms, 2004; Koch-Mertens, Der Mensch und
seine Kleider, 2000; Krause, Lenning, Kleine Kostümkunde, 1995; ferner Scott, Die höfische
Kleidung Europas, 2006. Siehe auch die Einleitung und die in Frage kommenden Stichworte
bei Kühnei (Hrsg.), Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung, 1992. Vgl. auch Kapitel 2.1.
327 Vgl. Kapitel 2.1.2 und 2.1.4.
328 Vgl. Kapitel 2.1.3.
329 Vgl. Kapitel 2.1.5.
330 Vgl. Kapitel 2.1.6.
331 Das folgende bündelt in wesentlichen Zügen die Ausführungen zu Gewandformen in Kapi-
tel 2.1.1.