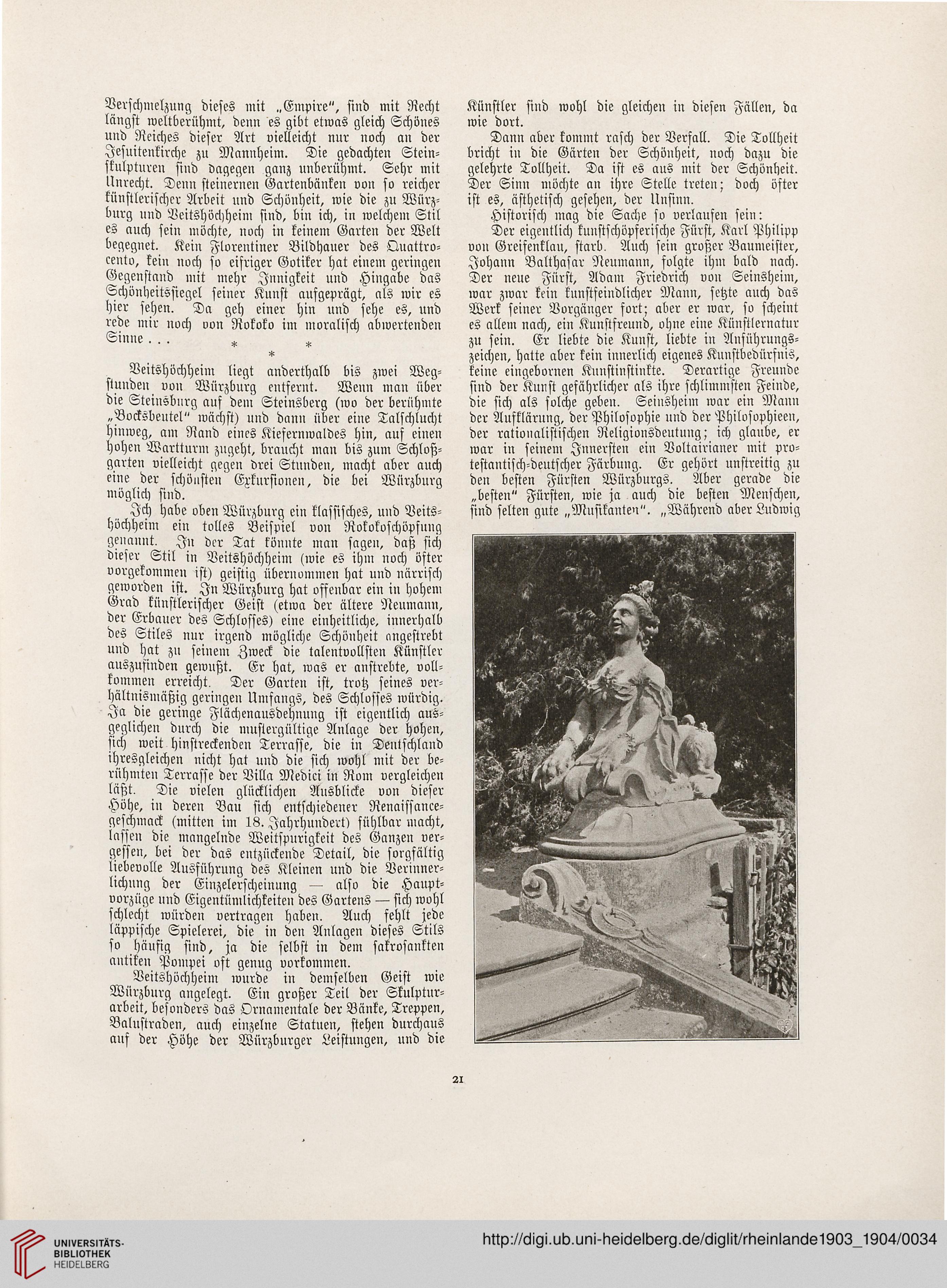Verschmelzung dieses mit „Empire", sind mit Recht
längst weltberühmt, denn es gibt etwas gleich Schönes
und Reiches dieser Art vielleicht nur noch an der
Jesuitenkirche zu Mannheim. Die gedachten Stein-
skulpturen sind dagegen ganz unberühmt. Sehr mit
llnrecht. Denn steinernen Gartenbänken von so reicher
künstlerischer Arbeit und Schvnheit, wie die zu Würz-
burg und Veitshöchheim sind, bin ich, in welchem Stil
es auch sein möchte, noch in keinem Garten der Welt
begegnet. Kein Florentiner Bildhauer des Quattro-
cento, kein noch so eifriger Gotiker hat einem geringen
Gegenstand mit mehr Jnuigkeit und Hingabe das
Schönheitssiegel seiner Kunst aufgeprägt, als wir es
hier sehen. Da geh einer hin und sehe es, und
rede mir noch ovn Rokoko im moralisch abwertenden
Sinne... ^ *
*
Veitshöchheim liegt anderthalb bis zwei Weg-
stunden von Würzburg eutfernt. Wenn man über
die Steinsbnrg auf dem Steinsberg (wo der berühmte
„Bocksbeutel" wächst) uud dann über eine Talschlucht
hinweg, am Rand eines Kiesernwaldes hin, auf einen
hohen Wartturm zngeht, braucht man bis zum Schloß-
garten vielleicht gegen drei Stunden, macht aber auch
eine der schönsten Exkursionen, die bei Würzburg
möglich sind.
Jch habe oben Würzburg ein klassisches, und Veits-
höchheim ein tolles Beispiel von Rokokoschöpfung
genannt. Jn der Tat könnte man sagen, daß sich
dieser Stil in Veitshöchheim (wie es ihm noch öfter
vorgekommen ist) geistig übernommen hat und närrisch
geworden ist. Jn Würzburg hat offenbar ein in hohem
Grad künstlerischer Geist (etwa der ältere Neumann,
der Erbauer des Schlosses) eine einheitliche, innerhalb
des Stiles nur irgend mögliche Schönheit cmgestrebt
und hat zu seiuem Zweck die talentvollsten Künstler
auszufinden gewußt. Er hat, was er anstrebte, voll-
kommen erreicht. Der Garten ist, trotz seines ver-
hältnismäßig geringen Nmfangs, des Schlosses würdig.
Ja die geringe Flächenausdehnung ist eigentlich aus-
geglichen durch die mustergültige Anlage der hohen,
sich weit hinstreckenden Terrasse, die in Deutschland
ihresgleichen nicht hat und die sich wohl mit der be-
rühmten Terrasse der Villa Medici in Rom vergleichen
läßt. Die vielen glücklichen Ausblicke von dieser
Höhe, in deren Bau sich entschiedener Renaissance-
geschmack (mitten im 18. Jahrhundert) fühlbar macht,
lnssen die mangelnde Weitspurigkeit des Ganzen ver-
gessen, bei der das entzückende Detail, die sorgfältig
liebevvlle Ausführung des Kleincn und die Verinner-
lichung der Einzelerscheinung — also die Haupt-
vorzüge uud Eigentümlichkeiten des Gartens — sich wohl
schlecht würden vertragen haben. Auch fehlt^jede
läppische Spielerei, die in den Anlagen dieses Stils
so häufig sind, ja die selbst in dem sakrosankten
antiken Pompei oft genug vorkommen.
Veitshöchheim wurde in demselben Geist wie
Würzburg angelegt. Ein großer Teil der Skulptur-
arbeit, besonders das Ornamentale der Bänke, Treppen,
Balustraden, auch einzelne Statuen, stehen durchaus
aus der Höhe der Würzburger Leistungen, und die
Künstler sind wohl die gleichen in diesen Fällen, da
wie dort.
Dann aber kommt rasch der Verfall. Die Tollheit
bricht in die Gärten der Schönheit, noch dazu die
gelehrte Tollheit. Da ist es aus mit der Schönheit.
Der Sinn möchte an ihre Stelle treten; doch öfter
ift es, ästhetisch gesehen, der llnsinn.
Historisch mag die Sache so verlaufen sein:
Der eigentlich kunstschöpferische Fürst, Karl Philipp
von Greifenklau, starb. Auch sein großer Baumeister,
Johann Balthasar Neumann, folgte ihm bald nach.
Der neue Fürst, Adam Friedrich von Seiiisheim,
war zwar kein kunstfeindlicher Mann, setzte auch das
Werk seiner Vorgänger fort; aber er war, so scheint
es allem nach, ein Kunstfreund, ohne eine Künstlernatur
zu sein. Er liebte die Kunst, liebte in Ansührungs-
zeichen, hatte aber kein innerlich eigenes Kuiistbedürfnis,
keine eingebornen Knnstinstinkte. Derartige Freunde
sind der Kunst gefährlicher als ihre schlimmsten Feinde,
die sich als svlche geben. Seinsheim war ein Mann
dcr Aufklärung, der Philosophie und der Philosophieen,
der rationalistischen Religionsdeutnng; ich glaube, er
war in seinein Jnnersten ein Voltairianer mit pro-
testantisch-deutscher Färbung. Er gehört unstreitig zu
den besten Fürsten Würzburgs. Aber gerade die
„besten" Fürsten, wie ja auch die besten Menschen,
sind selten gute „Musikanten". „Während aber Ludwig
21
längst weltberühmt, denn es gibt etwas gleich Schönes
und Reiches dieser Art vielleicht nur noch an der
Jesuitenkirche zu Mannheim. Die gedachten Stein-
skulpturen sind dagegen ganz unberühmt. Sehr mit
llnrecht. Denn steinernen Gartenbänken von so reicher
künstlerischer Arbeit und Schvnheit, wie die zu Würz-
burg und Veitshöchheim sind, bin ich, in welchem Stil
es auch sein möchte, noch in keinem Garten der Welt
begegnet. Kein Florentiner Bildhauer des Quattro-
cento, kein noch so eifriger Gotiker hat einem geringen
Gegenstand mit mehr Jnuigkeit und Hingabe das
Schönheitssiegel seiner Kunst aufgeprägt, als wir es
hier sehen. Da geh einer hin und sehe es, und
rede mir noch ovn Rokoko im moralisch abwertenden
Sinne... ^ *
*
Veitshöchheim liegt anderthalb bis zwei Weg-
stunden von Würzburg eutfernt. Wenn man über
die Steinsbnrg auf dem Steinsberg (wo der berühmte
„Bocksbeutel" wächst) uud dann über eine Talschlucht
hinweg, am Rand eines Kiesernwaldes hin, auf einen
hohen Wartturm zngeht, braucht man bis zum Schloß-
garten vielleicht gegen drei Stunden, macht aber auch
eine der schönsten Exkursionen, die bei Würzburg
möglich sind.
Jch habe oben Würzburg ein klassisches, und Veits-
höchheim ein tolles Beispiel von Rokokoschöpfung
genannt. Jn der Tat könnte man sagen, daß sich
dieser Stil in Veitshöchheim (wie es ihm noch öfter
vorgekommen ist) geistig übernommen hat und närrisch
geworden ist. Jn Würzburg hat offenbar ein in hohem
Grad künstlerischer Geist (etwa der ältere Neumann,
der Erbauer des Schlosses) eine einheitliche, innerhalb
des Stiles nur irgend mögliche Schönheit cmgestrebt
und hat zu seiuem Zweck die talentvollsten Künstler
auszufinden gewußt. Er hat, was er anstrebte, voll-
kommen erreicht. Der Garten ist, trotz seines ver-
hältnismäßig geringen Nmfangs, des Schlosses würdig.
Ja die geringe Flächenausdehnung ist eigentlich aus-
geglichen durch die mustergültige Anlage der hohen,
sich weit hinstreckenden Terrasse, die in Deutschland
ihresgleichen nicht hat und die sich wohl mit der be-
rühmten Terrasse der Villa Medici in Rom vergleichen
läßt. Die vielen glücklichen Ausblicke von dieser
Höhe, in deren Bau sich entschiedener Renaissance-
geschmack (mitten im 18. Jahrhundert) fühlbar macht,
lnssen die mangelnde Weitspurigkeit des Ganzen ver-
gessen, bei der das entzückende Detail, die sorgfältig
liebevvlle Ausführung des Kleincn und die Verinner-
lichung der Einzelerscheinung — also die Haupt-
vorzüge uud Eigentümlichkeiten des Gartens — sich wohl
schlecht würden vertragen haben. Auch fehlt^jede
läppische Spielerei, die in den Anlagen dieses Stils
so häufig sind, ja die selbst in dem sakrosankten
antiken Pompei oft genug vorkommen.
Veitshöchheim wurde in demselben Geist wie
Würzburg angelegt. Ein großer Teil der Skulptur-
arbeit, besonders das Ornamentale der Bänke, Treppen,
Balustraden, auch einzelne Statuen, stehen durchaus
aus der Höhe der Würzburger Leistungen, und die
Künstler sind wohl die gleichen in diesen Fällen, da
wie dort.
Dann aber kommt rasch der Verfall. Die Tollheit
bricht in die Gärten der Schönheit, noch dazu die
gelehrte Tollheit. Da ist es aus mit der Schönheit.
Der Sinn möchte an ihre Stelle treten; doch öfter
ift es, ästhetisch gesehen, der llnsinn.
Historisch mag die Sache so verlaufen sein:
Der eigentlich kunstschöpferische Fürst, Karl Philipp
von Greifenklau, starb. Auch sein großer Baumeister,
Johann Balthasar Neumann, folgte ihm bald nach.
Der neue Fürst, Adam Friedrich von Seiiisheim,
war zwar kein kunstfeindlicher Mann, setzte auch das
Werk seiner Vorgänger fort; aber er war, so scheint
es allem nach, ein Kunstfreund, ohne eine Künstlernatur
zu sein. Er liebte die Kunst, liebte in Ansührungs-
zeichen, hatte aber kein innerlich eigenes Kuiistbedürfnis,
keine eingebornen Knnstinstinkte. Derartige Freunde
sind der Kunst gefährlicher als ihre schlimmsten Feinde,
die sich als svlche geben. Seinsheim war ein Mann
dcr Aufklärung, der Philosophie und der Philosophieen,
der rationalistischen Religionsdeutnng; ich glaube, er
war in seinein Jnnersten ein Voltairianer mit pro-
testantisch-deutscher Färbung. Er gehört unstreitig zu
den besten Fürsten Würzburgs. Aber gerade die
„besten" Fürsten, wie ja auch die besten Menschen,
sind selten gute „Musikanten". „Während aber Ludwig
21