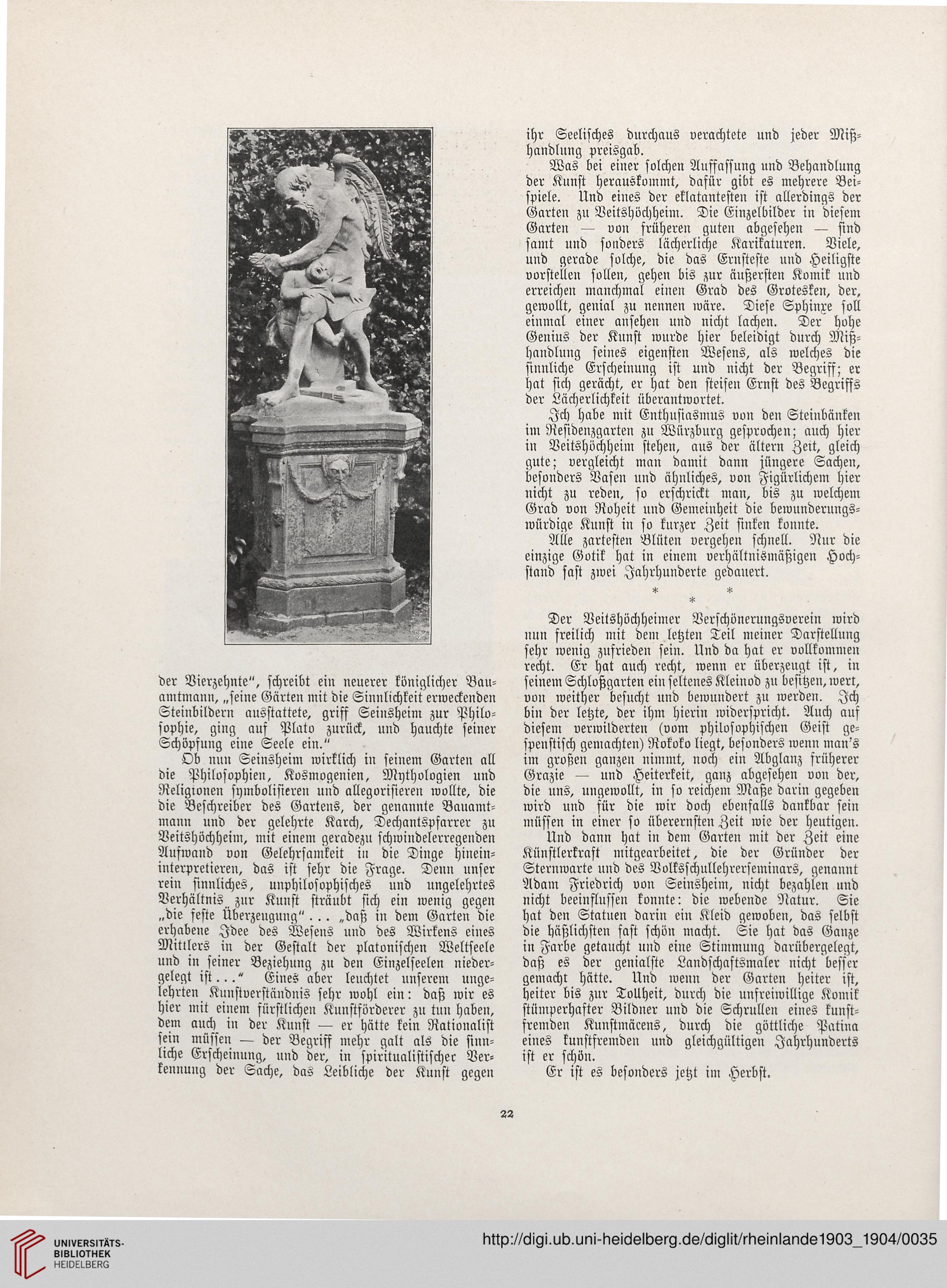der Vierzehnte", schreibt ein neuerer königlicher Bau-
amtmann, „seine Gärten mit die Sinnlichkeit erweckenden
Steinbildern ausstattete, griff Seinsheim zur Philv-
sophie, ging auf Plato zurück, und hauchte seiner
Schöpfung eine Seele ein."
Ob nun Seinsheim wirklich in seinem Garten all
die Philvsophien, Kosmogenien, Mythologien und
Religronen spmbolisieren und allegorisieren wollte, die
die Beschreiber des Gartens, der genannte Bauamt-
mann und der gelehrte Karch, Dechantspfarrer zu
Veitshöchheim, mit einem geradezu schwindelerregenden
Auswand von Gelehrsamkeit i» die Dinge hinein-
interpretieren, das ist sehr die Frage. Denn unser
rein sinnliches, unphilosophisches und ungelehrtes
Verhältnis zur Kunst sträubt sich ein wenig gegen
„die feste Überzengung" . . . „daß in dem Garten die
erhabene Jdee des Wesens und des Wirkens eines
Mitllers in der Gestalt der platonischen Weltseele
und in seiner Beziehung zu den Einzelseelen nieder-
gelegt ist..." Eines aber leuchtet unserem unge-
lehrten Kiinstverständnis sehr wohl ein: daß wir es
hier mit eineni fürstlichen Kunstförderer zu tun haben,
dem auch in der Kunst — er hätte kein Rationalist
sein müssen — der Begriff mehr galt als die sinn-
liche Erscheinung, und der, in spiritualistischec Ver-
kennung der Sache, das Leibliche der Kunst gegen
ihr Seelisches durchaus verachtete und jeder Miß-
handlung preisgab.
Was bei einer solchen Auffassung und Behandlung
der Kunst herauskommt, dafür gibt es mehrere Bei-
spiele. Und eines der eklatantesten ist allerdings der
Garten zu Veitshöchheim. Die Einzelbilder in diesem
Garten — von früheren guten abgesehen — sind
samt und sonders lächerliche Karikaturen. Viele,
und gerade solche, die das Ernsteste und Heiligste
vorsteilen svllen, gehen bis zur äußersten Komik und
erreichen manchmal einen Grad des Grotesken, der,
gewollt, genial zu nennen wäre. Diese Sphinxe soll
einmal einer ansehen und nicht lachen. Der hohe
Genius der Kunst wurde hier beleidigt durch Miß-
handlung seines eigensten Wesens, als welches die
sinnliche Erscheinung ist und nicht der Begriff; er
hat sich gerächt, er hat den steifeu Ernst des Begriffs
der Lächerlichkeit überantwortet.
Jch habe mit Enthusiasmus vvn den Steinbänken
im Residenzgarten zu Würzburg gesprochen; auch hier
in Veitshöchheim stehen, aus der ältern Zert, gleich
gute; vergleicht man damit dann jüngere Sachen,
besonders Vasen und ähnliches, von Figürlichem hier
nicht zu reden, so erschrickt man, bis zu welchem
Grad von Roheit und Gemeinheit die bewunderungs-
würdige Kunst in so kurzer Zeit sinken konnte.
Alle zartesten Blüten vergehen schnell. Nur die
einzige Gotik hat in einem verhältnismäßigen Hoch-
stand fast zwei Jahrhunderte gedauert.
* *
*
Der Veitshöchheimer Verschönerungsverein wird
uun freilich mit dem letzten Teil meiner Darstellung
sehr wenig zufrieden sein. Und da hat er vollkommen
recht. Er hat auch recht, wenn er überzeugt ist, in
seinem Schlvßgarten ein seltenes Kleinod zu besitzen,wert,
von weither besucht und bewundert zu werden. Jch
bin der letzte, der ihm hierin widerspricht. Auch auf
diesem verwilderten (vom philosophischen Geist ge-
spenstisch gemachten) Rokoko liegt, besonders wenn man's
im großen ganzen nimmt, noch ein Abglanz früherer
Grazie — und Heiterkeit, ganz abgesehen von der,
die uns, ungewollt, in so reichem Maße darin gegeben
wird und für die wir doch ebenfalls dankbar sein
müssen in einer so überernsten Zeit wie der heutigen.
Und dann hat in dem Garten mit der Zeit eine
Künstlerkraft mitgearbeitet, die der Gründer der
Sternwarte und des Volksschullehrerseminars, genannt
Adam Friedrich von Seinsheim, nicht bezahlen und
nicht beeinslussen konnte: die webende Natur. Sie
hat den Statuen darin ein Kleid gewoben, das selbst
die häßlichsten fast schön macht. Sie hat das Ganze
in Farbe getaucht und eine Stimmung darübergelegt,
daß es der genialste Landschaftsmaler nicht besser
gemacht hätte. Und wenn der Garten heiter ist,
heiter bis zur Tollheit, durch die unfreiwillige Komik
stümperhafter Bildner und die Schrullen eines kunst-
fremden Kunstmäcens, durch die göttliche Patina
eines kunstfremden und gleichgültigen Jahrhunderts
ist er schön.
Er ist es besonders jetzt im Herbst.
22
amtmann, „seine Gärten mit die Sinnlichkeit erweckenden
Steinbildern ausstattete, griff Seinsheim zur Philv-
sophie, ging auf Plato zurück, und hauchte seiner
Schöpfung eine Seele ein."
Ob nun Seinsheim wirklich in seinem Garten all
die Philvsophien, Kosmogenien, Mythologien und
Religronen spmbolisieren und allegorisieren wollte, die
die Beschreiber des Gartens, der genannte Bauamt-
mann und der gelehrte Karch, Dechantspfarrer zu
Veitshöchheim, mit einem geradezu schwindelerregenden
Auswand von Gelehrsamkeit i» die Dinge hinein-
interpretieren, das ist sehr die Frage. Denn unser
rein sinnliches, unphilosophisches und ungelehrtes
Verhältnis zur Kunst sträubt sich ein wenig gegen
„die feste Überzengung" . . . „daß in dem Garten die
erhabene Jdee des Wesens und des Wirkens eines
Mitllers in der Gestalt der platonischen Weltseele
und in seiner Beziehung zu den Einzelseelen nieder-
gelegt ist..." Eines aber leuchtet unserem unge-
lehrten Kiinstverständnis sehr wohl ein: daß wir es
hier mit eineni fürstlichen Kunstförderer zu tun haben,
dem auch in der Kunst — er hätte kein Rationalist
sein müssen — der Begriff mehr galt als die sinn-
liche Erscheinung, und der, in spiritualistischec Ver-
kennung der Sache, das Leibliche der Kunst gegen
ihr Seelisches durchaus verachtete und jeder Miß-
handlung preisgab.
Was bei einer solchen Auffassung und Behandlung
der Kunst herauskommt, dafür gibt es mehrere Bei-
spiele. Und eines der eklatantesten ist allerdings der
Garten zu Veitshöchheim. Die Einzelbilder in diesem
Garten — von früheren guten abgesehen — sind
samt und sonders lächerliche Karikaturen. Viele,
und gerade solche, die das Ernsteste und Heiligste
vorsteilen svllen, gehen bis zur äußersten Komik und
erreichen manchmal einen Grad des Grotesken, der,
gewollt, genial zu nennen wäre. Diese Sphinxe soll
einmal einer ansehen und nicht lachen. Der hohe
Genius der Kunst wurde hier beleidigt durch Miß-
handlung seines eigensten Wesens, als welches die
sinnliche Erscheinung ist und nicht der Begriff; er
hat sich gerächt, er hat den steifeu Ernst des Begriffs
der Lächerlichkeit überantwortet.
Jch habe mit Enthusiasmus vvn den Steinbänken
im Residenzgarten zu Würzburg gesprochen; auch hier
in Veitshöchheim stehen, aus der ältern Zert, gleich
gute; vergleicht man damit dann jüngere Sachen,
besonders Vasen und ähnliches, von Figürlichem hier
nicht zu reden, so erschrickt man, bis zu welchem
Grad von Roheit und Gemeinheit die bewunderungs-
würdige Kunst in so kurzer Zeit sinken konnte.
Alle zartesten Blüten vergehen schnell. Nur die
einzige Gotik hat in einem verhältnismäßigen Hoch-
stand fast zwei Jahrhunderte gedauert.
* *
*
Der Veitshöchheimer Verschönerungsverein wird
uun freilich mit dem letzten Teil meiner Darstellung
sehr wenig zufrieden sein. Und da hat er vollkommen
recht. Er hat auch recht, wenn er überzeugt ist, in
seinem Schlvßgarten ein seltenes Kleinod zu besitzen,wert,
von weither besucht und bewundert zu werden. Jch
bin der letzte, der ihm hierin widerspricht. Auch auf
diesem verwilderten (vom philosophischen Geist ge-
spenstisch gemachten) Rokoko liegt, besonders wenn man's
im großen ganzen nimmt, noch ein Abglanz früherer
Grazie — und Heiterkeit, ganz abgesehen von der,
die uns, ungewollt, in so reichem Maße darin gegeben
wird und für die wir doch ebenfalls dankbar sein
müssen in einer so überernsten Zeit wie der heutigen.
Und dann hat in dem Garten mit der Zeit eine
Künstlerkraft mitgearbeitet, die der Gründer der
Sternwarte und des Volksschullehrerseminars, genannt
Adam Friedrich von Seinsheim, nicht bezahlen und
nicht beeinslussen konnte: die webende Natur. Sie
hat den Statuen darin ein Kleid gewoben, das selbst
die häßlichsten fast schön macht. Sie hat das Ganze
in Farbe getaucht und eine Stimmung darübergelegt,
daß es der genialste Landschaftsmaler nicht besser
gemacht hätte. Und wenn der Garten heiter ist,
heiter bis zur Tollheit, durch die unfreiwillige Komik
stümperhafter Bildner und die Schrullen eines kunst-
fremden Kunstmäcens, durch die göttliche Patina
eines kunstfremden und gleichgültigen Jahrhunderts
ist er schön.
Er ist es besonders jetzt im Herbst.
22