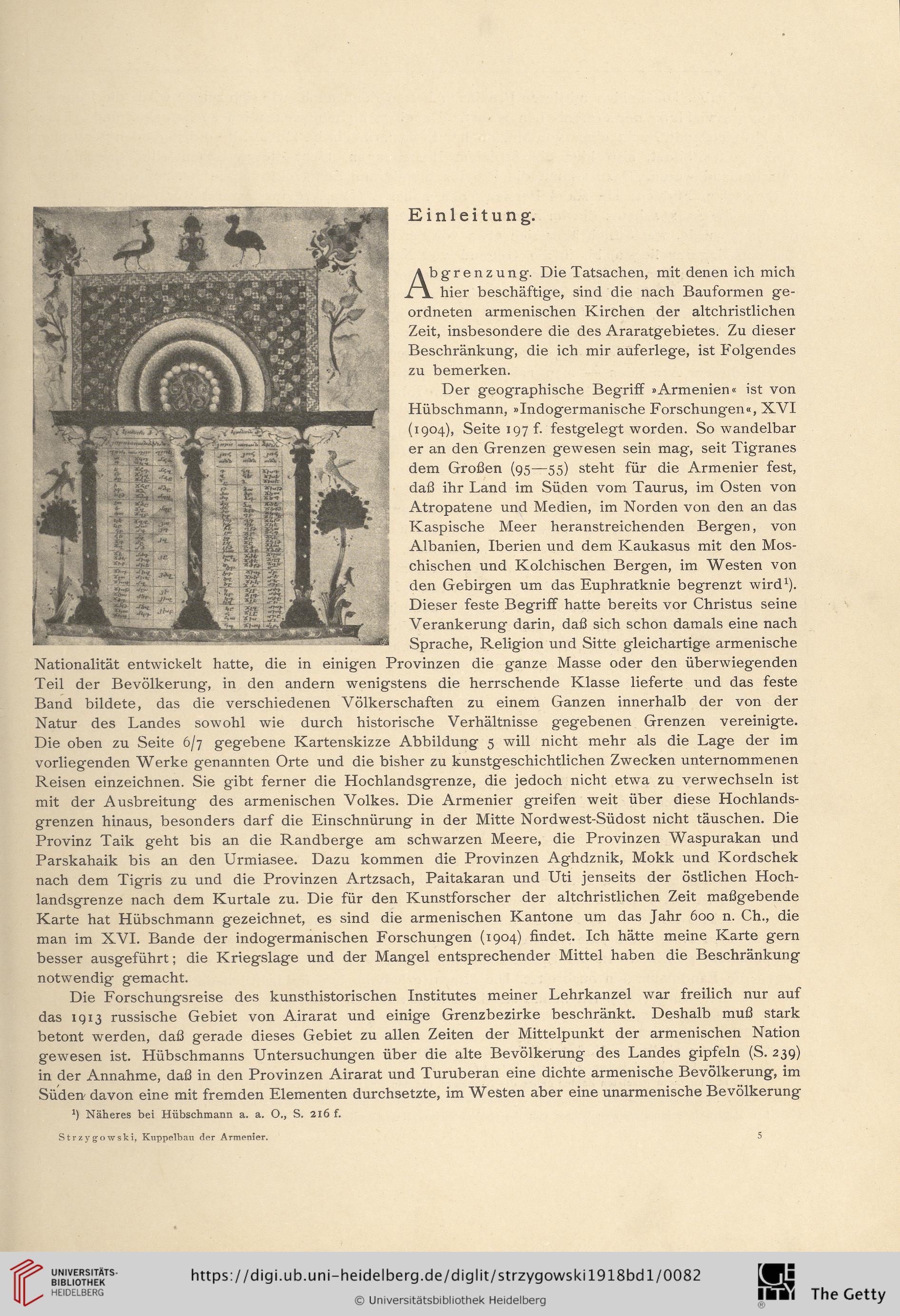Einleitung.
Abgrenzung. Die Tatsachen, mit denen ich mich
u hier beschäftige, sind die nach Bauformen ge-
ordneten armenischen Kirchen der altchristlichen
Zeit, insbesondere die des Araratgebietes. Zu dieser
Beschränkung, die ich mir auferlege, ist Folgendes
zu bemerken.
Der geographische Begriff »Armenien« ist von
Hübschmann, »Indogermanische Forschungen«, XVI
(1904), Seite 197 f. festgelegt worden. So wandelbar
er an den Grenzen gewesen sein mag, seit Tigranes
dem Großen (95—55) steht für die Armenier fest,
daß ihr Land im Süden vom Taurus, im Osten von
Atropatene und Medien, im Norden von den an das
Kaspische Meer heranstreichenden Bergen, von
Albanien, Iberien und dem Kaukasus mit den Mos-
chischen und Kolchischen Bergen, im Westen von
den Gebirgen um das Euphratknie begrenzt wird1).
Dieser feste Begriff hatte bereits vor Christus seine
Verankerung darin, daß sich schon damals eine nach
Sprache, Religion und Sitte gleichartige armenische
Nationalität entwickelt hatte, die in einigen Provinzen die ganze Masse oder den überwiegenden
Teil der Bevölkerung, in den andern wenigstens die herrschende Klasse lieferte und das feste
Band bildete, das die verschiedenen Völkerschaften zu einem Ganzen innerhalb der von der
Natur des Landes sowohl wie durch historische Verhältnisse gegebenen Grenzen vereinigte.
Die oben zu Seite 6/7 gegebene Kartenskizze Abbildung 5 will nicht mehr als die Lage der im
vorliegenden Werke genannten Orte und die bisher zu kunstgeschichtlichen Zwecken unternommenen
Reisen einzeichnen. Sie gibt ferner die Hochlandsgrenze, die jedoch nicht etwa zu verwechseln ist
mit der Ausbreitung des armenischen Volkes. Die Armenier greifen weit über diese Hochlands-
grenzen hinaus, besonders darf die Einschnürung in der Mitte Nordwest-Südost nicht täuschen. Die
Provinz Taik geht bis an die Randberge am schwarzen Meere, die Provinzen Waspurakan und
Parskahaik bis an den Urmiasee. Dazu kommen die Provinzen Aghdznik, Mokk und Kordschek
nach dem Tigris zu und die Provinzen Artzsach, Paitakaran und Uti jenseits der östlichen Hoch-
landsgrenze nach dem Kurtale zu. Die für den Kunstforscher der altchristlichen Zeit maßgebende
Karte hat Hübschmann gezeichnet, es sind die armenischen Kantone um das Jahr 600 n. Ch., die
man im XVI. Bande der indogermanischen Forschungen (1904) findet. Ich hätte meine Karte gern
besser ausgeführt; die Kriegslage und der Mangel entsprechender Mittel haben die Beschränkung
notwendig gemacht.
Die Forschungsreise des kunsthistorischen Institutes meiner Lehrkanzel war freilich nur auf
das 1913 russische Gebiet von Airarat und einige Grenzbezirke beschränkt. Deshalb muß stark
betont werden, daß gerade dieses Gebiet zu allen Zeiten der Mittelpunkt der armenischen Nation
gewesen ist. Hübschmanns Untersuchungen über die alte Bevölkerung des Landes gipfeln (S. 239)
in der Annahme, daß in den Provinzen Airarat und Turuberan eine dichte armenische Bevölkerung, im
Süden' davon eine mit fremden Elementen durchsetzte, im Westen aber eine unarmenische Bevölkerung
9 Näheres bei Hübschmann a. a. O., S. 216 f.
Strzygowski, Kuppelbati der Armenier.
5
Abgrenzung. Die Tatsachen, mit denen ich mich
u hier beschäftige, sind die nach Bauformen ge-
ordneten armenischen Kirchen der altchristlichen
Zeit, insbesondere die des Araratgebietes. Zu dieser
Beschränkung, die ich mir auferlege, ist Folgendes
zu bemerken.
Der geographische Begriff »Armenien« ist von
Hübschmann, »Indogermanische Forschungen«, XVI
(1904), Seite 197 f. festgelegt worden. So wandelbar
er an den Grenzen gewesen sein mag, seit Tigranes
dem Großen (95—55) steht für die Armenier fest,
daß ihr Land im Süden vom Taurus, im Osten von
Atropatene und Medien, im Norden von den an das
Kaspische Meer heranstreichenden Bergen, von
Albanien, Iberien und dem Kaukasus mit den Mos-
chischen und Kolchischen Bergen, im Westen von
den Gebirgen um das Euphratknie begrenzt wird1).
Dieser feste Begriff hatte bereits vor Christus seine
Verankerung darin, daß sich schon damals eine nach
Sprache, Religion und Sitte gleichartige armenische
Nationalität entwickelt hatte, die in einigen Provinzen die ganze Masse oder den überwiegenden
Teil der Bevölkerung, in den andern wenigstens die herrschende Klasse lieferte und das feste
Band bildete, das die verschiedenen Völkerschaften zu einem Ganzen innerhalb der von der
Natur des Landes sowohl wie durch historische Verhältnisse gegebenen Grenzen vereinigte.
Die oben zu Seite 6/7 gegebene Kartenskizze Abbildung 5 will nicht mehr als die Lage der im
vorliegenden Werke genannten Orte und die bisher zu kunstgeschichtlichen Zwecken unternommenen
Reisen einzeichnen. Sie gibt ferner die Hochlandsgrenze, die jedoch nicht etwa zu verwechseln ist
mit der Ausbreitung des armenischen Volkes. Die Armenier greifen weit über diese Hochlands-
grenzen hinaus, besonders darf die Einschnürung in der Mitte Nordwest-Südost nicht täuschen. Die
Provinz Taik geht bis an die Randberge am schwarzen Meere, die Provinzen Waspurakan und
Parskahaik bis an den Urmiasee. Dazu kommen die Provinzen Aghdznik, Mokk und Kordschek
nach dem Tigris zu und die Provinzen Artzsach, Paitakaran und Uti jenseits der östlichen Hoch-
landsgrenze nach dem Kurtale zu. Die für den Kunstforscher der altchristlichen Zeit maßgebende
Karte hat Hübschmann gezeichnet, es sind die armenischen Kantone um das Jahr 600 n. Ch., die
man im XVI. Bande der indogermanischen Forschungen (1904) findet. Ich hätte meine Karte gern
besser ausgeführt; die Kriegslage und der Mangel entsprechender Mittel haben die Beschränkung
notwendig gemacht.
Die Forschungsreise des kunsthistorischen Institutes meiner Lehrkanzel war freilich nur auf
das 1913 russische Gebiet von Airarat und einige Grenzbezirke beschränkt. Deshalb muß stark
betont werden, daß gerade dieses Gebiet zu allen Zeiten der Mittelpunkt der armenischen Nation
gewesen ist. Hübschmanns Untersuchungen über die alte Bevölkerung des Landes gipfeln (S. 239)
in der Annahme, daß in den Provinzen Airarat und Turuberan eine dichte armenische Bevölkerung, im
Süden' davon eine mit fremden Elementen durchsetzte, im Westen aber eine unarmenische Bevölkerung
9 Näheres bei Hübschmann a. a. O., S. 216 f.
Strzygowski, Kuppelbati der Armenier.
5