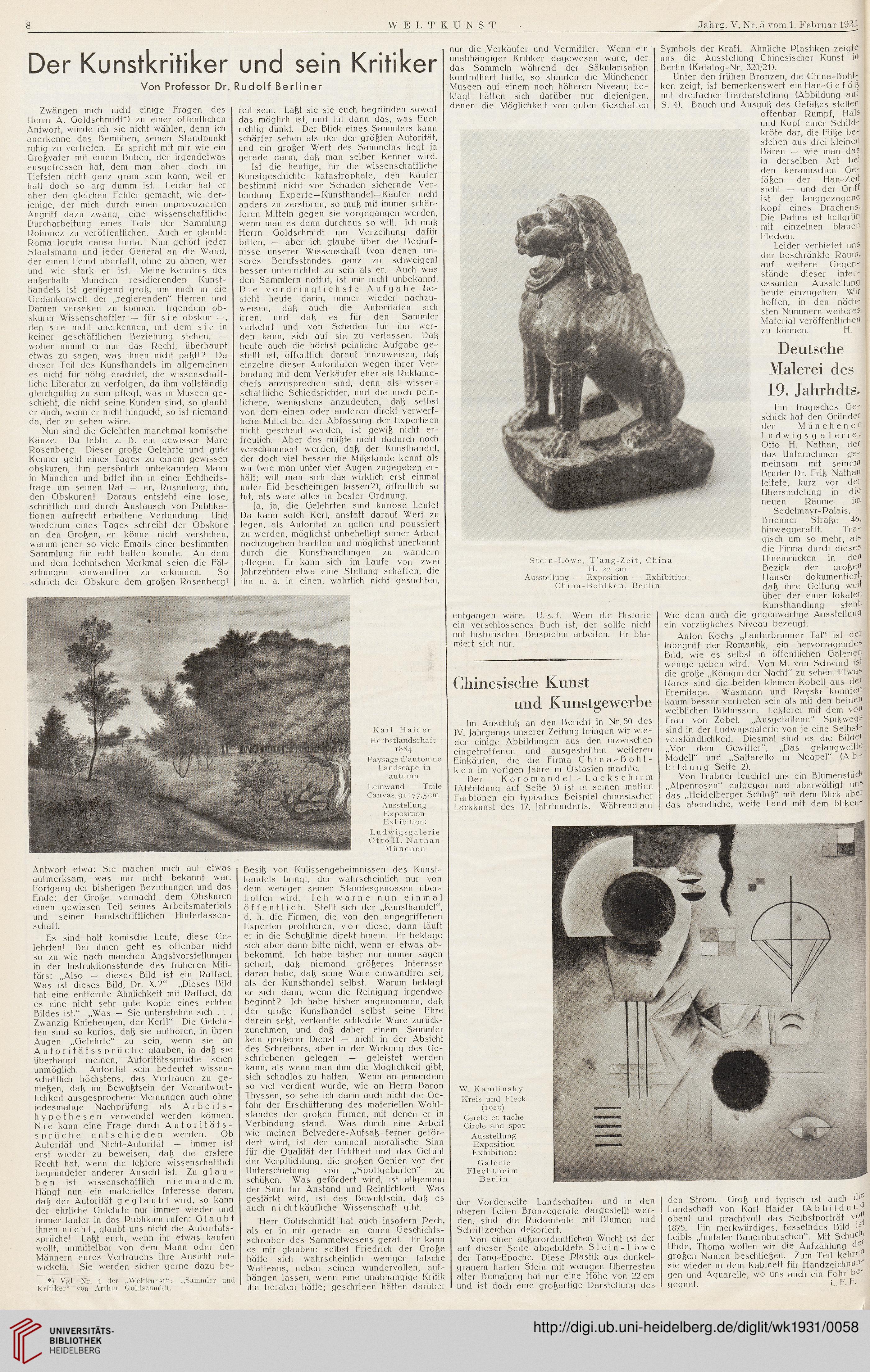8
WELTKUNST
Jahrg. V, Nr. 5 vom 1. Februar 1931
Der Kunstkritiker und sein Kritiker
Von Professor Dr. Rudolf Berliner
Zwängen mich nicht einige Fragen des
Herrn A. Goldschmidt*) zu einer öffentlichen
Antwort, würde ich sie nicht wählen, denn ich
anerkenne das Bemühen, seinen Standpunkt
ruhig zu vertreten. Er spricht mit mir wie ein
Großvater mit einem Buben, der irgendetwas
ausgefressen hat, dem man aber doch im
Tiefsten nicht ganz gram sein kann, weil er
halt doch so arg dumm ist. Leider hat er
aber den gleichen Fehler gemacht, wie der-
jenige, der mich durch einen unprovozierten
Angriff dazu zwang, eine wissenschaftliche
Durcharbeitung eines Teils der Sammlung
Rohoncz zu veröffentlichen. Auch er glaubt:
Roma locuta causa finita. Nun gehört jeder
Staatsmann und jeder General an die Wand,
der einen Feind überfällt, ohne zu ahnen, wer
und wie stark er ist. Meine Kenntnis des
außerhalb München residierenden Kunsf-
h'andels ist genügend groß, um mich in die
Gedankenwelt der „regierenden" Herren und
Damen versehen zu können. Irgendein ob-
skurer Wissenschaftler — für sie obskur —,
den s i e nicht anerkennen, mit dem sie in
keiner geschäftlichen Beziehung stehen, —
woher nimmt er nur das Recht, überhaupt
etwas zu sagen, was ihnen nicht paßt!? Da
dieser Teil des Kunsthandels im allgemeinen
es nicht für nötig erachtet, die wissenschaft-
liche Literatur zu verfolgen, da ihm vollständig
gleichgültig zu sein pflegt, was in Museen ge-
schieht, die nicht seine Kunden sind, so glaubt
er auch, wenn er nicht hinguckt, so ist niemand
da, der zu sehen wäre.
Nun sind die Gelehrten manchmal komische
Käuze. Da lebte z. B. ein gewisser Marc
Rosenberg. Dieser große Gelehrte und gute
Kenner geht eines Tages zu einem gewissen
obskuren, ihm persönlich unbekannten Mann
in München und bittet ihn in einer Echtheits-
frage um seinen Rat — er, Rosenberg, ihn,
den Obskuren! Daraus entsteht eine lose,
schriftlich und durch Austausch von Publika-
tionen aufrecht erhaltene Verbindung. Und
wiederum eines Tages schreibt der Obskure
an den Großen, er könne nicht verstehen,
warum jener so viele Emails einer bestimmten
Sammlung für echt halten konnte. An dem
und dem technischen Merkmal seien die Fäl-
schungen einwandfrei zu erkennen. So
schrieb der Obskure dem großen Rosenberg!
reit sein. Laßt sie sie euch begründen soweit
das möglich ist, und tut dann das, was Euch
richtig dünkt. Der Blick eines Sammlers kann
schärfer sehen als der der größten Autorität,
und ein großer Wert des Sammelns liegt ja
gerade darin, daß man selber Kenner wird.
Ist die heutige, für die wissenschaftliche
Kunstgeschichte katastrophale, den Käufer
bestimmt nicht vor Schaden sichernde Ver-
bindung Experte—Kunsthandel—Käufer nicht
anders zu zerstören, so muß mit immer schär-
feren Mitteln gegen sie vorgegangen werden,
wenn man es denn durchaus so will. Ich muß
Herrn Goldschmidt um Verzeihung dafür
bitten, — aber ich glaube über die Bedürf-
nisse unserer Wissenschaft (von denen un-
seres Berufsstandes ganz zu schweigen)
besser unterrichtet zu sein als er. Auch was
den Sammlern nottut, ist mir nicht unbekannt.
Die vordringlichste Aufgabe be-
steht heute darin, immer wieder nachzu-
weisen, daß auch die Autoritäten sich
irren, und daß es für den Sammler
verkehrt und von Schaden für ihn wer-
den kann, sich auf sie zu verlassen. Daß
heute auch die höchst peinliche Aufgabe ge-
stellt ist, öffentlich darauf hinzuweisen, daß
einzelne dieser Autoritäten wegen ihrer Ver-
bindung mit dem Verkäufer eher als Reklame-
chefs anzusprechen sind, denn als wissen-
schaftliche Schiedsrichter, und die noch pein-
lichere, wenigstens anzudeuten, daß selbst
von dem einen oder anderen direkt verwerf-
liche Mittel bei der Abfassung der Expertisen
nicht gescheut werden, ist gewiß nicht er-
freulich. Aber das müßte nicht dadurch noch
verschlimmert werden, daß der Kunsthandel,
der doch viel besser die Mißstände kennt als
wir (wie man unter vier Augen zugegeben er-
hält; will man sich das wirklich erst einmal
unter Eid bescheinigen lassen?), öffentlich so
tut, als wäre alles in bester Ordnung.
Ja, ja, die Gelehrten sind kuriose Leute!
Da kann solch Kerl, anstatt darauf Wert zu
legen, als Autorität zu gelten und poussiert
zu werden, möglichst unbehelligt seiner Arbeit
nachzugehen trachten und möglichst unerkannt
durch die Kunsthandlungen zu wandern
pflegen. Er kann sich im Laufe von zwei
Jahrzehnten etwa eine Stellung schaffen, die
ihn u. a. in einen, wahrlich nicht gesuchten,
Karl Haider
Herbstlandschaft
1884
Paysage d’automne
Landscape in
autumn
Leinwand — Toile
Canvas, 91:77,5 cm
Ausstellung
Exposition
Exhibition:
Ludwigsgalerie
Otto H. Nathan
München
Antwort etwa: Sie machen mich auf etwas
aufmerksam, was mir nicht bekannt war.
Fortgang der bisherigen Beziehungen und das
Ende: der Große vermacht dem Obskuren
einen gewissen Teil seines Arbeitsmaterials
und seiner handschriftlichen Hinterlassen-
schaft.
Es sind halt komische Leute, diese Ge-
lehrten! Bei ihnen geht es offenbar nicht
so zu wie nach manchen Angstvorstellungen
in der Instruktionsstunde des früheren Mili-
tärs: „Also — dieses Bild ist ein Raffael.
Was ist dieses Bild, Dr. X.?“ „Dieses Bild
hat eine entfernte Ähnlichkeit mit Raffael, da
es eine nicht sehr gute Kopie eines echten
Bildes ist." „Was — Sie unterstehen sich . . .
Zwanzig Kniebeugen, der Kerl!“ Die Gelehr-
ten sind so kurios, daß sie aufhören, in ihren
Augen „Gelehrte" zu sein, wenn sie an
Autoritätssprüche glauben, ja daß sie
überhaupt meinen, Autoritätssprüche seien
unmöglich. Autorität sein bedeutet wissen-
schaftlich höchstens, das Vertrauen zu ge-
nießen, daß im Bewußtsein der Verantwort-
lichkeit ausgesprochene Meinungen auch ohne
jedesmalige Nachprüfung als Arbeits-
hypothesen verwendet werden können.
N i e kann eine Frage durch Autoritäts-
sprüche entschieden werden. Ob
Autorität und Nicht-Autorität — immer ist
erst wieder zu beweisen, daß die erstere
Recht hat, wenn die leßtere wissenschaftlich
begründeter anderer Ansicht ist. Zu glau-
ben ist wissenschaftlich niemandem.
Hängt nun ein materielles Interesse daran,
daß der Autorität geglaubt wird, so kann
der ehrliche Gelehrte nur immer wieder und
immer lauter in das Publikum rufen: Glaubt
ihnen nicht, glaubt uns nicht die Autoritäts-
sprüche! Laßt euch, wenn ihr etwas kaufen
wollt, unmittelbar von dem Mann oder den
Männern eures Vertrauens ihre Ansicht ent-
wickeln. Sie werden sicher gerne dazu be-
*) Vgl. Nr. 4 der ..Wettknnst“: „Sammler und
Kritiker“ von Arthur Goldschmidt.
Besiß von Kulissengeheimnissen des Kunst-
handels bringt, der wahrscheinlich nur von
dem weniger seiner Standesgenossen über-
troffen wird. Ich warne nun einmal
öffentlich. Stellt sich der „Kunsthandel",
d. h. die Firmen, die von den angegriffenen
Experten profitieren, vor diese, dann läuft
er in die Schußlinie direkt hinein. Er beklage
sich aber dann bitte nicht, wenn er etwas ab-
bekommt. Ich habe bisher nur immer sagen
gehört, daß niemand größeres Interesse
daran habe, daß seine Ware einwandfrei sei,
als der Kunsthandel selbst. Warum beklagt
er sich dann, wenn die Reinigung irgendwo
beginnt? Ich habe bisher angenommen, daß
der große Kunsthandel selbst seine Ehre
darein seßt, verkaufte schlechte Ware zurück-
zunehmen, und daß daher einem Sammler
kein größerer Dienst — nicht in der Absicht
des Schreibers, aber in der Wirkung des Ge-
schriebenen gelegen — geleistet werden
kann, als wenn man ihm die Möglichkeit gibt,
sich schadlos zu halten. Wenn an jemandem
so viel verdient wurde, wie an Herrn Baron
Thyssen, so sehe ich darin auch nicht die Ge-
fahr der Erschütterung des materiellen Wohl-
standes der großen Firmen, mit denen er in
Verbindung- stand. Was durch eine Arbeit
wie meinen Belvedere-Aufsaß ferner geför-
dert wird, ist der eminent moralische Sinn
für die Qualität der Echtheit und das Gefühl
der Verpflichtung, die großen Genien vor der
Unterschiebung von „Spottgeburten" zu
Schüßen. Was gefördert wird, ist allgemein
der Sinn für Anstand und Reinlichkeit. Was
gestärkt wird, ist das Bewußtsein, daß es
auch n i ch t käufliche Wissenschaft gibt.
Herr Goldschmidt hat auch insofern Pech,
als er in mir gerade an einen Geschichts-
schreiber des Sammelwesens gerät. Er kann
es mir glauben: selbst Friedrich der Große
hätte sich wahrscheinlich weniger falsche
Watfeaus, neben seinen wundervollen, auf-
hängen lassen, wenn eine unabhängige Kritik
ihn beraten hätte; geschrieen hätten darüber
nur die Verkäufer und Vermittler. Wenn ein
unabhängiger Kritiker dagewesen wäre, der
das Sammeln während der Säkularisation
kontrolliert hätte, so stünden die Münchener
Museen auf einem noch höheren Niveau; be-
klagt hätten sich darüber nur diejenigen,
denen die Möglichkeit von guten Geschäften
Symbols der Kraft. Ähnliche Plastiken zeigte
uns die Ausstellung Chinesischer Kunst in
Berlin (Katalog-Nr. 320/21).
Unter den frühen Bronzen, die China-Bohl"
ken zeigt, ist bemerkenswert ein Han-G e f ä ß
mit dreifacher Tierdarstellung (Abbildung auf
S. 4). Bauch und Ausguß des Gefäßes stellen
offenbar Rumpf, Hals
und Kopf einer Schild"
kröte dar, die Füße ibe"
stehen aus drei kleinen
Bären — wie man das
in derselben Art bei
den keramischen Ge"
faßen der Han-Zeit
sieht — und der Griff
ist der langgezogene
Kopf eines Drachens-
Die Patina ist hellgrün
mit einzelnen blauen
Flecken.
Leider verbietet uns
der beschränkte Raum,
auf weitere Gegen"
stände dieser inter"
essanten Ausstellung
heute einzugehen. Wir
hoffen, in den näch"
sten Nummern weiteres
Material veröffentlichen
zu können. H.
Deutsche
Malerei des
19. Jahrhdts.
Ein tragisches Oe"
schick hat den Gründer
der Münchener
Ludwigsgalerie,
Otto H. Nathan, der
das Unternehmen ge"
meinsam mit seinem
Bruder Dr. Friß Nathan
leitete, kurz vor der
Übersiedelung in die
neuen Räume im
Sedelmayr-Palais,
Brienner Straße 46,
hinweggerafft. Tra"
gisch um so mehr, al5
die Firma durch dieses
China
Exhibition:
Stein-Löwe, T’ang-Zeit,
H. 22 cm
Ausstellung — Exposition —
Cliina-Bohlken, Berlin
entgangen wäre. U.s. f. Wem die Historie
ein verschlossenes Buch ist, der sollte nicht
mit historischen Beispielen arbeiten. Er bla-
miert sich nur.
Chinesische Kunst
und Kunstgewerbe
Im Anschluß an den Bericht in Nr. 50 des
IV. Jahrgangs unserer Zeitung bringen wir wie-
der einige Abbildungen aus den inzwischen
eingetroffenen und ausgestellten weiteren
Einkäufen, die die Firma China-Bo hl-
k e n im vorigen Jahre in Ostasien machte.
Der Koromandet - Lackschirm
(Abbildung auf Seite 3) ist in seinen matten
Farbtönen ein typisches Beispiel chinesischer
Lackkunst des 17. Jahrhunderts. Während auf
Hineinrücken in den
Bezirk der großen
Häuser dokumentiert,
daß ihre Geltung weit
über der einer lokalen
Kunsthandlung steht-
Wie denn auch die gegenwärtige Ausstellung
ein vorzügliches Niveau bezeugt.
Anton Kochs „Lauterbrunner Tal" ist der
Inbegriff der Romantik, ein hervorragendes
Bild, wie es selbst in öffentlichen Galerien
wenige geben wird. Von M. von Schwind ist
die große „Königin der Nacht" zu sehen. Etwas
Rares sind die beiden kleinen Kobell aus der
Eremitage. Wasmann und Rayski könnten
kaum besser vertreten sein als mit den beiden
weiblichen Bildnissen. Leßterer mit dem von
Frau von Zobel. „Ausgefallene“ Spißweg5
sind in der Ludwigsgalerie von je eine Selbst"
Verständlichkeit. Diesmal sind es die Bilder
„Vor dem Gewitter“, „Das gelangweilte
Modell“ und „Saltarello in Neapel“ (Ab"
b i 1 d u n g Seite 2).
Von Trübner leuchtet uns ein Blumenstück
„Alpenrosen" entgegen und überwältigt uns
das „Heidelberger Schloß" mit dem Blick über
das abendliche, weite Land mit dem büßen"
W. Kandinsky
Kreis und Fleck
(1929)
Cercle et tache
Circle and spot
Ausstellung
Exposition
Exhibition:
Galerie
Flechtheim
Berlin
der Vorderseite Landschaften und in den
oberen Teilen Bronzegeräte dargestelli wer-
den, sind die Rückenteile mit Blumen und
Schriftzeichen dekoriert.
Von einer außerordentlichen Wucht ist der
auf dieser Seite abgebildete Stein-Löwe
der Tang-Epoche. Diese Plastik aus dunkel-
grauem harten Stein mit wenigen llberresten
alter Bemalung hat nur eine Höhe von 22 cm
und ist doch eine großartige Darstellung des
den Strom. Groß und typisch ist auch d'e
Landschaft von Karl Haider (Abbildung
oben) und prachtvoll das Selbstporträt v°r’
1875. Ein merkwürdiges, fesselndes Bild
Leibis „Inntaler Bauernburschen". Mit Schild1’
Uhde, Thoma wollen wir die Aufzählung de1
großen Namen beschließen. Zum Teil kehre'1
sie wieder in dem Kabinett für Handzeichnui1*
gen und Aquarelle, wo uns auch ein Fohr be"
gegnet. 1- F. F.
WELTKUNST
Jahrg. V, Nr. 5 vom 1. Februar 1931
Der Kunstkritiker und sein Kritiker
Von Professor Dr. Rudolf Berliner
Zwängen mich nicht einige Fragen des
Herrn A. Goldschmidt*) zu einer öffentlichen
Antwort, würde ich sie nicht wählen, denn ich
anerkenne das Bemühen, seinen Standpunkt
ruhig zu vertreten. Er spricht mit mir wie ein
Großvater mit einem Buben, der irgendetwas
ausgefressen hat, dem man aber doch im
Tiefsten nicht ganz gram sein kann, weil er
halt doch so arg dumm ist. Leider hat er
aber den gleichen Fehler gemacht, wie der-
jenige, der mich durch einen unprovozierten
Angriff dazu zwang, eine wissenschaftliche
Durcharbeitung eines Teils der Sammlung
Rohoncz zu veröffentlichen. Auch er glaubt:
Roma locuta causa finita. Nun gehört jeder
Staatsmann und jeder General an die Wand,
der einen Feind überfällt, ohne zu ahnen, wer
und wie stark er ist. Meine Kenntnis des
außerhalb München residierenden Kunsf-
h'andels ist genügend groß, um mich in die
Gedankenwelt der „regierenden" Herren und
Damen versehen zu können. Irgendein ob-
skurer Wissenschaftler — für sie obskur —,
den s i e nicht anerkennen, mit dem sie in
keiner geschäftlichen Beziehung stehen, —
woher nimmt er nur das Recht, überhaupt
etwas zu sagen, was ihnen nicht paßt!? Da
dieser Teil des Kunsthandels im allgemeinen
es nicht für nötig erachtet, die wissenschaft-
liche Literatur zu verfolgen, da ihm vollständig
gleichgültig zu sein pflegt, was in Museen ge-
schieht, die nicht seine Kunden sind, so glaubt
er auch, wenn er nicht hinguckt, so ist niemand
da, der zu sehen wäre.
Nun sind die Gelehrten manchmal komische
Käuze. Da lebte z. B. ein gewisser Marc
Rosenberg. Dieser große Gelehrte und gute
Kenner geht eines Tages zu einem gewissen
obskuren, ihm persönlich unbekannten Mann
in München und bittet ihn in einer Echtheits-
frage um seinen Rat — er, Rosenberg, ihn,
den Obskuren! Daraus entsteht eine lose,
schriftlich und durch Austausch von Publika-
tionen aufrecht erhaltene Verbindung. Und
wiederum eines Tages schreibt der Obskure
an den Großen, er könne nicht verstehen,
warum jener so viele Emails einer bestimmten
Sammlung für echt halten konnte. An dem
und dem technischen Merkmal seien die Fäl-
schungen einwandfrei zu erkennen. So
schrieb der Obskure dem großen Rosenberg!
reit sein. Laßt sie sie euch begründen soweit
das möglich ist, und tut dann das, was Euch
richtig dünkt. Der Blick eines Sammlers kann
schärfer sehen als der der größten Autorität,
und ein großer Wert des Sammelns liegt ja
gerade darin, daß man selber Kenner wird.
Ist die heutige, für die wissenschaftliche
Kunstgeschichte katastrophale, den Käufer
bestimmt nicht vor Schaden sichernde Ver-
bindung Experte—Kunsthandel—Käufer nicht
anders zu zerstören, so muß mit immer schär-
feren Mitteln gegen sie vorgegangen werden,
wenn man es denn durchaus so will. Ich muß
Herrn Goldschmidt um Verzeihung dafür
bitten, — aber ich glaube über die Bedürf-
nisse unserer Wissenschaft (von denen un-
seres Berufsstandes ganz zu schweigen)
besser unterrichtet zu sein als er. Auch was
den Sammlern nottut, ist mir nicht unbekannt.
Die vordringlichste Aufgabe be-
steht heute darin, immer wieder nachzu-
weisen, daß auch die Autoritäten sich
irren, und daß es für den Sammler
verkehrt und von Schaden für ihn wer-
den kann, sich auf sie zu verlassen. Daß
heute auch die höchst peinliche Aufgabe ge-
stellt ist, öffentlich darauf hinzuweisen, daß
einzelne dieser Autoritäten wegen ihrer Ver-
bindung mit dem Verkäufer eher als Reklame-
chefs anzusprechen sind, denn als wissen-
schaftliche Schiedsrichter, und die noch pein-
lichere, wenigstens anzudeuten, daß selbst
von dem einen oder anderen direkt verwerf-
liche Mittel bei der Abfassung der Expertisen
nicht gescheut werden, ist gewiß nicht er-
freulich. Aber das müßte nicht dadurch noch
verschlimmert werden, daß der Kunsthandel,
der doch viel besser die Mißstände kennt als
wir (wie man unter vier Augen zugegeben er-
hält; will man sich das wirklich erst einmal
unter Eid bescheinigen lassen?), öffentlich so
tut, als wäre alles in bester Ordnung.
Ja, ja, die Gelehrten sind kuriose Leute!
Da kann solch Kerl, anstatt darauf Wert zu
legen, als Autorität zu gelten und poussiert
zu werden, möglichst unbehelligt seiner Arbeit
nachzugehen trachten und möglichst unerkannt
durch die Kunsthandlungen zu wandern
pflegen. Er kann sich im Laufe von zwei
Jahrzehnten etwa eine Stellung schaffen, die
ihn u. a. in einen, wahrlich nicht gesuchten,
Karl Haider
Herbstlandschaft
1884
Paysage d’automne
Landscape in
autumn
Leinwand — Toile
Canvas, 91:77,5 cm
Ausstellung
Exposition
Exhibition:
Ludwigsgalerie
Otto H. Nathan
München
Antwort etwa: Sie machen mich auf etwas
aufmerksam, was mir nicht bekannt war.
Fortgang der bisherigen Beziehungen und das
Ende: der Große vermacht dem Obskuren
einen gewissen Teil seines Arbeitsmaterials
und seiner handschriftlichen Hinterlassen-
schaft.
Es sind halt komische Leute, diese Ge-
lehrten! Bei ihnen geht es offenbar nicht
so zu wie nach manchen Angstvorstellungen
in der Instruktionsstunde des früheren Mili-
tärs: „Also — dieses Bild ist ein Raffael.
Was ist dieses Bild, Dr. X.?“ „Dieses Bild
hat eine entfernte Ähnlichkeit mit Raffael, da
es eine nicht sehr gute Kopie eines echten
Bildes ist." „Was — Sie unterstehen sich . . .
Zwanzig Kniebeugen, der Kerl!“ Die Gelehr-
ten sind so kurios, daß sie aufhören, in ihren
Augen „Gelehrte" zu sein, wenn sie an
Autoritätssprüche glauben, ja daß sie
überhaupt meinen, Autoritätssprüche seien
unmöglich. Autorität sein bedeutet wissen-
schaftlich höchstens, das Vertrauen zu ge-
nießen, daß im Bewußtsein der Verantwort-
lichkeit ausgesprochene Meinungen auch ohne
jedesmalige Nachprüfung als Arbeits-
hypothesen verwendet werden können.
N i e kann eine Frage durch Autoritäts-
sprüche entschieden werden. Ob
Autorität und Nicht-Autorität — immer ist
erst wieder zu beweisen, daß die erstere
Recht hat, wenn die leßtere wissenschaftlich
begründeter anderer Ansicht ist. Zu glau-
ben ist wissenschaftlich niemandem.
Hängt nun ein materielles Interesse daran,
daß der Autorität geglaubt wird, so kann
der ehrliche Gelehrte nur immer wieder und
immer lauter in das Publikum rufen: Glaubt
ihnen nicht, glaubt uns nicht die Autoritäts-
sprüche! Laßt euch, wenn ihr etwas kaufen
wollt, unmittelbar von dem Mann oder den
Männern eures Vertrauens ihre Ansicht ent-
wickeln. Sie werden sicher gerne dazu be-
*) Vgl. Nr. 4 der ..Wettknnst“: „Sammler und
Kritiker“ von Arthur Goldschmidt.
Besiß von Kulissengeheimnissen des Kunst-
handels bringt, der wahrscheinlich nur von
dem weniger seiner Standesgenossen über-
troffen wird. Ich warne nun einmal
öffentlich. Stellt sich der „Kunsthandel",
d. h. die Firmen, die von den angegriffenen
Experten profitieren, vor diese, dann läuft
er in die Schußlinie direkt hinein. Er beklage
sich aber dann bitte nicht, wenn er etwas ab-
bekommt. Ich habe bisher nur immer sagen
gehört, daß niemand größeres Interesse
daran habe, daß seine Ware einwandfrei sei,
als der Kunsthandel selbst. Warum beklagt
er sich dann, wenn die Reinigung irgendwo
beginnt? Ich habe bisher angenommen, daß
der große Kunsthandel selbst seine Ehre
darein seßt, verkaufte schlechte Ware zurück-
zunehmen, und daß daher einem Sammler
kein größerer Dienst — nicht in der Absicht
des Schreibers, aber in der Wirkung des Ge-
schriebenen gelegen — geleistet werden
kann, als wenn man ihm die Möglichkeit gibt,
sich schadlos zu halten. Wenn an jemandem
so viel verdient wurde, wie an Herrn Baron
Thyssen, so sehe ich darin auch nicht die Ge-
fahr der Erschütterung des materiellen Wohl-
standes der großen Firmen, mit denen er in
Verbindung- stand. Was durch eine Arbeit
wie meinen Belvedere-Aufsaß ferner geför-
dert wird, ist der eminent moralische Sinn
für die Qualität der Echtheit und das Gefühl
der Verpflichtung, die großen Genien vor der
Unterschiebung von „Spottgeburten" zu
Schüßen. Was gefördert wird, ist allgemein
der Sinn für Anstand und Reinlichkeit. Was
gestärkt wird, ist das Bewußtsein, daß es
auch n i ch t käufliche Wissenschaft gibt.
Herr Goldschmidt hat auch insofern Pech,
als er in mir gerade an einen Geschichts-
schreiber des Sammelwesens gerät. Er kann
es mir glauben: selbst Friedrich der Große
hätte sich wahrscheinlich weniger falsche
Watfeaus, neben seinen wundervollen, auf-
hängen lassen, wenn eine unabhängige Kritik
ihn beraten hätte; geschrieen hätten darüber
nur die Verkäufer und Vermittler. Wenn ein
unabhängiger Kritiker dagewesen wäre, der
das Sammeln während der Säkularisation
kontrolliert hätte, so stünden die Münchener
Museen auf einem noch höheren Niveau; be-
klagt hätten sich darüber nur diejenigen,
denen die Möglichkeit von guten Geschäften
Symbols der Kraft. Ähnliche Plastiken zeigte
uns die Ausstellung Chinesischer Kunst in
Berlin (Katalog-Nr. 320/21).
Unter den frühen Bronzen, die China-Bohl"
ken zeigt, ist bemerkenswert ein Han-G e f ä ß
mit dreifacher Tierdarstellung (Abbildung auf
S. 4). Bauch und Ausguß des Gefäßes stellen
offenbar Rumpf, Hals
und Kopf einer Schild"
kröte dar, die Füße ibe"
stehen aus drei kleinen
Bären — wie man das
in derselben Art bei
den keramischen Ge"
faßen der Han-Zeit
sieht — und der Griff
ist der langgezogene
Kopf eines Drachens-
Die Patina ist hellgrün
mit einzelnen blauen
Flecken.
Leider verbietet uns
der beschränkte Raum,
auf weitere Gegen"
stände dieser inter"
essanten Ausstellung
heute einzugehen. Wir
hoffen, in den näch"
sten Nummern weiteres
Material veröffentlichen
zu können. H.
Deutsche
Malerei des
19. Jahrhdts.
Ein tragisches Oe"
schick hat den Gründer
der Münchener
Ludwigsgalerie,
Otto H. Nathan, der
das Unternehmen ge"
meinsam mit seinem
Bruder Dr. Friß Nathan
leitete, kurz vor der
Übersiedelung in die
neuen Räume im
Sedelmayr-Palais,
Brienner Straße 46,
hinweggerafft. Tra"
gisch um so mehr, al5
die Firma durch dieses
China
Exhibition:
Stein-Löwe, T’ang-Zeit,
H. 22 cm
Ausstellung — Exposition —
Cliina-Bohlken, Berlin
entgangen wäre. U.s. f. Wem die Historie
ein verschlossenes Buch ist, der sollte nicht
mit historischen Beispielen arbeiten. Er bla-
miert sich nur.
Chinesische Kunst
und Kunstgewerbe
Im Anschluß an den Bericht in Nr. 50 des
IV. Jahrgangs unserer Zeitung bringen wir wie-
der einige Abbildungen aus den inzwischen
eingetroffenen und ausgestellten weiteren
Einkäufen, die die Firma China-Bo hl-
k e n im vorigen Jahre in Ostasien machte.
Der Koromandet - Lackschirm
(Abbildung auf Seite 3) ist in seinen matten
Farbtönen ein typisches Beispiel chinesischer
Lackkunst des 17. Jahrhunderts. Während auf
Hineinrücken in den
Bezirk der großen
Häuser dokumentiert,
daß ihre Geltung weit
über der einer lokalen
Kunsthandlung steht-
Wie denn auch die gegenwärtige Ausstellung
ein vorzügliches Niveau bezeugt.
Anton Kochs „Lauterbrunner Tal" ist der
Inbegriff der Romantik, ein hervorragendes
Bild, wie es selbst in öffentlichen Galerien
wenige geben wird. Von M. von Schwind ist
die große „Königin der Nacht" zu sehen. Etwas
Rares sind die beiden kleinen Kobell aus der
Eremitage. Wasmann und Rayski könnten
kaum besser vertreten sein als mit den beiden
weiblichen Bildnissen. Leßterer mit dem von
Frau von Zobel. „Ausgefallene“ Spißweg5
sind in der Ludwigsgalerie von je eine Selbst"
Verständlichkeit. Diesmal sind es die Bilder
„Vor dem Gewitter“, „Das gelangweilte
Modell“ und „Saltarello in Neapel“ (Ab"
b i 1 d u n g Seite 2).
Von Trübner leuchtet uns ein Blumenstück
„Alpenrosen" entgegen und überwältigt uns
das „Heidelberger Schloß" mit dem Blick über
das abendliche, weite Land mit dem büßen"
W. Kandinsky
Kreis und Fleck
(1929)
Cercle et tache
Circle and spot
Ausstellung
Exposition
Exhibition:
Galerie
Flechtheim
Berlin
der Vorderseite Landschaften und in den
oberen Teilen Bronzegeräte dargestelli wer-
den, sind die Rückenteile mit Blumen und
Schriftzeichen dekoriert.
Von einer außerordentlichen Wucht ist der
auf dieser Seite abgebildete Stein-Löwe
der Tang-Epoche. Diese Plastik aus dunkel-
grauem harten Stein mit wenigen llberresten
alter Bemalung hat nur eine Höhe von 22 cm
und ist doch eine großartige Darstellung des
den Strom. Groß und typisch ist auch d'e
Landschaft von Karl Haider (Abbildung
oben) und prachtvoll das Selbstporträt v°r’
1875. Ein merkwürdiges, fesselndes Bild
Leibis „Inntaler Bauernburschen". Mit Schild1’
Uhde, Thoma wollen wir die Aufzählung de1
großen Namen beschließen. Zum Teil kehre'1
sie wieder in dem Kabinett für Handzeichnui1*
gen und Aquarelle, wo uns auch ein Fohr be"
gegnet. 1- F. F.