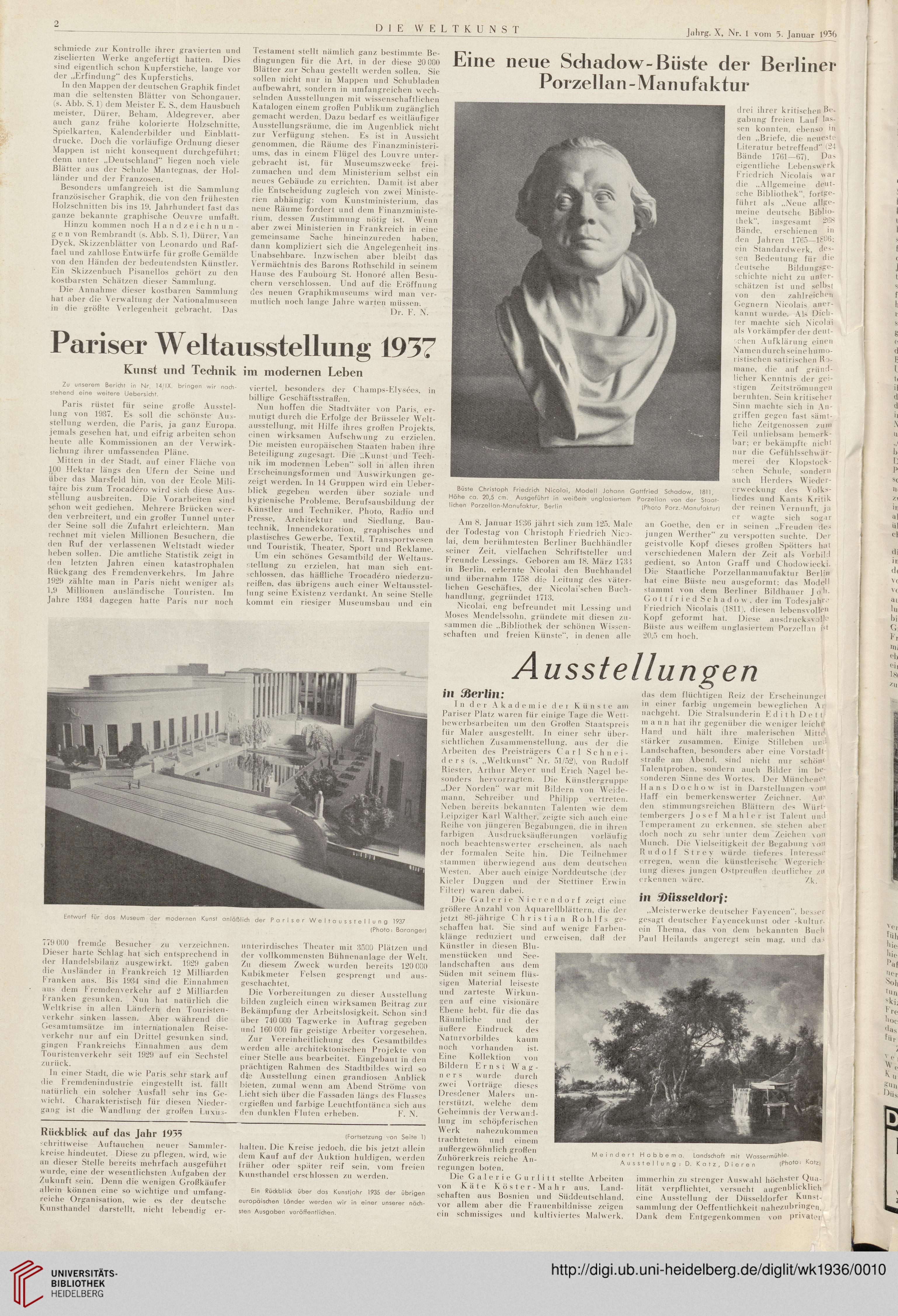2
DIE WELTKUNST
Jalirg. X, Nr. 1 vom 5. Januar 1936
schmiede zur Kontrolle ihrer gravierten und
ziselierten Werke angefertigt hatten. Dies
sind eigentlich schon Kupferstiche, lange vor
der ,,Erfindung“ des Kupferstichs.
In den Mappen der deutschen Graphik findet
man die seltensten Blätter von Schongauer,
(s. Abb. S. 1) dem Meister E. S., dem Hausbuch
meister, Dürer, Bekam, Aldegrever, aber
auch ganz frühe kolorierte Holzschnitte,
Spielkarten, Kalenderbilder und Einblatt-
drucke. Doch die vorläufige Ordnung dieser
Mappen ist nicht konsequent durchgeführt;
denn unter „Deutschland“ liegen noch viele
Blätter aus der Schule Mantegnas, der Hol-
länder und der Franzosen.
Besonders umfangreich ist die Sammlung
französischer Graphik, die von den frühesten
Holzschnitten bis ins 19. Jahrhundert fast das
ganze bekannte graphische Oeuvre umfaßt.
Hinzu kommen noch H a n d z e i c h n u n -
gen von Rembrandt (s. Abb. S. 1), Dürer, Van
Dyck, Skizzenblätter von Leonardo und Raf-
fael und zahllose Entwürfe für große Gemälde
von den Händen der bedeutendsten Künstler.
Ein Skizzenbiuch Pisanellos gehört zu den
kostbarsten Schätzen dieser Sammlung.
Die Annahme dieser kostbaren Sammlung
hat aber die Verwaltung der Nationalmuseen
in die größte Verlegenheit gebracht. Das
Testament stellt nämlich ganz bestimmte Be-
dingungen für die Art. in der diese 20 000
Blätter zur Schau gestellt werden sollen. Sie
sollen nicht nur in Mappen und Schubladen
aufbewahrt, sondern in umfangreichen wech-
selnden Ausstellungen mit wissenschaftlichen
Katalogen einem großen Publikum zugänglich
gemacht werden. Dazu bedarf es weitläufiger
Ausstellungsräume, die im Augenblick nicht
zur Verfügung stehen. Es ist in Aussicht
genommen, die Räume des Finanzministeri-
ums-, das in einem Flügel des Louvre unter-
gebracht ist, für Museumszwecke frei-
zumachen und dem Ministerium selbst ein
neues Gebäude zu errichten. Damit ist aber
die Entscheidung zugleich von zwei Ministe-
rien abhängig: vom Kunstministerium, das
neue Räume fordert und dem Finanzministe-
rium, dessen Zustimmung nötig ist. Wenn
aber zwei Ministerien in Frankreich in eine
gemeinsame Sache hineinzureden haben,
dann kompliziert sich die Angelegenheit ins
Unabsehbare. Inzwischen aber bleibt das
Vermächtnis des Barons Rothschild in seinem
Hause des Faubourg St. Honore allen Besu-
chern verschlossen. Und auf die Eröffnung
des neuen Graphikmuseums wird man ver-
mutlich noch lange Jahre warten müssen.
Dr. F. N.
Pariser W eltausstellung 1957
Kunst und Technik im modernen Leben
Zu unserem Bericht in Nr. 14/IX. bringen wir nach-
stehend eine weitere Uebersicht.
Paris rüstet für seine große Ausstel-
lung von 193". Es soll die schönste Aus-
stellung werden, die Paris, ja ganz Europa,
jemals gesehen hat, und eifrig arbeiten schon
heute alle Kommissionen an der Verwirk-
lichung ihrer umfassenden Pläne.
Mitten in der Stadt, auf einer Fläche von
100 Hektar längs den Ufern der Seine und
über das Marsfeld hin, von der Ecole Mili-
taire bis zum Trocadero wird sich diese Aus-
stellung ausbreiten. Die Vorarbeiten sind
schon weit gediehen. Mehrere Brücken wer-
den verbreitert, und ein großer Tunnel unter
der Seine soll die Zufahrt erleichtern. Man
rechnet mit vielen Millionen Besuchern, die
den Ruf der verlassenen Weltstadt wieder
heben sollen. Die amtliche Statistik zeigt in
den letzten Jahren einen katastrophalen
Rückgang des Fremdenverkehrs. Im Jahre
1929 zählte man in Paris nicht weniger als
1,9 Millionen ausländische Touristen. Im
Jahre 1934 dagegen hatte Paris nur noch
viertel, besonders der Champs-Elysees, in
billige Geschäftsstraßen.
Nun hoffen die Stadtväter von Paris, er-
mutigt durch die Erfolge der Brüsseler Welt-
ausstellung, mit Hilfe ihres großen Projekts,
einen wirksamen Aufschwung zu erzielen.
Die meisten europäischen Staaten haben ihre
Beteiligung zugesagt. Die „Kunst und Tech-
nik im modernen Leben“ soll in allen ihren
Erscheinungsformen und Auswirkungen ge-
zeigt werden. In 14 Gruppen wird ein Ueber-
blick gegeben werden über soziale und
hygienische Probleme, Berufsausbildung der
Künstler und Techniker, Photo, Radio und
Presse, Architektur und Siedlung, Bau-
technik, Innendekoration, graphisches und
plastisches Gewerbe, Textil, Transportwesen
und Touristik, Theater, Sport und Reklame.
Um ein schönes Gesamtbild der Weltaus-
stellung zu erzielen, hat man sich ent-
schlossen, das häßliche Trocadero niederzu-
reißen, das übrigens auch einer Weltausstel-
lung seine Existenz verdankt. An seine Stelle
kommt ein riesiger Museumsbau und ein
Eine neue Schadow-Büste der Berliner
Porzellan-Manu Faktur
Büste Christoph Friedrich Nicolai, Modell Johann Gottfried Schadow, 1811,
Höhe ca. 20,5 cm. Ausgeführt in weißem unglasiertem Porzellan von der Staat-
lichen Porzellan-Manufaktur,. Berlin (Photo Porz.-Manufaktur)
Am 8. Januar 1936 jährt sich zum 125. Male
der Todestag von Christoph Friedrich Nico-
lai, dem berühmtesten Berliner Buchhändler
seiner Zeit, vielfachen Schriftsteller und
Freunde Lessings. Geboren am 18. März 1733
in Berlin, erlernte Nicolai den Buchhandel
und übernahm 1758 dii-e Leitung des väter-
lichen Geschäftes, der Nicolai’schen Buch-
handlung, gegründet 1713.
Nicolai, eng befreundet mit Lessing und
Moses Mendelssohn, gründete mit diesen zu-
sammen die „Bibliothek der schönen Wissen-
schaften und freien Künste“, in denen alle
drei ihrer kritischen Be-
gabung freien Lauf las-
sen konnten, ebenso in
den „Briefe, die neueste
Literatur betreffend“ (24
Bände 1761—67). Das
eigentliche Lebenswerk
Friedrich Nicolais war
die „Allgemeine deut-
sche Bibliothek“, fortge-
führt als „Neue allge-
meine deutsche Biblio-
thek“, insgesamt 268
Bände, erschienen in
den Jahren 1765—1806;
ein Standardwerk, des-
sen Bedeutung für die
deutsche Bildungsge-
schichte nicht zu unter-
schätzen ist und selbst
von den zahlreichen
Gegnern Nicolais aner-
kannt wurde. Als Dich-
ter machte sich Nicolai
als Vorkämpferderdeut-
schen Aufklärung einen
Namen durch seine humo-
ristischen satirischen Ro-
mane, die auf gründ-
licher Kenntnis der gei-
stigen Zeitströmungen
beruhten. Sein kritischer
Sinn machte sich in An-
griffen gegen fast sämt-
liche Zeitgenossen zum
Teil unliebsam bemerk-
bar; er bekämpfte nicht
nur die Gefühlsschwär-
merei der Klopstock-
schen Schule, sondern
auch Herders Wieder-
erweckung des Volks-
liedes und Kants Kritik
der reinen Vernunft, ja
er wagte sich sogar
an Goethe, den er in seinen „Freuden des
jungen Werther“ zu verspotten suchte. Der
geistvolle Kopf dieses großen Spötters hat
verschiedenen Malern der Zeit als Vorbild
gedient, so Anton Graff und Chodowiecki.
Die Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin
hat eine Büste neu ausgeformt; das Modell
stammt von dem Berliner Bildhauer Job-
Gottfried Schadow, der im Todesjahre
Friedrich Nicolais (1811), diesen lebensvoll«11
Kopf geformt hat. Diese ausdrucksvolle
Büste aus weißem unglasiertem Porzellan i-’t
20,5 cm hoch.
Entwurf für das Museum der modernen Kunst anläßlich der Pariser Weltausstellung 1937
(Photo: Baranger)
779 000 fremde Besucher zu verzeichnen.
Dieser harte Schlag hat sich entsprechend in
der Handelsbilanz ausgewirkt. 1929 gaben
die Ausländer in Frankreich 12 Milliarden
Franken aus. Bis 1934 sind die Einnahmen
aus dem Fremdenverkehr auf 2 Milliarden
Franken gesunken. Nun hat natürlich die
Weltkrise in allen Ländern den Touristen-
verkehr sinken lassen. Aber während die
Gesamtumsätze im internationalen Reise-
verkehr nur auf ein Drittel gesunken sind,
gingen Frankreichs Einnahmen aus dem
Touristenverkehr seit 1929 auf ein Sechstel
zurück.
In einer Stadt, die wie Paris sehr stark auf
die Fremdemindustrie eingestellt ist. fällt
natürlich ein solcher Ausfall sehr ins Ge-
wicht. Charakteristisch für diesen Nieder-
gang ist die Wandlung der großen Luxus¬
unterirdisches Theater mit 3500 Plätzen und
der vollkommensten Bühnenanlage der Welt.
Zu diesem Zweck wurden bereits 120 000
Kubikmeter Felsen gesprengt und aus-
geschachtet.
Die Vorbereitungen zu dieser Ausstellung
bilden zugleich einen wirksamen Beitrag zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Schon sind
über 740 000 Tagwerke in Auftrag gegeben
und 160 000 für geistige Arbeiter vorgesehen.
Zur Vereinheitlichung des Gesamtbildes
werden alle - architektonischen Projekte von
einer Stelle aus bearbeitet. Eingebaut in den
prächtigen Rahmen des Stadtbildes wird so
düe Ausstellung einen grandiosen Anblick
bieten, zumal wenn am Abend Ströme von
Licht sich über die Fassaden längs des Flusses
ergießen und farbige Leuchtfontänen sich aus
den dunklen Fluten erheben. F. N.
Rückblick auf das Jahr 1935
schrittweise Auftauchen neuer Sammler-
kreise hindeutet. Diese zu pflegen, wird, wie
an dieser Stelle bereits mehrfach ausgeführt
wurde, eine der wesentlichsten Aufgaben der
Zukunft sein. Denn die wenigen Großkäufer
allein können eine so wichtige und umfang-
reiche Organisation, wie es der deutsche
Kunsthandel darstellt, nicht lebendig er-
(Fortsetzung von Seite 1)
halten. Die Kreise jedoch, die bis jetzt allein
dem Kauf auf der Auktion huldigen, werden
früher oder später reif sein, vom freien
Kunsthandel erschlossen zu werden.
Ein Rückblick über das Kunstjahr 1935 der übrigen
europäischen Länder werden wir in einer unserer näch-
sten Ausgaben veröffentlichen.
Ausstellungen
in Berlin:
In der Akademie der Künste am
Pariser Platz waren für einige Tage die Wett-
bewerbsarbeiten um den Großen Staatspreis
für Maler ausgestellt. In einer sehr über-
sichtlichen Zusammenstellung, aus der die
Arbeiten des Preisträgers Carl Schnei-
ders (s. „Weltkunst“ Nr. 51/52), von Rudolf
Riester, Arthur Meyer und Erich Nagel be-
sonders hervorragten. Die Künstlergruppe
„Der Norden" war mit Bildern von Weide-
mann. Schreiber und Philipp vertreten.
Neben bereits bekannten Talenten wie dem
Leipziger Karl Walther, zeigte sich auch eine
Reihe von jüngeren Begabungen, die in ihren
farbigen Ausdrucksäußenungen vorläufig
noch beachtenswerter erscheinen, als nach
der formalen Seite hin. Die Teilnehmer
stammen überwiegend aus dem deutschen
Westen. Aber auch einige Norddeutsche (der
Kieler Duggen und der Stettiner Erwin
Filter) waren dabei.
Die Galerie Nierendorf zeigt eine
größere Anzahl von Aquarellblättern, die der
jetzt 86-jährige Christian Rohlfs ge-
schaffen hat. Sie sind auf wenige Farben-
klänge reduziert und erweisen, daß der
Künstler in diesen Blu¬
menstücken und See¬
landschaften aus dem
Süden mit seinem flüs¬
sigen Material leiseste
und zarteste Wirkun¬
gen auf eine visionäre
Ebene hebt, für die das
Räumliche und der
äußere Eindruck des
Naturvorbildes kaum
noch vorhanden ist.
Eine Kollektion von
Bildern Ernst Wag¬
ners wurde durch
zwei Vorträge dieses
Dresdener Malers un¬
terstützt, welche dem
Geheimnis der Verwand¬
lung im schöpferischen
Werk nahezukommen
trachteten und einem
außergewöhnlich großen
Zuhörerkreis reiche An-
regungen boten.
Die Galerie G u r 1 i 11 stel Ite Arbeiten
von Käte Köster-Mahr aus. Land-
schaften aus Bosnien und Süddeutschland,
vor allem aber die Frauenbildnisse zeigen
ein schmissiges und kultiviertes Malwerk.
das dem flüchtigen Reiz der Erscheinungei
in einer farbig ungemein beweglichen Ar
nachgeht. Die Stralsunderin Edith Dett
mann hat ihr gegenüber die weniger leicht1,
Hand und hält ihre malerischen Mitte
stärker zusammen. Einige Stilleben uiD
Landschaften, besonders aber eine Vorstadt
straße am Abend, sind nicht nur schön1
Talentproben, sondern auch Bilder im be-
sonderen Sinne des Wortes. Der Münchene?
Hans Dochow ist in Darstellungen von’
Haff ein bemerkenswerter Zeichner. An-
den stimmungsreichen Blättern des Würt-
tembergers Josef Mahler ist Talent und
Temperament zu erkennen, sie stehen aber
doch noch zu sehr unter dem Zeichen von
Munch. Die Vielseitigkeit der Begabung von
Rudolf Strey würde tieferes Interesse
erregen, wenn die künstlerische Wegerich-
tung dieses jungen Ostpreußen deutlicher zu
erkennen wäre. Zk.
in Düsseldorf:
„Meisterwerke deutscher Fayencen“, besser
gesagt deutscher Fayencekunst oder -kiiltnr-
ein Thema, das von dem bekannten Buch
Paul Heilands angeregt sein mag, und das
immerhin zu strenger Auswahl höchster Qua-
lität verpflichtet, versucht augenblicklich
eine Ausstellung der Düsseldorfer Kunst-
sammlung der Oeffentlichkeit nahezubringen.
Dank dem Entgegenkommen von privater
Meindert Hobbema. Landschaft mit Wassermühle-
Ausstellung: D. Katz, Dieren (Photo: Katz)
DIE WELTKUNST
Jalirg. X, Nr. 1 vom 5. Januar 1936
schmiede zur Kontrolle ihrer gravierten und
ziselierten Werke angefertigt hatten. Dies
sind eigentlich schon Kupferstiche, lange vor
der ,,Erfindung“ des Kupferstichs.
In den Mappen der deutschen Graphik findet
man die seltensten Blätter von Schongauer,
(s. Abb. S. 1) dem Meister E. S., dem Hausbuch
meister, Dürer, Bekam, Aldegrever, aber
auch ganz frühe kolorierte Holzschnitte,
Spielkarten, Kalenderbilder und Einblatt-
drucke. Doch die vorläufige Ordnung dieser
Mappen ist nicht konsequent durchgeführt;
denn unter „Deutschland“ liegen noch viele
Blätter aus der Schule Mantegnas, der Hol-
länder und der Franzosen.
Besonders umfangreich ist die Sammlung
französischer Graphik, die von den frühesten
Holzschnitten bis ins 19. Jahrhundert fast das
ganze bekannte graphische Oeuvre umfaßt.
Hinzu kommen noch H a n d z e i c h n u n -
gen von Rembrandt (s. Abb. S. 1), Dürer, Van
Dyck, Skizzenblätter von Leonardo und Raf-
fael und zahllose Entwürfe für große Gemälde
von den Händen der bedeutendsten Künstler.
Ein Skizzenbiuch Pisanellos gehört zu den
kostbarsten Schätzen dieser Sammlung.
Die Annahme dieser kostbaren Sammlung
hat aber die Verwaltung der Nationalmuseen
in die größte Verlegenheit gebracht. Das
Testament stellt nämlich ganz bestimmte Be-
dingungen für die Art. in der diese 20 000
Blätter zur Schau gestellt werden sollen. Sie
sollen nicht nur in Mappen und Schubladen
aufbewahrt, sondern in umfangreichen wech-
selnden Ausstellungen mit wissenschaftlichen
Katalogen einem großen Publikum zugänglich
gemacht werden. Dazu bedarf es weitläufiger
Ausstellungsräume, die im Augenblick nicht
zur Verfügung stehen. Es ist in Aussicht
genommen, die Räume des Finanzministeri-
ums-, das in einem Flügel des Louvre unter-
gebracht ist, für Museumszwecke frei-
zumachen und dem Ministerium selbst ein
neues Gebäude zu errichten. Damit ist aber
die Entscheidung zugleich von zwei Ministe-
rien abhängig: vom Kunstministerium, das
neue Räume fordert und dem Finanzministe-
rium, dessen Zustimmung nötig ist. Wenn
aber zwei Ministerien in Frankreich in eine
gemeinsame Sache hineinzureden haben,
dann kompliziert sich die Angelegenheit ins
Unabsehbare. Inzwischen aber bleibt das
Vermächtnis des Barons Rothschild in seinem
Hause des Faubourg St. Honore allen Besu-
chern verschlossen. Und auf die Eröffnung
des neuen Graphikmuseums wird man ver-
mutlich noch lange Jahre warten müssen.
Dr. F. N.
Pariser W eltausstellung 1957
Kunst und Technik im modernen Leben
Zu unserem Bericht in Nr. 14/IX. bringen wir nach-
stehend eine weitere Uebersicht.
Paris rüstet für seine große Ausstel-
lung von 193". Es soll die schönste Aus-
stellung werden, die Paris, ja ganz Europa,
jemals gesehen hat, und eifrig arbeiten schon
heute alle Kommissionen an der Verwirk-
lichung ihrer umfassenden Pläne.
Mitten in der Stadt, auf einer Fläche von
100 Hektar längs den Ufern der Seine und
über das Marsfeld hin, von der Ecole Mili-
taire bis zum Trocadero wird sich diese Aus-
stellung ausbreiten. Die Vorarbeiten sind
schon weit gediehen. Mehrere Brücken wer-
den verbreitert, und ein großer Tunnel unter
der Seine soll die Zufahrt erleichtern. Man
rechnet mit vielen Millionen Besuchern, die
den Ruf der verlassenen Weltstadt wieder
heben sollen. Die amtliche Statistik zeigt in
den letzten Jahren einen katastrophalen
Rückgang des Fremdenverkehrs. Im Jahre
1929 zählte man in Paris nicht weniger als
1,9 Millionen ausländische Touristen. Im
Jahre 1934 dagegen hatte Paris nur noch
viertel, besonders der Champs-Elysees, in
billige Geschäftsstraßen.
Nun hoffen die Stadtväter von Paris, er-
mutigt durch die Erfolge der Brüsseler Welt-
ausstellung, mit Hilfe ihres großen Projekts,
einen wirksamen Aufschwung zu erzielen.
Die meisten europäischen Staaten haben ihre
Beteiligung zugesagt. Die „Kunst und Tech-
nik im modernen Leben“ soll in allen ihren
Erscheinungsformen und Auswirkungen ge-
zeigt werden. In 14 Gruppen wird ein Ueber-
blick gegeben werden über soziale und
hygienische Probleme, Berufsausbildung der
Künstler und Techniker, Photo, Radio und
Presse, Architektur und Siedlung, Bau-
technik, Innendekoration, graphisches und
plastisches Gewerbe, Textil, Transportwesen
und Touristik, Theater, Sport und Reklame.
Um ein schönes Gesamtbild der Weltaus-
stellung zu erzielen, hat man sich ent-
schlossen, das häßliche Trocadero niederzu-
reißen, das übrigens auch einer Weltausstel-
lung seine Existenz verdankt. An seine Stelle
kommt ein riesiger Museumsbau und ein
Eine neue Schadow-Büste der Berliner
Porzellan-Manu Faktur
Büste Christoph Friedrich Nicolai, Modell Johann Gottfried Schadow, 1811,
Höhe ca. 20,5 cm. Ausgeführt in weißem unglasiertem Porzellan von der Staat-
lichen Porzellan-Manufaktur,. Berlin (Photo Porz.-Manufaktur)
Am 8. Januar 1936 jährt sich zum 125. Male
der Todestag von Christoph Friedrich Nico-
lai, dem berühmtesten Berliner Buchhändler
seiner Zeit, vielfachen Schriftsteller und
Freunde Lessings. Geboren am 18. März 1733
in Berlin, erlernte Nicolai den Buchhandel
und übernahm 1758 dii-e Leitung des väter-
lichen Geschäftes, der Nicolai’schen Buch-
handlung, gegründet 1713.
Nicolai, eng befreundet mit Lessing und
Moses Mendelssohn, gründete mit diesen zu-
sammen die „Bibliothek der schönen Wissen-
schaften und freien Künste“, in denen alle
drei ihrer kritischen Be-
gabung freien Lauf las-
sen konnten, ebenso in
den „Briefe, die neueste
Literatur betreffend“ (24
Bände 1761—67). Das
eigentliche Lebenswerk
Friedrich Nicolais war
die „Allgemeine deut-
sche Bibliothek“, fortge-
führt als „Neue allge-
meine deutsche Biblio-
thek“, insgesamt 268
Bände, erschienen in
den Jahren 1765—1806;
ein Standardwerk, des-
sen Bedeutung für die
deutsche Bildungsge-
schichte nicht zu unter-
schätzen ist und selbst
von den zahlreichen
Gegnern Nicolais aner-
kannt wurde. Als Dich-
ter machte sich Nicolai
als Vorkämpferderdeut-
schen Aufklärung einen
Namen durch seine humo-
ristischen satirischen Ro-
mane, die auf gründ-
licher Kenntnis der gei-
stigen Zeitströmungen
beruhten. Sein kritischer
Sinn machte sich in An-
griffen gegen fast sämt-
liche Zeitgenossen zum
Teil unliebsam bemerk-
bar; er bekämpfte nicht
nur die Gefühlsschwär-
merei der Klopstock-
schen Schule, sondern
auch Herders Wieder-
erweckung des Volks-
liedes und Kants Kritik
der reinen Vernunft, ja
er wagte sich sogar
an Goethe, den er in seinen „Freuden des
jungen Werther“ zu verspotten suchte. Der
geistvolle Kopf dieses großen Spötters hat
verschiedenen Malern der Zeit als Vorbild
gedient, so Anton Graff und Chodowiecki.
Die Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin
hat eine Büste neu ausgeformt; das Modell
stammt von dem Berliner Bildhauer Job-
Gottfried Schadow, der im Todesjahre
Friedrich Nicolais (1811), diesen lebensvoll«11
Kopf geformt hat. Diese ausdrucksvolle
Büste aus weißem unglasiertem Porzellan i-’t
20,5 cm hoch.
Entwurf für das Museum der modernen Kunst anläßlich der Pariser Weltausstellung 1937
(Photo: Baranger)
779 000 fremde Besucher zu verzeichnen.
Dieser harte Schlag hat sich entsprechend in
der Handelsbilanz ausgewirkt. 1929 gaben
die Ausländer in Frankreich 12 Milliarden
Franken aus. Bis 1934 sind die Einnahmen
aus dem Fremdenverkehr auf 2 Milliarden
Franken gesunken. Nun hat natürlich die
Weltkrise in allen Ländern den Touristen-
verkehr sinken lassen. Aber während die
Gesamtumsätze im internationalen Reise-
verkehr nur auf ein Drittel gesunken sind,
gingen Frankreichs Einnahmen aus dem
Touristenverkehr seit 1929 auf ein Sechstel
zurück.
In einer Stadt, die wie Paris sehr stark auf
die Fremdemindustrie eingestellt ist. fällt
natürlich ein solcher Ausfall sehr ins Ge-
wicht. Charakteristisch für diesen Nieder-
gang ist die Wandlung der großen Luxus¬
unterirdisches Theater mit 3500 Plätzen und
der vollkommensten Bühnenanlage der Welt.
Zu diesem Zweck wurden bereits 120 000
Kubikmeter Felsen gesprengt und aus-
geschachtet.
Die Vorbereitungen zu dieser Ausstellung
bilden zugleich einen wirksamen Beitrag zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Schon sind
über 740 000 Tagwerke in Auftrag gegeben
und 160 000 für geistige Arbeiter vorgesehen.
Zur Vereinheitlichung des Gesamtbildes
werden alle - architektonischen Projekte von
einer Stelle aus bearbeitet. Eingebaut in den
prächtigen Rahmen des Stadtbildes wird so
düe Ausstellung einen grandiosen Anblick
bieten, zumal wenn am Abend Ströme von
Licht sich über die Fassaden längs des Flusses
ergießen und farbige Leuchtfontänen sich aus
den dunklen Fluten erheben. F. N.
Rückblick auf das Jahr 1935
schrittweise Auftauchen neuer Sammler-
kreise hindeutet. Diese zu pflegen, wird, wie
an dieser Stelle bereits mehrfach ausgeführt
wurde, eine der wesentlichsten Aufgaben der
Zukunft sein. Denn die wenigen Großkäufer
allein können eine so wichtige und umfang-
reiche Organisation, wie es der deutsche
Kunsthandel darstellt, nicht lebendig er-
(Fortsetzung von Seite 1)
halten. Die Kreise jedoch, die bis jetzt allein
dem Kauf auf der Auktion huldigen, werden
früher oder später reif sein, vom freien
Kunsthandel erschlossen zu werden.
Ein Rückblick über das Kunstjahr 1935 der übrigen
europäischen Länder werden wir in einer unserer näch-
sten Ausgaben veröffentlichen.
Ausstellungen
in Berlin:
In der Akademie der Künste am
Pariser Platz waren für einige Tage die Wett-
bewerbsarbeiten um den Großen Staatspreis
für Maler ausgestellt. In einer sehr über-
sichtlichen Zusammenstellung, aus der die
Arbeiten des Preisträgers Carl Schnei-
ders (s. „Weltkunst“ Nr. 51/52), von Rudolf
Riester, Arthur Meyer und Erich Nagel be-
sonders hervorragten. Die Künstlergruppe
„Der Norden" war mit Bildern von Weide-
mann. Schreiber und Philipp vertreten.
Neben bereits bekannten Talenten wie dem
Leipziger Karl Walther, zeigte sich auch eine
Reihe von jüngeren Begabungen, die in ihren
farbigen Ausdrucksäußenungen vorläufig
noch beachtenswerter erscheinen, als nach
der formalen Seite hin. Die Teilnehmer
stammen überwiegend aus dem deutschen
Westen. Aber auch einige Norddeutsche (der
Kieler Duggen und der Stettiner Erwin
Filter) waren dabei.
Die Galerie Nierendorf zeigt eine
größere Anzahl von Aquarellblättern, die der
jetzt 86-jährige Christian Rohlfs ge-
schaffen hat. Sie sind auf wenige Farben-
klänge reduziert und erweisen, daß der
Künstler in diesen Blu¬
menstücken und See¬
landschaften aus dem
Süden mit seinem flüs¬
sigen Material leiseste
und zarteste Wirkun¬
gen auf eine visionäre
Ebene hebt, für die das
Räumliche und der
äußere Eindruck des
Naturvorbildes kaum
noch vorhanden ist.
Eine Kollektion von
Bildern Ernst Wag¬
ners wurde durch
zwei Vorträge dieses
Dresdener Malers un¬
terstützt, welche dem
Geheimnis der Verwand¬
lung im schöpferischen
Werk nahezukommen
trachteten und einem
außergewöhnlich großen
Zuhörerkreis reiche An-
regungen boten.
Die Galerie G u r 1 i 11 stel Ite Arbeiten
von Käte Köster-Mahr aus. Land-
schaften aus Bosnien und Süddeutschland,
vor allem aber die Frauenbildnisse zeigen
ein schmissiges und kultiviertes Malwerk.
das dem flüchtigen Reiz der Erscheinungei
in einer farbig ungemein beweglichen Ar
nachgeht. Die Stralsunderin Edith Dett
mann hat ihr gegenüber die weniger leicht1,
Hand und hält ihre malerischen Mitte
stärker zusammen. Einige Stilleben uiD
Landschaften, besonders aber eine Vorstadt
straße am Abend, sind nicht nur schön1
Talentproben, sondern auch Bilder im be-
sonderen Sinne des Wortes. Der Münchene?
Hans Dochow ist in Darstellungen von’
Haff ein bemerkenswerter Zeichner. An-
den stimmungsreichen Blättern des Würt-
tembergers Josef Mahler ist Talent und
Temperament zu erkennen, sie stehen aber
doch noch zu sehr unter dem Zeichen von
Munch. Die Vielseitigkeit der Begabung von
Rudolf Strey würde tieferes Interesse
erregen, wenn die künstlerische Wegerich-
tung dieses jungen Ostpreußen deutlicher zu
erkennen wäre. Zk.
in Düsseldorf:
„Meisterwerke deutscher Fayencen“, besser
gesagt deutscher Fayencekunst oder -kiiltnr-
ein Thema, das von dem bekannten Buch
Paul Heilands angeregt sein mag, und das
immerhin zu strenger Auswahl höchster Qua-
lität verpflichtet, versucht augenblicklich
eine Ausstellung der Düsseldorfer Kunst-
sammlung der Oeffentlichkeit nahezubringen.
Dank dem Entgegenkommen von privater
Meindert Hobbema. Landschaft mit Wassermühle-
Ausstellung: D. Katz, Dieren (Photo: Katz)