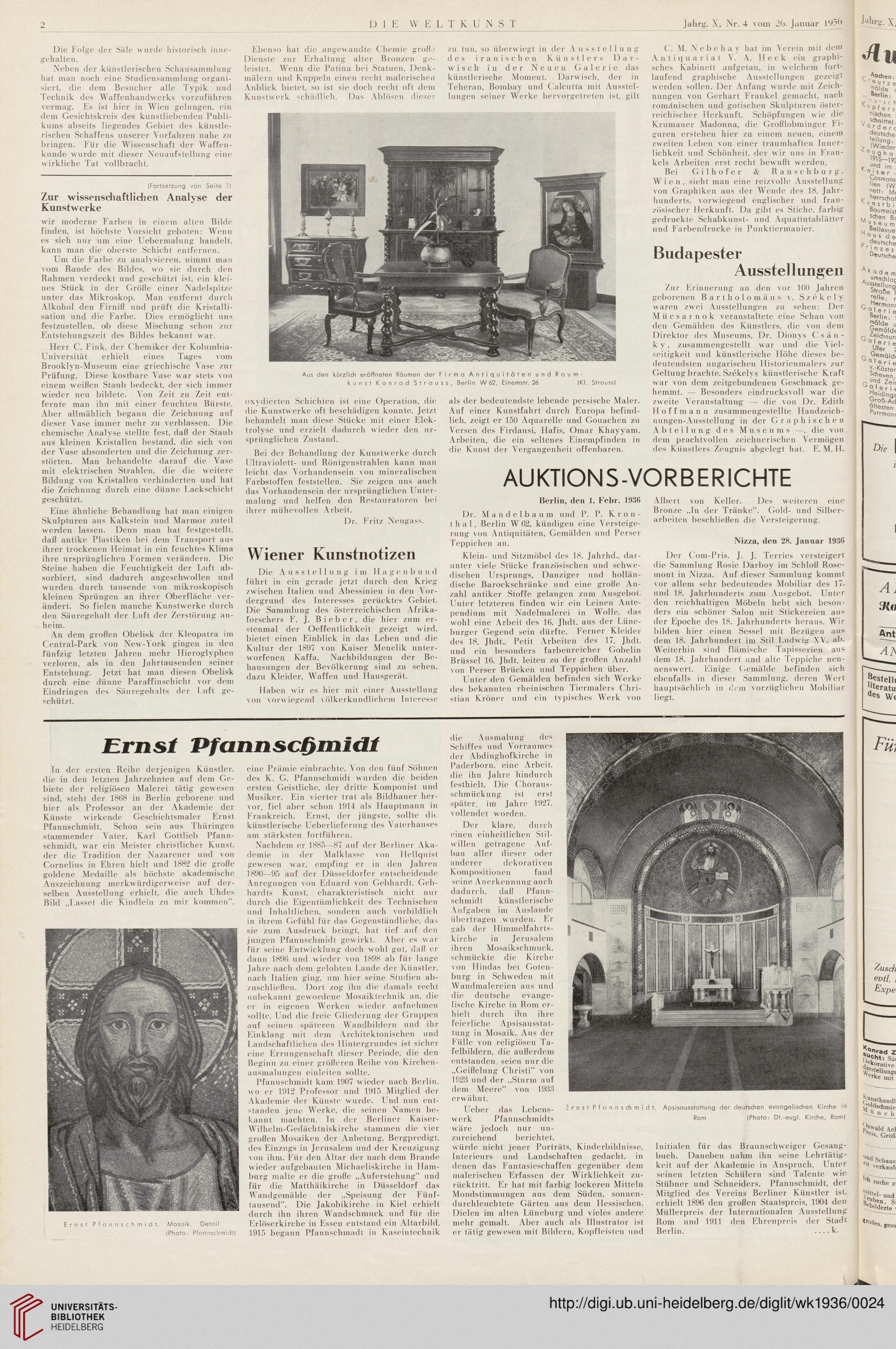o
DIE W E L T K U N S I
Jahrg. X, Nr. 4- vom 26. Januar 1956
Die Folge der Säle wurde historisch inne-
gehalten.
Neben der künstlerischen Schausammlung
hat man noch eine Studiensammlung organi-
siert, die dem Besucher alle Typik und
Technik des Waffenhandwerks vorzuführen
vermag. Es ist hier in Wien gelungen, ein
dem Gesichtskreis des kunstliebenden Publi-
kums abseits liegendes Gebiet des künstle-
rischen Schaffens unserer Vorfahren nahe zu
bringen. Für die Wissenschaft der Waffen-
kunde wurde mit dieser Neuaufstellung eine
wirkliche Tat vollbracht.
(Fortsetzung von Seite 1)
Zur wissenschaftlichen Analyse der
Kunstwerke
wir moderne Farben in einem alten Bilde
finden, ist höchste Vorsicht geboten: Wenn
es sich nur um eine Uebermalung handelt,
kann man die oberste Schicht entfernen.
Um die Farbe zu analysieren, nimmt man
vom Rande des Bildes, wo sie durch den
Rahmen verdeckt und geschützt ist, ein klei-
nes Stück in der Größe einer Nadelspitze
unter das Mikroskop. Man entfernt durch
Alkohol den Firniß und prüft die Kristalli-
sation und die Farbe. Dies ermöglicht uns
festzustellen, oib diese Mischung schon zur
Entstehungszeit des Bildes bekannt war.
Herr C. Fink, der Chemiker der Kolumbia-
Universität erhielt eines Tages vom
Brooklyn-Museum eine griechische Vase zur
Prüfung. Diese kostbare Vase war stets von
einem weißen Staub bedeckt, der sich immer
wieder neu bildete. Von Zeit zu Zeit ent-
fernte man ihn mit einer feuchten Bürste.
Aber allmählich begann die Zeichnung auf
dieser Vase immer mehr zu verblassen. Die
chemische Analyse stellte fest, daß der Staub
aus kleinen Kristallen bestand, die sich von
der Vase absonderten und die Zeichnung zer-
störten. Man behandelte darauf die Vase
mit elektrischen Strahlen, die die weitere
Bildung von Kristallen verhinderten und hat
die Zeichnung durch eine dünne Lackschicht
geschützt.
Eine ähnliche Behandlung hat man einigen
Skulpturen aus Kalkstein und Marmor zuteil
werden lassen. Denn man hat festgestellt,
daß antike Plastiken bei dem Transport aus
ihrer trockenen Heimat in ein feuchtes Klima
ihre ursprünglichen Formen verändern. Die
Steine haben die Feuchtigkeit der Luft ab-
sorbiert, sind dadurch angeschwollen und
wurden durch tausende von mikroskopisch
kleinen Sprüngen an ihrer Oberfläche ver-
ändert. So fielen manche Kunstwerke durch
den Säuregehalt der Luft der Zerstörung an-
heim.
An dem großen Obelisk der Kleopatra im
Central-Park von New-York gingen in den
fünfzig letzten Jahren mehr Hieroglyphen
verloren, als in den Jahrtausenden seiner
Entstehung. Jetzt hat man diesen Obelisk
durch eine dünne Paraffinschicht vor dem
Eindringen des Säuregehalts der Luft ge-
schützt.
Ebenso hat die angewandte Chemie große
Dienste zur Erhaltung alter Bronzen ge-
leistet. Wenn die Patina bei Statuen, Denk-
mälern und Kuppeln einen recht malerischen
Anblick bietet, so ist sie doch recht oft dem
Kunstwerk schädlich. Das Ablösen dieser
zu tun, so über wiegt in der Ausstellung
des iranischen Künstlers Dar-
wisch in der Neuen Galerie das
künstlerische Moment. ■ Darwisch, der in
Teheran, Bombay und Calcutta mit Ausstel-
lungen seiner Werke hervorgetreten ist, gilt
C. M. N e b e h a y hat im Verein mit dem
Antiquariat V. A. Heck ein graphi-
sches Kabinett aufgetan, in welchem fort-
laufend graphische Ausstellungen gezeigt
werden sollen. Der Anfang wurde mit Zeich-
nungen von Gerhart Frankel gemacht, nach
romanischen und gotischen Skulpturen öster-
reichischer Herkunft. Schöpfungen wie die
Krumauer Madonna, die Großlobminger Fi-
guren erstehen hier zu einem neuen, einem
zweiten Leben von einer traumhaften Inner-
lichkeit und Schönheit, der wir uns in Fran-
kels Arbeiten erst recht bewußt werden.
Bei Gilhofer & Ranschburg,
Wien, sieht man eine reizvolle Ausstellung
von Graphiken aus der Wende des 18. Jahr-
hunderts, vorwiegend englischer und fran-
zösischer Herkunft. Da gibt es Stiche, farbig'
gedruckte Schabkunst- und Aquatintablätter
und Farbendrucke in Punktiermanier.
Budapester
Ausstellungen
AUKTIONS-VORBERICHTE
Wiener Kunstnotizen
aus
aus
sich
als der bedeutendste lebende persische Maler.
Auf einer Kunstfahrt durch Europa befind-
lich, zeigt er 150 Aquarelle und Gouachen zu
Versen des Firdausi, Hafis, Omar Khayyam.
Arbeiten, die ein seltenes Einempfinden in
die Kunst der Vergangenheit offenbaren.
kommt
des 17.
Unter
beson-
Aus den kürzlich eröffneten Räumen der Firma Antiquitäten und Raum¬
kunst Konrad Strauss, Berlin W 62, Einemstr. 26 (Kl. Strauss)
Die Ausstellung im Hagenbund
führt in ein gerade jetzt durch den Krieg
zwischen Italien und Abessinien in den Vor-
dergrund des Interesses gerücktes Gebiet.
Die Sammlung des österreichischen Afrika-
forschers F. J. Bieber, die hier zum er-
stenmal der Oeffentlichkeit gezeigt wird,
bietet einen Einblick in das Leben und die
Kultur der 1897 von Kaiser Menelik unter-
worfenen Kaffa. Nachbildungen der Be-
hausungen der Bevölkerung sind zu sehen,
dazu Kleider, Waffen und Hausgerät.
Haben wir es hier mit einer Ausstellung
von vorwiegend völkerkundlichem Interesse
oxydierten Schichten ist eine Operation, die
die Kunstwerke oft beschädigen konnte. Jetzt
behandelt man diese Stücke mit einer Elek-
trolyse und erzielt dadurch wieder den ur-
sprünglichen Zustand.
Bei der Behandlung der Kunstwerke durch
Ultraviolett- und Röntgenstrahlen kann man
leicht das 1 orhandensein von mineralischen
Farbstoffen feststellen. Sie zeigen uns auch
das Vorhandensein der ursprünglichen Unter-
malung und helfen den Restauratoren bei
ihrer mühevollen Arbeit.
Dr. Fritz Neugass.
Berlin, den 1. Fehr. 1936
Dr. MandeLbaum und P. P. Kron-
thal, Berlin W 62, kündigen eine Versteige-
rung von Antiquitäten, Gemälden und Perser
Teppichen an.
Klein- und Sitzmöbel des 18. Jahrlid., dar-
unter viele Stücke französischen und schwe-
dischen Ursprungs, Danziger und hollän-
dische Barockschränke und eine große An-
zahl antiker Stoffe gelangen zum Ausgebot.
Unter letzteren finden wir ein Leinen Ante-
pendium mit Nadelmalerei in Wolle, das
wohl eine Arbeit des 16. Jhdt. aus der Lüne-
burger Gegend sein dürfte. Ferner Kleider
des 18. Jhdt., Petit Arbeiten des 17. Jhdt.
und ein besonders farbenreicher Gobelin
Brüssel 16. Jhdt. leiten zu der großen Anzahl
von Perser Brücken und Teppichen über.
Unter den Gemälden befinden sich Werke
des bekannten rheinischen Tiermalers Chri-
stian Kröner und ein typisches Werk von
Nizza, den 28. Januar 1936
Der Com-Pris. J. J. Terries versteigert
die Sammlung Rosie Darboy im Schloß Rosc-
mont in Nizza. Auf dieser Sammlung
vor allem sehr bedeutendes Mobiliar
und 18. Jahrhunderts zum Ausgebot,
den reichhaltigen Möbeln hebt sich
ders ein schöner Salon mit Stickereien aus
der Epoche des 18. Jahrhunderts heraus. Wir
bilden hier einen Sessel mit Bezügen
dem 18. Jahrhundert im Stil Ludwig XV. ab.
Weiterhin sind flämische Tapisserien
dem 18. Jahrhundert und alte Teppiche nen-
nenswert. Einige Gemälde befinden
ebenfalls in dieser Sammlung, deren Wert
hauptsächlich in dem vorzüglichen Mobiliar
liegt.
Zur Erinnerung an den
geborenen B a r t h o 1 o m ä u
waren zwei Ausstellungen ;
Mücsarnok veranstaltete
den Gemälden des Künstler!
Direktor des Museums, Dr. Dionys C s ä n -
k y, zusammengestellt war und die Viel-
seitigkeit und künstlerische Höhe dieses be-
deutendsten ungarischen Historienmalers zur
Geltung brachte. Szekelys künstlerische Kraft
war von dem zeitgebundenen Geschmack ge-
hemmt. — Besonders eindrucksvoll war die
zweite Veranstaltung — die von Dr. Edith
Hoffmann zusammengestellte Handzeich-
nungen-Ausstellung in der Graphischen
Abteilung des Museums —, die von
dem prachtvollen zeichnerischen Vermögen
des Künstlers Zeugnis abgelegt hat. E. M. II-
vor 100 Jahren
s v. Szek
e 1 y
zu sehen:
Der
eine Schau
von
•s, die von
dem
Ernst Pfannscfymidt
In der ersten Reihe derjenigen Künstler,
die in den letzten Jahrzehnten auf dem Ge-
biete der religiösen Malerei tätig gewesen
sind, steht der 1868 in Berlin geborene und
hier als Professor an der Akademie der
Künste wirkende Geschichtsmaler Ernst
Pfannschmidt. Schon sein aus Thüringen
stammender Vater, Karl Gottlieb Pfann-
schmidt, war ein Meister christlicher Kunst,
der die Tradition der Nazarener und von
Cornelius in Ehren hielt und 1882 die große
goldene Medaille als höchste akademische
Auszeichnung merkwürdigerweise auf der-
selben Ausstellung erhielt, die auch Uhdes
Bild ..Lasset die Kindlein zu mir kommen“,
Ernst Pfannschmidt. Mosaik. Detail
(Photo; Pfannschmidt)
eine Prämie einbrachte. Von den fünf Söhnen
des K. G. Pfannschmidt wurden die beiden
ersten Geistliche, der dritte Komponist und
Musiker. Ein vierter trat als Bildhauer her-
vor, fiel aber schon 1914 als Hauptmann in
Frankreich. Ernst, der jüngste, sollte die
künstlerische Ueberlieferung des Vaterhauses
am stärksten fortführen.
Nachdem er 1885—87 auf der Berliner Aka-
demie in der Malklasse von Hellquist
gewesen war,, empfing er in den Jahren
1890—95 auf der Düsseldorfer entscheidende
Anregungen von Eduard von Gebhardt. Geb-
hardts Kunst, charakteristisch nicht nur
durch die Eigentümlichkeit des Technischen
und Inhaltlichen, sondern auch vorbildlich
in ihrem Gefühl für das Gegenständliche, das
sie zum Ausdruck bringt, hat tief auf den
jungen Pfannschmidt gewirkt. Aber es war
für seine Entwicklung doch wohl gut, daß er
dann 1896 und wieder von 1898 ab für lange
Jahre nach dem gelobten Lande der Künstler,
nach Italien ging, um hier seine Studien ab-
zuschließen. Dort zog ihn die damals recht
unbekannt gewordene Mosaiktechnik an, die
er in eigenen Werken wieder aufnehmen
sollte. Und die freie Gliederung der Gruppen
auf seinen späteren Wandbildern und ihr
Einklang mit dem Architektonischen und
Landschaftlichen des Hintergrundes ist sicher
eine Errungenschaft dieser Periode, die den
Beginn zu einer größeren Reihe von Kirchen-
ausmalungen einleiten sollte.
Pfannschmidt kam 1907 wieder nach Berlin,
wo er 1912 Professor und 1915 Mitglied der
Akademie der Künste wurde. Und nun ent-
standen jene Werke, die seinen Namen be-
kannt machten. Tn der Berliner Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche stammen die vier
großen Mosaiken der Anbetung, Bergpredigt,
des Einzugs in Jerusalem und der Kreuzigung
von ihm. Für den Altar der nach dem Brande
wieder aufgebauten Michaeliskirche in Ham-
burg malte er die große „Auferstehung“ und
für die Matthäikirche in Düsseldorf das
Wandgemälde der „Speisung der Fünf-
tausend“. Die Jakobikirche in Kiel erhielt
durch ihn ihren Wandschmuck und für die
Erlöserkirche in Essen entstand ein Altarbild.
1915 begann Pfannschmadt in Kaseintechnik
die Ausmalung des
Schiffes und Vorraumes
der Abdinghofkirche in
Paderborn, eine Arbeit,
die ihn Jahre hindurch
festhielt. Die Choraus-
schmückung ist erst
später, im Jahre 1927,
vollendet worden.
Der klare, durch
einen einheitlichen Stil-
willen getragene Auf-
bau aller dieser oder
anderer dekorativen
Kompositionen fand
seine Anerkennung auch
dadurch, daß Pfann-
schmidt künstlerische
Aufgaben im Auslande
übertragen wurden. Er
gab der Himmelfahrts-
kirche in Jerusalem
ihren Mosaikschmuck,
schmückte die Kirche
von Hindus bei Goten-
burg in Schweden mit
Wandmalereien aus und
die deutsche evange-
lische Kirche in Rom er-
hielt durch ihn ihre
feierliche Apsisausstat-
tung in Mosaik. Aus der
Fülle von religiösen Ta-
felbildern, die außerdem
entstanden, seien nur die
„Geißelung Christi“ von
1923 und der „Sturm auf
dem Meere“ von 1933
erwähnt.
... 2 — .
B ÄS
a/•<' ja •?>'
K Ai
. .$■ .zZ.
Ueber das Lebens-
werk Pfannschmidts
wäre jedoch nur un-
zureichend berichtet,
Ernst Pfannschmidt. Apsisausstattung der deutschen evangelischen Kirche in
Rom (Photo: Dt.-evgl. Kirche, Rom)
würde nicht jener Porträts, Kinderbildnisse,
Interieurs und Landschaften gedacht, in
denen das Fantasieschaffen gegenüber dem
malerischen Erfassen der Wirklichkeit zu-
rücktritt. Er hat mit farbig lockeren Mitteln
Mondstimmungen aus dem Süden, sonnen-
durchleuchtete Gärten aus dem Hessischen,
Dielen im alten Lüneburg und vieles andere
mehr gemalt. Aber auch als Illustrator ist
er tätig gewesen mit Bildern, Kopfleisten und
Initialen für das Braunschweiger Gesang-
buch. Daneben nahm ihn seine Lehrtätig-
keit auf der Akademie in Anspruch. Unter
seinen letzten Schülern sind Talente wie
Stübner und Schneiders. Pfannschmidt, der
Mitglied des Vereins Berliner Künstler ist,
erhielt 1896 den großen Staatspreis, 1904 den
Müllerpreis der Internationalen Ausstellung
Rom und 1911 den Ehrenpreis der Stadt
Berlin. .... k.
r fachen:
r s? * z e
Jo'de <
. Berlin:
le " u ' s c b
KuPfers
nischen
v schnitte).
V 0J d e r c
deutsche
’eilung:
7 (Wieder
“lo,9 h a
1915—19;
K u.nd im
K °2 ’ e r -
\.osmate
hen (W
Jett: M<
V herrschal
K u n s t b i
“aumeist
M Schen B<
V.eum
li Bellevue
s d e
p deutsche
rAnzes
Deutsche
Akade m
A umschlac
Stte'kUn9
Straße 1
Hlle; r
o1 e r i e
Berlin. I
njälde u
yemälds
G^nun
Ufer’1
^Ge^ld.
Röster
Scheven,
G7.lt:
peidings
v’roß-Ad
^testen
’vrrmam
l
Zusch
evtl. j
Expe
<tar ?r,a‘ive
IV^tdlung,
epke mit
1 !' n C 11
p.^ald Acl
te,s. Groß
Schaus
U verkauf,
1(11 su<ie z:
^h’Hes, gesu
DIE W E L T K U N S I
Jahrg. X, Nr. 4- vom 26. Januar 1956
Die Folge der Säle wurde historisch inne-
gehalten.
Neben der künstlerischen Schausammlung
hat man noch eine Studiensammlung organi-
siert, die dem Besucher alle Typik und
Technik des Waffenhandwerks vorzuführen
vermag. Es ist hier in Wien gelungen, ein
dem Gesichtskreis des kunstliebenden Publi-
kums abseits liegendes Gebiet des künstle-
rischen Schaffens unserer Vorfahren nahe zu
bringen. Für die Wissenschaft der Waffen-
kunde wurde mit dieser Neuaufstellung eine
wirkliche Tat vollbracht.
(Fortsetzung von Seite 1)
Zur wissenschaftlichen Analyse der
Kunstwerke
wir moderne Farben in einem alten Bilde
finden, ist höchste Vorsicht geboten: Wenn
es sich nur um eine Uebermalung handelt,
kann man die oberste Schicht entfernen.
Um die Farbe zu analysieren, nimmt man
vom Rande des Bildes, wo sie durch den
Rahmen verdeckt und geschützt ist, ein klei-
nes Stück in der Größe einer Nadelspitze
unter das Mikroskop. Man entfernt durch
Alkohol den Firniß und prüft die Kristalli-
sation und die Farbe. Dies ermöglicht uns
festzustellen, oib diese Mischung schon zur
Entstehungszeit des Bildes bekannt war.
Herr C. Fink, der Chemiker der Kolumbia-
Universität erhielt eines Tages vom
Brooklyn-Museum eine griechische Vase zur
Prüfung. Diese kostbare Vase war stets von
einem weißen Staub bedeckt, der sich immer
wieder neu bildete. Von Zeit zu Zeit ent-
fernte man ihn mit einer feuchten Bürste.
Aber allmählich begann die Zeichnung auf
dieser Vase immer mehr zu verblassen. Die
chemische Analyse stellte fest, daß der Staub
aus kleinen Kristallen bestand, die sich von
der Vase absonderten und die Zeichnung zer-
störten. Man behandelte darauf die Vase
mit elektrischen Strahlen, die die weitere
Bildung von Kristallen verhinderten und hat
die Zeichnung durch eine dünne Lackschicht
geschützt.
Eine ähnliche Behandlung hat man einigen
Skulpturen aus Kalkstein und Marmor zuteil
werden lassen. Denn man hat festgestellt,
daß antike Plastiken bei dem Transport aus
ihrer trockenen Heimat in ein feuchtes Klima
ihre ursprünglichen Formen verändern. Die
Steine haben die Feuchtigkeit der Luft ab-
sorbiert, sind dadurch angeschwollen und
wurden durch tausende von mikroskopisch
kleinen Sprüngen an ihrer Oberfläche ver-
ändert. So fielen manche Kunstwerke durch
den Säuregehalt der Luft der Zerstörung an-
heim.
An dem großen Obelisk der Kleopatra im
Central-Park von New-York gingen in den
fünfzig letzten Jahren mehr Hieroglyphen
verloren, als in den Jahrtausenden seiner
Entstehung. Jetzt hat man diesen Obelisk
durch eine dünne Paraffinschicht vor dem
Eindringen des Säuregehalts der Luft ge-
schützt.
Ebenso hat die angewandte Chemie große
Dienste zur Erhaltung alter Bronzen ge-
leistet. Wenn die Patina bei Statuen, Denk-
mälern und Kuppeln einen recht malerischen
Anblick bietet, so ist sie doch recht oft dem
Kunstwerk schädlich. Das Ablösen dieser
zu tun, so über wiegt in der Ausstellung
des iranischen Künstlers Dar-
wisch in der Neuen Galerie das
künstlerische Moment. ■ Darwisch, der in
Teheran, Bombay und Calcutta mit Ausstel-
lungen seiner Werke hervorgetreten ist, gilt
C. M. N e b e h a y hat im Verein mit dem
Antiquariat V. A. Heck ein graphi-
sches Kabinett aufgetan, in welchem fort-
laufend graphische Ausstellungen gezeigt
werden sollen. Der Anfang wurde mit Zeich-
nungen von Gerhart Frankel gemacht, nach
romanischen und gotischen Skulpturen öster-
reichischer Herkunft. Schöpfungen wie die
Krumauer Madonna, die Großlobminger Fi-
guren erstehen hier zu einem neuen, einem
zweiten Leben von einer traumhaften Inner-
lichkeit und Schönheit, der wir uns in Fran-
kels Arbeiten erst recht bewußt werden.
Bei Gilhofer & Ranschburg,
Wien, sieht man eine reizvolle Ausstellung
von Graphiken aus der Wende des 18. Jahr-
hunderts, vorwiegend englischer und fran-
zösischer Herkunft. Da gibt es Stiche, farbig'
gedruckte Schabkunst- und Aquatintablätter
und Farbendrucke in Punktiermanier.
Budapester
Ausstellungen
AUKTIONS-VORBERICHTE
Wiener Kunstnotizen
aus
aus
sich
als der bedeutendste lebende persische Maler.
Auf einer Kunstfahrt durch Europa befind-
lich, zeigt er 150 Aquarelle und Gouachen zu
Versen des Firdausi, Hafis, Omar Khayyam.
Arbeiten, die ein seltenes Einempfinden in
die Kunst der Vergangenheit offenbaren.
kommt
des 17.
Unter
beson-
Aus den kürzlich eröffneten Räumen der Firma Antiquitäten und Raum¬
kunst Konrad Strauss, Berlin W 62, Einemstr. 26 (Kl. Strauss)
Die Ausstellung im Hagenbund
führt in ein gerade jetzt durch den Krieg
zwischen Italien und Abessinien in den Vor-
dergrund des Interesses gerücktes Gebiet.
Die Sammlung des österreichischen Afrika-
forschers F. J. Bieber, die hier zum er-
stenmal der Oeffentlichkeit gezeigt wird,
bietet einen Einblick in das Leben und die
Kultur der 1897 von Kaiser Menelik unter-
worfenen Kaffa. Nachbildungen der Be-
hausungen der Bevölkerung sind zu sehen,
dazu Kleider, Waffen und Hausgerät.
Haben wir es hier mit einer Ausstellung
von vorwiegend völkerkundlichem Interesse
oxydierten Schichten ist eine Operation, die
die Kunstwerke oft beschädigen konnte. Jetzt
behandelt man diese Stücke mit einer Elek-
trolyse und erzielt dadurch wieder den ur-
sprünglichen Zustand.
Bei der Behandlung der Kunstwerke durch
Ultraviolett- und Röntgenstrahlen kann man
leicht das 1 orhandensein von mineralischen
Farbstoffen feststellen. Sie zeigen uns auch
das Vorhandensein der ursprünglichen Unter-
malung und helfen den Restauratoren bei
ihrer mühevollen Arbeit.
Dr. Fritz Neugass.
Berlin, den 1. Fehr. 1936
Dr. MandeLbaum und P. P. Kron-
thal, Berlin W 62, kündigen eine Versteige-
rung von Antiquitäten, Gemälden und Perser
Teppichen an.
Klein- und Sitzmöbel des 18. Jahrlid., dar-
unter viele Stücke französischen und schwe-
dischen Ursprungs, Danziger und hollän-
dische Barockschränke und eine große An-
zahl antiker Stoffe gelangen zum Ausgebot.
Unter letzteren finden wir ein Leinen Ante-
pendium mit Nadelmalerei in Wolle, das
wohl eine Arbeit des 16. Jhdt. aus der Lüne-
burger Gegend sein dürfte. Ferner Kleider
des 18. Jhdt., Petit Arbeiten des 17. Jhdt.
und ein besonders farbenreicher Gobelin
Brüssel 16. Jhdt. leiten zu der großen Anzahl
von Perser Brücken und Teppichen über.
Unter den Gemälden befinden sich Werke
des bekannten rheinischen Tiermalers Chri-
stian Kröner und ein typisches Werk von
Nizza, den 28. Januar 1936
Der Com-Pris. J. J. Terries versteigert
die Sammlung Rosie Darboy im Schloß Rosc-
mont in Nizza. Auf dieser Sammlung
vor allem sehr bedeutendes Mobiliar
und 18. Jahrhunderts zum Ausgebot,
den reichhaltigen Möbeln hebt sich
ders ein schöner Salon mit Stickereien aus
der Epoche des 18. Jahrhunderts heraus. Wir
bilden hier einen Sessel mit Bezügen
dem 18. Jahrhundert im Stil Ludwig XV. ab.
Weiterhin sind flämische Tapisserien
dem 18. Jahrhundert und alte Teppiche nen-
nenswert. Einige Gemälde befinden
ebenfalls in dieser Sammlung, deren Wert
hauptsächlich in dem vorzüglichen Mobiliar
liegt.
Zur Erinnerung an den
geborenen B a r t h o 1 o m ä u
waren zwei Ausstellungen ;
Mücsarnok veranstaltete
den Gemälden des Künstler!
Direktor des Museums, Dr. Dionys C s ä n -
k y, zusammengestellt war und die Viel-
seitigkeit und künstlerische Höhe dieses be-
deutendsten ungarischen Historienmalers zur
Geltung brachte. Szekelys künstlerische Kraft
war von dem zeitgebundenen Geschmack ge-
hemmt. — Besonders eindrucksvoll war die
zweite Veranstaltung — die von Dr. Edith
Hoffmann zusammengestellte Handzeich-
nungen-Ausstellung in der Graphischen
Abteilung des Museums —, die von
dem prachtvollen zeichnerischen Vermögen
des Künstlers Zeugnis abgelegt hat. E. M. II-
vor 100 Jahren
s v. Szek
e 1 y
zu sehen:
Der
eine Schau
von
•s, die von
dem
Ernst Pfannscfymidt
In der ersten Reihe derjenigen Künstler,
die in den letzten Jahrzehnten auf dem Ge-
biete der religiösen Malerei tätig gewesen
sind, steht der 1868 in Berlin geborene und
hier als Professor an der Akademie der
Künste wirkende Geschichtsmaler Ernst
Pfannschmidt. Schon sein aus Thüringen
stammender Vater, Karl Gottlieb Pfann-
schmidt, war ein Meister christlicher Kunst,
der die Tradition der Nazarener und von
Cornelius in Ehren hielt und 1882 die große
goldene Medaille als höchste akademische
Auszeichnung merkwürdigerweise auf der-
selben Ausstellung erhielt, die auch Uhdes
Bild ..Lasset die Kindlein zu mir kommen“,
Ernst Pfannschmidt. Mosaik. Detail
(Photo; Pfannschmidt)
eine Prämie einbrachte. Von den fünf Söhnen
des K. G. Pfannschmidt wurden die beiden
ersten Geistliche, der dritte Komponist und
Musiker. Ein vierter trat als Bildhauer her-
vor, fiel aber schon 1914 als Hauptmann in
Frankreich. Ernst, der jüngste, sollte die
künstlerische Ueberlieferung des Vaterhauses
am stärksten fortführen.
Nachdem er 1885—87 auf der Berliner Aka-
demie in der Malklasse von Hellquist
gewesen war,, empfing er in den Jahren
1890—95 auf der Düsseldorfer entscheidende
Anregungen von Eduard von Gebhardt. Geb-
hardts Kunst, charakteristisch nicht nur
durch die Eigentümlichkeit des Technischen
und Inhaltlichen, sondern auch vorbildlich
in ihrem Gefühl für das Gegenständliche, das
sie zum Ausdruck bringt, hat tief auf den
jungen Pfannschmidt gewirkt. Aber es war
für seine Entwicklung doch wohl gut, daß er
dann 1896 und wieder von 1898 ab für lange
Jahre nach dem gelobten Lande der Künstler,
nach Italien ging, um hier seine Studien ab-
zuschließen. Dort zog ihn die damals recht
unbekannt gewordene Mosaiktechnik an, die
er in eigenen Werken wieder aufnehmen
sollte. Und die freie Gliederung der Gruppen
auf seinen späteren Wandbildern und ihr
Einklang mit dem Architektonischen und
Landschaftlichen des Hintergrundes ist sicher
eine Errungenschaft dieser Periode, die den
Beginn zu einer größeren Reihe von Kirchen-
ausmalungen einleiten sollte.
Pfannschmidt kam 1907 wieder nach Berlin,
wo er 1912 Professor und 1915 Mitglied der
Akademie der Künste wurde. Und nun ent-
standen jene Werke, die seinen Namen be-
kannt machten. Tn der Berliner Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche stammen die vier
großen Mosaiken der Anbetung, Bergpredigt,
des Einzugs in Jerusalem und der Kreuzigung
von ihm. Für den Altar der nach dem Brande
wieder aufgebauten Michaeliskirche in Ham-
burg malte er die große „Auferstehung“ und
für die Matthäikirche in Düsseldorf das
Wandgemälde der „Speisung der Fünf-
tausend“. Die Jakobikirche in Kiel erhielt
durch ihn ihren Wandschmuck und für die
Erlöserkirche in Essen entstand ein Altarbild.
1915 begann Pfannschmadt in Kaseintechnik
die Ausmalung des
Schiffes und Vorraumes
der Abdinghofkirche in
Paderborn, eine Arbeit,
die ihn Jahre hindurch
festhielt. Die Choraus-
schmückung ist erst
später, im Jahre 1927,
vollendet worden.
Der klare, durch
einen einheitlichen Stil-
willen getragene Auf-
bau aller dieser oder
anderer dekorativen
Kompositionen fand
seine Anerkennung auch
dadurch, daß Pfann-
schmidt künstlerische
Aufgaben im Auslande
übertragen wurden. Er
gab der Himmelfahrts-
kirche in Jerusalem
ihren Mosaikschmuck,
schmückte die Kirche
von Hindus bei Goten-
burg in Schweden mit
Wandmalereien aus und
die deutsche evange-
lische Kirche in Rom er-
hielt durch ihn ihre
feierliche Apsisausstat-
tung in Mosaik. Aus der
Fülle von religiösen Ta-
felbildern, die außerdem
entstanden, seien nur die
„Geißelung Christi“ von
1923 und der „Sturm auf
dem Meere“ von 1933
erwähnt.
... 2 — .
B ÄS
a/•<' ja •?>'
K Ai
. .$■ .zZ.
Ueber das Lebens-
werk Pfannschmidts
wäre jedoch nur un-
zureichend berichtet,
Ernst Pfannschmidt. Apsisausstattung der deutschen evangelischen Kirche in
Rom (Photo: Dt.-evgl. Kirche, Rom)
würde nicht jener Porträts, Kinderbildnisse,
Interieurs und Landschaften gedacht, in
denen das Fantasieschaffen gegenüber dem
malerischen Erfassen der Wirklichkeit zu-
rücktritt. Er hat mit farbig lockeren Mitteln
Mondstimmungen aus dem Süden, sonnen-
durchleuchtete Gärten aus dem Hessischen,
Dielen im alten Lüneburg und vieles andere
mehr gemalt. Aber auch als Illustrator ist
er tätig gewesen mit Bildern, Kopfleisten und
Initialen für das Braunschweiger Gesang-
buch. Daneben nahm ihn seine Lehrtätig-
keit auf der Akademie in Anspruch. Unter
seinen letzten Schülern sind Talente wie
Stübner und Schneiders. Pfannschmidt, der
Mitglied des Vereins Berliner Künstler ist,
erhielt 1896 den großen Staatspreis, 1904 den
Müllerpreis der Internationalen Ausstellung
Rom und 1911 den Ehrenpreis der Stadt
Berlin. .... k.
r fachen:
r s? * z e
Jo'de <
. Berlin:
le " u ' s c b
KuPfers
nischen
v schnitte).
V 0J d e r c
deutsche
’eilung:
7 (Wieder
“lo,9 h a
1915—19;
K u.nd im
K °2 ’ e r -
\.osmate
hen (W
Jett: M<
V herrschal
K u n s t b i
“aumeist
M Schen B<
V.eum
li Bellevue
s d e
p deutsche
rAnzes
Deutsche
Akade m
A umschlac
Stte'kUn9
Straße 1
Hlle; r
o1 e r i e
Berlin. I
njälde u
yemälds
G^nun
Ufer’1
^Ge^ld.
Röster
Scheven,
G7.lt:
peidings
v’roß-Ad
^testen
’vrrmam
l
Zusch
evtl. j
Expe
<tar ?r,a‘ive
IV^tdlung,
epke mit
1 !' n C 11
p.^ald Acl
te,s. Groß
Schaus
U verkauf,
1(11 su<ie z:
^h’Hes, gesu