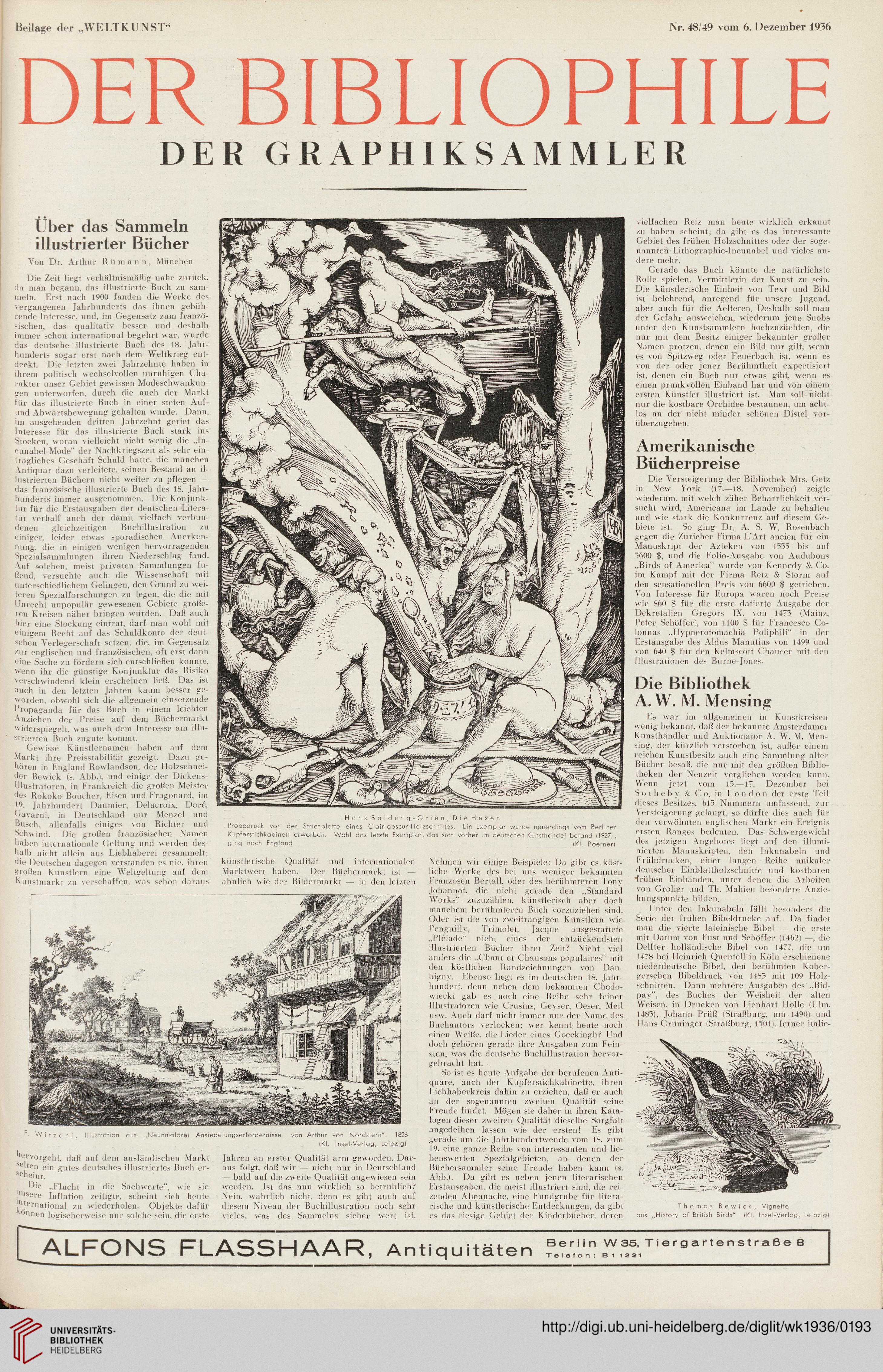Beilage der „WELTKUNST“
Nr. 48/49 vom 6. Dezember 1936
DER BIBLIOPHILE
DER GRAPHIKSAMMLER
Hans Baldung-Grien, Die Hexen
Probedruck von der Strichplatte eines Clair-obscur-Holzschnittes. Ein Exemplar wurde neuerdings vom Berliner
Kupferstichkabinett erworben. Wohl das letzte Exemplar, das sich vorher im deutschen Kunsthandel befand (1927),
ging nach England (Kl. Boerner)
Nehmen wir einige Beispiele: Da gibt es kost-
( her das Sammeln
illustrierter Bücher
Von Dr. Arthur Rümann, München
Die Zeit liegt verhältnismäßig nahe zurück,
da man begann, das illustrierte Buch zu sam-
meln. Erst nach 1900 fanden die Werke des
vergangenen Jahrhunderts das ihnen gebüh-
rende Interesse, und, im Gegensatz zum franzö-
sischen, das qualitativ besser und deshalb
immer schon international begehrt war, wurde
das deutsche illustrierte Buch des 18. Jahr-
hunderts sogar erst nach dem Weltkrieg ent-
deckt. Die letzten zwei Jahrzehnte haben in
ihrem politisch wechselvollen unruhigen Cha-
rakter unser Gebiet gewissen Modeschwankun-
gen unterworfen, durch die auch der Markt
für das illustrierte Buch in einer steten Auf-
und Abwärtsbewegung gehalten wurde. Dann,
im ausgehenden dritten Jahrzehnt geriet das
Interesse für das illustrierte Buch stark ins
Stocken, woran vielleicht nicht wenig die „In-
cunabel-Mode“ der Nachkriegszeit als sehr ein-
trägliches Geschäft Schuld hatte, die manchen
Antiquar dazu verleitete, seinen Bestand an il-
lustrierten Büchern nicht weiter zu pflegen —
das französische illustrierte Buch des 18. Jahr-
hunderts immer ausgenommen. Die Konjunk-
tur für die Erstausgaben der deutschen Litera-
tur verhalf auch der damit vielfach verbun-
denen gleichzeitigen Buchillustration zu
einiger, leider etwas sporadischen Anerken-
nung, die in einigen wenigen hervorragenden
Spezialsammlungen ihren Niederschlag fand.
Auf solchen, meist privaten Sammlungen fu-
ßend, versuchte auch die Wissenschaft mit
unterschiedlichem Gelingen, den Grund zu wei-
teren Spezialforschungen zu legen, die die mit
Unrecht unpopulär gewesenen Gebiete größe-
ren Kreisen näher bringen würden. Daß auch
hier eine Stockung eintrat, darf man wohl mit
einigem Recht auf das Schuldkonto der deut-
schen Verlegerschaft setzen, die, im Gegensatz
zur englischen und französischen, oft erst dann
eine Sache zu fördern sich entschließen konnte,
wenn ihr die günstige Konjunktur das Risiko
verschwindend klein erscheinen ließ. Das ist
auch in den letzten Jahren kaum besser ge-
worden, obwohl sich die allgemein einsetzende
Propaganda für das Buch in einem leichten
Anziehen der Preise auf dem Büchermarkt
widerspiegelt, was auch dem Interesse am illu-
strierten Buch zugute kommt.
Gewisse Künstlernamen haben auf dem
Markt ihre Preisstabilität gezeigt. Dazu ge-
hören in England Rowlandson, der Holzschnei-
der Bewick (s. Abb.), und einige der Dickens-
Illustratoren, in Frankreich die großen Meister
des Rokoko Boucher, Eisen und Fragonard, im
•9. Jahrhundert Daumier, Delacroix, Dore.
Gavarni, in Deutschland nur Menzel und
Busch, allenfalls einiges von Richter und
Schwind. Die großen französischen Namen
haben internationale Geltung und werden des-
halb nicht allein aus Liebhaberei gesammelt:
die Deutschen dagegen verstanden es nie, ihren
großen Künstlern eine Weltgeltung auf dem
Kunstmarkt zu verschaffen, was schon daraus
l'urvorgeht, daß auf dem ausländischen Markt
Gelten ein gutes deutsches illustriertes Buch er-
scheint.
Ehe „Flucht in die Sachwerte“, wie sie
Unsere Inflation zeitigte, scheint sich heute
^/ternational zu wiederholen. Objekte dafür
°nnen logischerweise nur solche sein, die erste
künstlerische Qualität und internationalen
Marktwert haben. Der Büchermarkt ist —
ähnlich wie der Bildermarkt — in den letzten
Jahren an erster Qualität arm geworden. Dar-
aus folgt, daß wir — nicht nur in Deutschland
— bald auf die zweite Qualität angewiesen sein
werden. Ist das nun wirklich so betrüblich?
Nein, wahrlich nicht, denn es gibt auch auf
diesem Niveau der Buchillustration noch sehr
vieles, was des Sammelns sicher wert ist.
liehe Werke des bei uns weniger bekannten
Franzosen Bertall, oder des berühmteren Tony
Johannot, die nicht gerade den „Standard
Works“ zuzuzählen, künstlerisch aber doch
manchem berühmteren Buch vorzuziehen sind.
Oder ist die von zweitrangigen Künstlern wie
Penguilly, Trimolet, Jacque ausgestattete
„Pleiade“ nicht eines der entzückendsten
illustrierten Bücher ihrer Zeit? Nicht viel
anders die „Chant et Chansons populaires“ mit
den köstlichen Randzeichnungen von Dau-
bigny. Ebenso liegt es im deutschen 18. Jahr-
hundert, denn neben dem bekannten Chodo-
wiecki gab es noch eine Reihe sehr feiner
Illustratoren wie Crusius, Geyser, Oeser, Meil
usw. Auch darf nicht immer nur der Name des
Buchautors verlocken; wer kennt heute noch
einen Weiße, die Lieder eines Goeckingh? Und
doch gehören gerade ihre Ausgaben zum Fein-
sten. was die deutsche Buchillustration hervor-
gebracht hat.
So ist es heute Aufgabe der berufenen Anti-
quare, auch der Kupferstichkabinette, ihren
Liebhaberkreis dahin zu erziehen, daß er auch
an der sogenannten zweiten Qualität seine
Freude findet. Mögen sie daher in ihren Kata-
logen dieser zweiten Qualität dieselbe Sorgfalt
angedeihen lassen wie der ersten! Es gibt
gerade um die Jahrhundertwende vom 18. zum
19. eine ganze Reihe von interessanten und lie-
benswerten Spezialgebieten, an denen der
Büchersammler seine Freude haben kann (s.
Abb.). Da gibt es neben jenen literarischen
Erstausgaben, die meist illustriert sind, die rei-
zenden Almanache, eine Fundgrube für litera-
rische und künstlerische Entdeckungen, da gibt
es das riesige Gebiet der Kinderbücher, deren
F Witzani. Illustration aus „Neunmaldrei Ansiedelungserfordernisse von Arthur von Nordstern". 1826
(Kl. Insel-Verlag, Leipzig)
vielfachen Reiz man heute wirklich erkannt
zu haben scheint; da gibt es das interessante
Gebiet des frühen Holzschnittes oder der soge-
nannten Lithographie-Incunabel und vieles an-
dere mehr.
Gerade das Buch könnte die natürlichste
Rolle spielen, Vermittlerin der Kunst zu sein.
Die künstlerische Einheit von Text und Bild
ist belehrend, anregend für unsere Jugend,
aber auch für die Aelteren. Deshalb soll man
der Gefahr ausweichen, wiederum jene Snobs
unter den Kunstsammlern hochzuzüchten, die
nur mit dem Besitz einiger bekannter großer
Namen protzen, denen ein Bild nur gilt, wenn
es von Spitzweg oder Feuerbach ist, wenn es
von der oder jener Berühmtheit expertisiert
ist, denen ein Buch nur etwas gibt, wenn es
einen prunkvollen Einband hat und von einem
ersten Künstler illustriert ist. Man soll nicht
nur die kostbare Orchidee bestaunen, um acht-
los an der nicht minder schönen Distel vor-
überzugehen.
Amerikanische
Bücherpreise
Die Versteigerung der Bibliothek Mrs. Getz
in New York (17.—18. November) zeigte
wiederum, mit welch zäher Beharrlichkeit ver-
sucht wird, Americana im Lande zu behalten
und wie stark die Konkurrenz auf diesem Ge-
biete ist. So ging Dr. A. S. W. Rosenbach
gegen die Züricher Firma L’Art ancien für ein
Manuskript der Azteken von 1535 bis auf
3600 $, und die Folio-Ausgabe von Audubons
„Birds of America“ wurde von Kennedy & Co.
im Kampf mit der Firma Retz & Storm auf
den sensationellen Preis von 6600 $ getrieben.
Von Interesse für Europa waren noch Preise
wie 860 $ für die erste datierte Ausgabe der
Dekretalien Gregors IX. von 1475 (Mainz,
Peter Schöffer), von 1100 $ für Francesco Co-
lonnas „Hypnerotomachia Poliphili“ in der
Erstausgabe des Aldus Manutius von 1499 und
von 640 $ für den Keimscott Chaucer mit den
Illustrationen des Burne-Jones.
Die Bibliothek
A. W. M. Mensing
Es war im allgemeinen in Kunstkreisen
wenig bekannt, daß der bekannte Amsterdamer
Kunsthändler und Auktionator A. W. M. Men-
sing, der kürzlich verstorben ist, außer einem
reichen Kunstbesitz auch eine Sammlung alter
Bücher besaß, die nur mit den größten Biblio-
theken der Neuzeit verglichen werden kann.
Wenn jetzt vom 15.—17. Dezember bei
S o t h e b y & Co. in London der erste Teil
dieses Besitzes, 615 Nummern umfassend, zur
Versteigerung gelangt, so dürfte dies auch für
den verwöhnten englischen Markt ein Ereignis
ersten Ranges bedeuten. Das Schwergewicht
des jetzigen Angebotes liegt auf den illumi-
nierten Manuskripten, den Inkunabeln und
Frühdrucken, einer langen Reihe unikaler
deutscher Einblattholzschnitte und kostbaren
•frühen Einbänden, unter denen die Arbeiten
von Grolier und Th. Mahieu besondere Anzie-
hungspunkte bilden.
Unter den Inkunabeln fällt besonders die
Se rie der frühen Bibeldrucke auf. Da findet
man die vierte lateinische Bibel — die erste
mit Datum von Fust und Schöffer (1462) —, die
Delfter holländische Bibel von 1477, die um
1478 bei Heinrich Quentell in Köln erschienene
niederdeutsche Bibel, den berühmten Kober-
gerschen Bibeldrück von 1483 mit 109 Holz-
schnitten. Dann mehrere Ausgaben des ’„Bi d-
pay“, des Buches der Weisheit der alten
Weisen, in Drucken von Lienhart Holle (Ulm,
1483), Johann Prüß (Straßburg, um 1490) und
Ilans Grüninger (Straßburg, 1501), ferner italie-
Thomas Bewick, Vignette
aus ,,History of British Birds" (Kl. Insel-Verlag, Leipzig)
ALFONS FLASSHAAR, Antiquitäten
Berlin W 35, Tiergartenstraße 8
Telefon: Bi 1221
Nr. 48/49 vom 6. Dezember 1936
DER BIBLIOPHILE
DER GRAPHIKSAMMLER
Hans Baldung-Grien, Die Hexen
Probedruck von der Strichplatte eines Clair-obscur-Holzschnittes. Ein Exemplar wurde neuerdings vom Berliner
Kupferstichkabinett erworben. Wohl das letzte Exemplar, das sich vorher im deutschen Kunsthandel befand (1927),
ging nach England (Kl. Boerner)
Nehmen wir einige Beispiele: Da gibt es kost-
( her das Sammeln
illustrierter Bücher
Von Dr. Arthur Rümann, München
Die Zeit liegt verhältnismäßig nahe zurück,
da man begann, das illustrierte Buch zu sam-
meln. Erst nach 1900 fanden die Werke des
vergangenen Jahrhunderts das ihnen gebüh-
rende Interesse, und, im Gegensatz zum franzö-
sischen, das qualitativ besser und deshalb
immer schon international begehrt war, wurde
das deutsche illustrierte Buch des 18. Jahr-
hunderts sogar erst nach dem Weltkrieg ent-
deckt. Die letzten zwei Jahrzehnte haben in
ihrem politisch wechselvollen unruhigen Cha-
rakter unser Gebiet gewissen Modeschwankun-
gen unterworfen, durch die auch der Markt
für das illustrierte Buch in einer steten Auf-
und Abwärtsbewegung gehalten wurde. Dann,
im ausgehenden dritten Jahrzehnt geriet das
Interesse für das illustrierte Buch stark ins
Stocken, woran vielleicht nicht wenig die „In-
cunabel-Mode“ der Nachkriegszeit als sehr ein-
trägliches Geschäft Schuld hatte, die manchen
Antiquar dazu verleitete, seinen Bestand an il-
lustrierten Büchern nicht weiter zu pflegen —
das französische illustrierte Buch des 18. Jahr-
hunderts immer ausgenommen. Die Konjunk-
tur für die Erstausgaben der deutschen Litera-
tur verhalf auch der damit vielfach verbun-
denen gleichzeitigen Buchillustration zu
einiger, leider etwas sporadischen Anerken-
nung, die in einigen wenigen hervorragenden
Spezialsammlungen ihren Niederschlag fand.
Auf solchen, meist privaten Sammlungen fu-
ßend, versuchte auch die Wissenschaft mit
unterschiedlichem Gelingen, den Grund zu wei-
teren Spezialforschungen zu legen, die die mit
Unrecht unpopulär gewesenen Gebiete größe-
ren Kreisen näher bringen würden. Daß auch
hier eine Stockung eintrat, darf man wohl mit
einigem Recht auf das Schuldkonto der deut-
schen Verlegerschaft setzen, die, im Gegensatz
zur englischen und französischen, oft erst dann
eine Sache zu fördern sich entschließen konnte,
wenn ihr die günstige Konjunktur das Risiko
verschwindend klein erscheinen ließ. Das ist
auch in den letzten Jahren kaum besser ge-
worden, obwohl sich die allgemein einsetzende
Propaganda für das Buch in einem leichten
Anziehen der Preise auf dem Büchermarkt
widerspiegelt, was auch dem Interesse am illu-
strierten Buch zugute kommt.
Gewisse Künstlernamen haben auf dem
Markt ihre Preisstabilität gezeigt. Dazu ge-
hören in England Rowlandson, der Holzschnei-
der Bewick (s. Abb.), und einige der Dickens-
Illustratoren, in Frankreich die großen Meister
des Rokoko Boucher, Eisen und Fragonard, im
•9. Jahrhundert Daumier, Delacroix, Dore.
Gavarni, in Deutschland nur Menzel und
Busch, allenfalls einiges von Richter und
Schwind. Die großen französischen Namen
haben internationale Geltung und werden des-
halb nicht allein aus Liebhaberei gesammelt:
die Deutschen dagegen verstanden es nie, ihren
großen Künstlern eine Weltgeltung auf dem
Kunstmarkt zu verschaffen, was schon daraus
l'urvorgeht, daß auf dem ausländischen Markt
Gelten ein gutes deutsches illustriertes Buch er-
scheint.
Ehe „Flucht in die Sachwerte“, wie sie
Unsere Inflation zeitigte, scheint sich heute
^/ternational zu wiederholen. Objekte dafür
°nnen logischerweise nur solche sein, die erste
künstlerische Qualität und internationalen
Marktwert haben. Der Büchermarkt ist —
ähnlich wie der Bildermarkt — in den letzten
Jahren an erster Qualität arm geworden. Dar-
aus folgt, daß wir — nicht nur in Deutschland
— bald auf die zweite Qualität angewiesen sein
werden. Ist das nun wirklich so betrüblich?
Nein, wahrlich nicht, denn es gibt auch auf
diesem Niveau der Buchillustration noch sehr
vieles, was des Sammelns sicher wert ist.
liehe Werke des bei uns weniger bekannten
Franzosen Bertall, oder des berühmteren Tony
Johannot, die nicht gerade den „Standard
Works“ zuzuzählen, künstlerisch aber doch
manchem berühmteren Buch vorzuziehen sind.
Oder ist die von zweitrangigen Künstlern wie
Penguilly, Trimolet, Jacque ausgestattete
„Pleiade“ nicht eines der entzückendsten
illustrierten Bücher ihrer Zeit? Nicht viel
anders die „Chant et Chansons populaires“ mit
den köstlichen Randzeichnungen von Dau-
bigny. Ebenso liegt es im deutschen 18. Jahr-
hundert, denn neben dem bekannten Chodo-
wiecki gab es noch eine Reihe sehr feiner
Illustratoren wie Crusius, Geyser, Oeser, Meil
usw. Auch darf nicht immer nur der Name des
Buchautors verlocken; wer kennt heute noch
einen Weiße, die Lieder eines Goeckingh? Und
doch gehören gerade ihre Ausgaben zum Fein-
sten. was die deutsche Buchillustration hervor-
gebracht hat.
So ist es heute Aufgabe der berufenen Anti-
quare, auch der Kupferstichkabinette, ihren
Liebhaberkreis dahin zu erziehen, daß er auch
an der sogenannten zweiten Qualität seine
Freude findet. Mögen sie daher in ihren Kata-
logen dieser zweiten Qualität dieselbe Sorgfalt
angedeihen lassen wie der ersten! Es gibt
gerade um die Jahrhundertwende vom 18. zum
19. eine ganze Reihe von interessanten und lie-
benswerten Spezialgebieten, an denen der
Büchersammler seine Freude haben kann (s.
Abb.). Da gibt es neben jenen literarischen
Erstausgaben, die meist illustriert sind, die rei-
zenden Almanache, eine Fundgrube für litera-
rische und künstlerische Entdeckungen, da gibt
es das riesige Gebiet der Kinderbücher, deren
F Witzani. Illustration aus „Neunmaldrei Ansiedelungserfordernisse von Arthur von Nordstern". 1826
(Kl. Insel-Verlag, Leipzig)
vielfachen Reiz man heute wirklich erkannt
zu haben scheint; da gibt es das interessante
Gebiet des frühen Holzschnittes oder der soge-
nannten Lithographie-Incunabel und vieles an-
dere mehr.
Gerade das Buch könnte die natürlichste
Rolle spielen, Vermittlerin der Kunst zu sein.
Die künstlerische Einheit von Text und Bild
ist belehrend, anregend für unsere Jugend,
aber auch für die Aelteren. Deshalb soll man
der Gefahr ausweichen, wiederum jene Snobs
unter den Kunstsammlern hochzuzüchten, die
nur mit dem Besitz einiger bekannter großer
Namen protzen, denen ein Bild nur gilt, wenn
es von Spitzweg oder Feuerbach ist, wenn es
von der oder jener Berühmtheit expertisiert
ist, denen ein Buch nur etwas gibt, wenn es
einen prunkvollen Einband hat und von einem
ersten Künstler illustriert ist. Man soll nicht
nur die kostbare Orchidee bestaunen, um acht-
los an der nicht minder schönen Distel vor-
überzugehen.
Amerikanische
Bücherpreise
Die Versteigerung der Bibliothek Mrs. Getz
in New York (17.—18. November) zeigte
wiederum, mit welch zäher Beharrlichkeit ver-
sucht wird, Americana im Lande zu behalten
und wie stark die Konkurrenz auf diesem Ge-
biete ist. So ging Dr. A. S. W. Rosenbach
gegen die Züricher Firma L’Art ancien für ein
Manuskript der Azteken von 1535 bis auf
3600 $, und die Folio-Ausgabe von Audubons
„Birds of America“ wurde von Kennedy & Co.
im Kampf mit der Firma Retz & Storm auf
den sensationellen Preis von 6600 $ getrieben.
Von Interesse für Europa waren noch Preise
wie 860 $ für die erste datierte Ausgabe der
Dekretalien Gregors IX. von 1475 (Mainz,
Peter Schöffer), von 1100 $ für Francesco Co-
lonnas „Hypnerotomachia Poliphili“ in der
Erstausgabe des Aldus Manutius von 1499 und
von 640 $ für den Keimscott Chaucer mit den
Illustrationen des Burne-Jones.
Die Bibliothek
A. W. M. Mensing
Es war im allgemeinen in Kunstkreisen
wenig bekannt, daß der bekannte Amsterdamer
Kunsthändler und Auktionator A. W. M. Men-
sing, der kürzlich verstorben ist, außer einem
reichen Kunstbesitz auch eine Sammlung alter
Bücher besaß, die nur mit den größten Biblio-
theken der Neuzeit verglichen werden kann.
Wenn jetzt vom 15.—17. Dezember bei
S o t h e b y & Co. in London der erste Teil
dieses Besitzes, 615 Nummern umfassend, zur
Versteigerung gelangt, so dürfte dies auch für
den verwöhnten englischen Markt ein Ereignis
ersten Ranges bedeuten. Das Schwergewicht
des jetzigen Angebotes liegt auf den illumi-
nierten Manuskripten, den Inkunabeln und
Frühdrucken, einer langen Reihe unikaler
deutscher Einblattholzschnitte und kostbaren
•frühen Einbänden, unter denen die Arbeiten
von Grolier und Th. Mahieu besondere Anzie-
hungspunkte bilden.
Unter den Inkunabeln fällt besonders die
Se rie der frühen Bibeldrucke auf. Da findet
man die vierte lateinische Bibel — die erste
mit Datum von Fust und Schöffer (1462) —, die
Delfter holländische Bibel von 1477, die um
1478 bei Heinrich Quentell in Köln erschienene
niederdeutsche Bibel, den berühmten Kober-
gerschen Bibeldrück von 1483 mit 109 Holz-
schnitten. Dann mehrere Ausgaben des ’„Bi d-
pay“, des Buches der Weisheit der alten
Weisen, in Drucken von Lienhart Holle (Ulm,
1483), Johann Prüß (Straßburg, um 1490) und
Ilans Grüninger (Straßburg, 1501), ferner italie-
Thomas Bewick, Vignette
aus ,,History of British Birds" (Kl. Insel-Verlag, Leipzig)
ALFONS FLASSHAAR, Antiquitäten
Berlin W 35, Tiergartenstraße 8
Telefon: Bi 1221