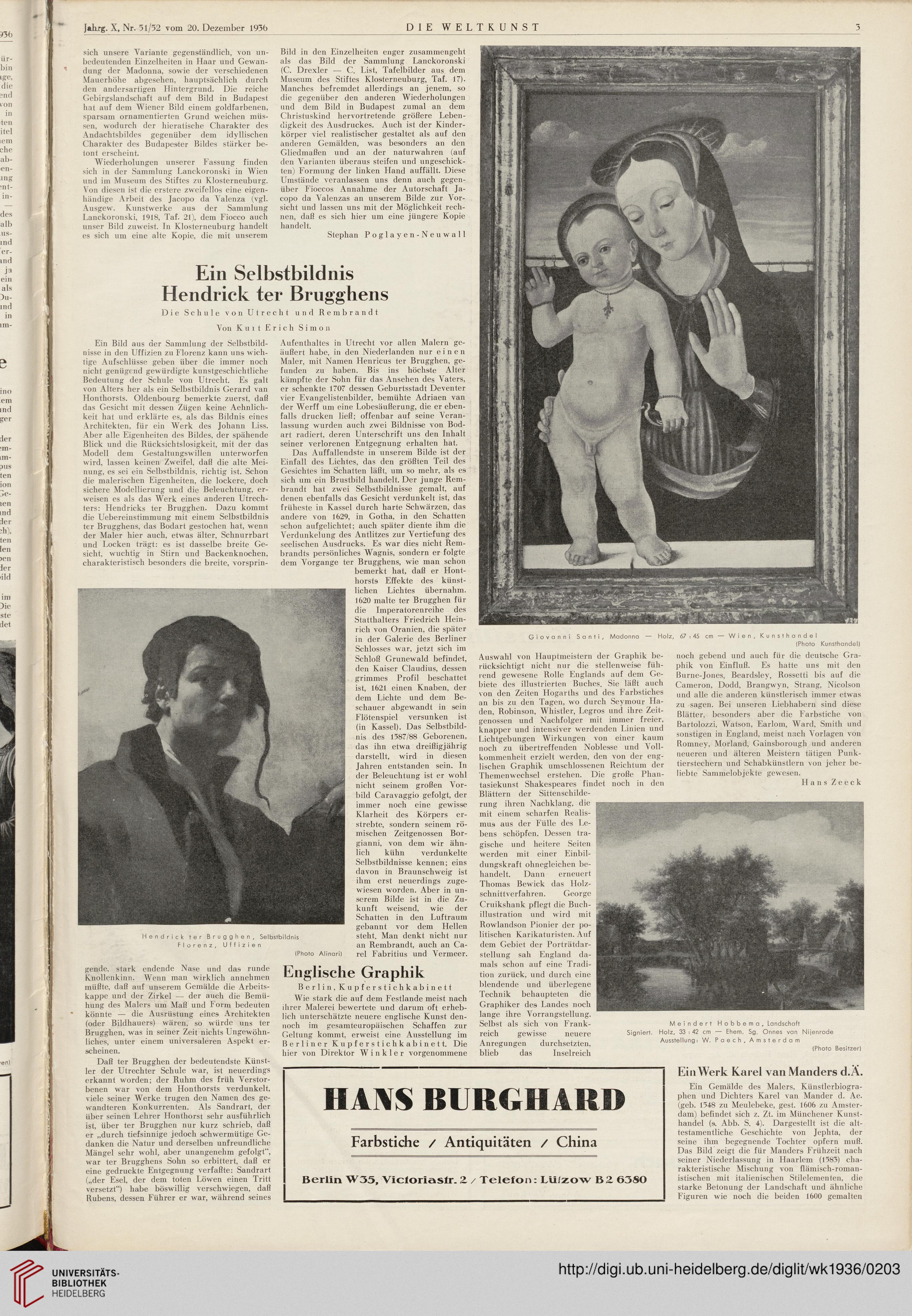Jahrg. X, Nr. 51/52 vom 20. Dezember 1936
DIE WELTKUNST
sich unsere Variante gegenständlich, von un-
bedeutenden Einzelheiten in Haar und Gewan-
dung der Madonna, sowie der verschiedenen
Mauerhöhe abgesehen, hauptsächlich durch
den andersartigen Hintergrund. Die reiche
Gebirgslandschaft auf dem Bild in Budapest
hat auf dem Wiener Bild einem goldfarbenen,
sparsam ornamentierten Grund weichen müs-
sen, wodurch der hieratische Charakter des
Andachtsbildes gegenüber dem idyllischen
Charakter des Budapester Bildes stärker be-
tont erscheint.
Wiederholungen unserer Fassung finden
sich in der Sammlung Lanckoronski in Wien
und im Museum des Stiftes zu Klosterneuburg.
Von diesen ist die erstere zweifellos eine eigen-
händige Arbeit des Jacopo da Valenza (vgl.
Ausgew. Kunstwerke aus der Sammlung
Lanckoronski, 1918, Taf. 21), dem Fiocco auch
unser Bild zuweist. In Klosterneuburg handelt
es sich um eine alte Kopie, die mit unserem
Bild in den Einzelheiten enger zusammengeht
als das Bild der Sammlung Lanckoronski
(C. Drexler — C. List, Tafelbilder aus dem
Museum des Stiftes Klosterneuburg, Taf. 17).
Manches befremdet allerdings an jenem, so
die gegenüber den anderen Wiederholungen
und dem Bild in Budapest zumal an dem
Christuskind hervortretende größere Leben-
digkeit des Ausdruckes. Auch ist der Kinder-
körper viel realistischer gestaltet als auf den
anderen Gemälden, was besonders an den
Gliedmaßen und an der naturwahren (auf
den Varianten überaus steifen und ungeschick-
ten) Formung der linken Hand auffällt. Diese
Umstände veranlassen uns denn auch gegen-
über Fioccos Annahme der Autorschaft Ja-
copo da Valenzas an unserem Bilde zur Vor-
sicht und lassen uns mit der Möglichkeit rech-
nen, daß es sich hier um eine jüngere Kopie
handelt.
Stephan Poglayen-Neuwall
Ein Selbstbildnis
Hendrick ter Bruggliens
Die Schule vonUtrecht und Rembrandt
Von Kult Erich Simon
{Photo Alinaril
IIANS BURGHARD
Farbstiche / Antiquitäten / China
Berlin W35, Vicioriasir. 2. / Telefon: Liilzow B2 6380
der
Be-
sein
ist
gende, stark endende Nase und das runde
Knollenkinn. Wenn man wirklich annehmen
müßte, daß auf unserem Gemälde die Arbeits-
kappe und der Zirkel — der auch die Bemü-
hung des Malers um Maß und Form bedeuten
könnte — die Ausrüstung eines Architekten
(oder Bildhauers) wären, so würde uns ter
Brugghen, was in seiner Zeit nichts Ungewöhn-
liches, unter einem universaleren Aspekt er-
scheinen.
Daß ter Brugghen der bedeutendste Künst-
ler der Utrechter Schule war, ist neuerdings
erkannt worden; der Ruhm des früh Verstor-
benen war von dem Honthorsts verdunkelt,
viele seiner Werke trugen den Namen des ge-
wandteren Konkurrenten. Als Sandrart, der
über seinen Lehrer Honthorst sehr ausführlich
ist, über ter Brugghen nur kurz schrieb, daß
er „durch tiefsinnige jedoch schwermütige Ge-
danken die Natur und derselben unfreundliche
Mängel sehr wohl, aber unangenehm gefolgt“,
war ter Brugghens Sohn so erbittert, daß er
eine gedruckte Entgegnung verfaßte: Sandrart
(„der Esel, der dem toten Löwen einen Tritt
versetzt“) habe böswillig verschwiegen, daß
Rubens, dessen Führer er war, während seines
Ein Bild aus der Sammlung der Selbstbild-
nisse in den Uffizien zu Florenz kann uns wich-
tige Aufschlüsse geben über die immer noch
nicht genügend gewürdigte kunstgeschichtliche
Bedeutung der Schule von Utrecht. Es galt
von Alters her als ein Selbstbildnis Gerard van
Honthorsts. Oldenbourg bemerkte zuerst, daß
das Gesicht mit dessen Zügen keine Aehnlich-
keit hat und erklärte es, als das Bildnis eines
Architekten, für ein Werk des Johann Liss.
Aber alle Eigenheiten des Bildes, der spähende
Blick und die Rücksichtslosigkeit, mit der das
Modell dem Gestaltungswillen unterworfen
wird, lassen keinen Zweifel, daß die alte Mei-
nung, es sei ein Selbstbildnis, richtig ist. Schon
die malerischen Eigenheiten, die lockere, doch
sichere Modellierung und die Beleuchtung, er-
weisen es als das Werk eines anderen Utrech-
ters: Hendricks ter Brugghen. Dazu kommt
die Uebereinstimmung mit einem Selbstbildnis
ter Brugghens, das Bodart gestochen hat, wenn
der Maler hier auch, etwas älter, Schnurrbart
und Locken trägt: es ist dasselbe breite Ge-
sicht. wuchtig in Stirn und Backenknochen,
charakteristisch besonders die breite, vorsprin-
Ein Werk Karel van Manders d.Ä.
Ein Gemälde des Malers, Künstlerbiogra-
phen und Dichters Karel van Mander d. Ae.
(geb. 1548 zu Meulebeke, gest. 1606 zu Amster-
dam) befindet sich z. Zt. im Münchener Kunst-
handel (s. Abb. S. 4). Dargestellt ist die alt-
testamentliche Geschichte von Jephta, der
seine ihm begegnende Tochter opfern muß.
Das Bild zeigt die für Manders Frühzeit nach
seiner Niederlassung in Haarlem (1583) cha-
rakteristische Mischung von flämisch-roman-
istischen mit italienischen Stilelementen, die
starke Betonung der Landschaft und ähnliche
Figuren wie noch die beiden 1600 gemalten
Hendrick ter Brugghen, Selbstbildnis
Florenz, Uffizien
Auswahl von Hauptmeistern der Graphik be-
rücksichtigt nicht nur die stellenweise füh-
rend gewesene Rolle Englands auf dem Ge-
biete des illustrierten Buches. Sie läßt auch
von den Zeiten Hogarths und des Farbstiches
an bis zu den Tagen, wo durch Seymour Ha-
den, Robinson, Whistler, Legros und ihre Zeit-
genossen und Nachfolger mit immer freier,
knapper und intensiver werdenden Linien und
Lichtgebungen Wirkungen von einer kaum
noch zu übertreffenden Noblesse und Voll-
kommenheit erzielt werden, den von der eng-
lischen Graphik umschlossenen Reichtum der
Themenwechsel erstehen. Die große Phan-
tasiekunst Shakespeares findet noch in den
Blättern der Sittenschilde¬
rung ihren Nachklang, die
mit einem scharfen Realis¬
mus aus der Fülle des Le-
bens schöpfen. Dessen tra¬
gische und heitere Seiten
werden mit einer Einbil¬
dungskraft ohnegleichen be¬
handelt. Dann erneuert
Thomas Bewick das Holz¬
schnittverfahren. George
Cruikshank pflegt die Buch¬
illustration und wird mit
Rowlandson Pionier der po-
litischen Karikaturisten. Auf
dem Gebiet der Porträtdar-
stellung sah England da¬
mals schon auf eine Tradi¬
tion zurück, und durch eine
blendende und überlegene
Technik behaupteten die
Graphiker des Landes noch
lange ihre Vorrangstellung.
Selbst als sich von Frank¬
reich gewisse neuere
Anregungen durchsetzten,
blieb das Inselreich
Aufenthaltes in Utrecht vor allen Malern ge-
äußert habe, in den Niederlanden nur einen
Maler, mit Namen Henricus ter Brugghen, ge-
funden zu haben. Bis ins höchste Alter
kämpfte der Sohn für das Ansehen des Vaters,
er schenkte 1707 dessen Geburtsstadt Deventer
vier Evangelistenbilder, bemühte Adriaen van
der Werff um eine Lobesäußerung, die er eben-
falls drucken ließ; offenbar auf seine Veran-
lassung wurden auch zwei Bildnisse von Bod-
art radiert, deren Unterschrift uns den Inhalt
seiner verlorenen Entgegnung erhalten hat.
Das Auffallendste in unserem Bilde ist der
Einfall des Lichtes, das den größten Teil des
Gesichtes im Schatten läßt, um so mehr, als es
sich um ein Brustbild handelt. Der junge Rem-
brandt hat zwei Selbstbildnisse gemalt, auf
denen ebenfalls das Gesicht verdunkelt ist, das
früheste in Kassel durch harte Schwärzen, das
andere von 1629, in Gotha, in den Schatten
schon aufgelichtet; auch später diente ihm die
Verdunkelung des Antlitzes zur Vertiefung des
seelischen Ausdrucks. Es war dies nicht Rem-
brandts persönliches Wagnis, sondern er folgte
dem Vorgänge ter Brugghens, wie man schon
bemerkt hat, daß er Hont-
horsts Effekte des künst-
lichen Lichtes übernahm.
1620 malte ter Brugghen für
die Imperatorenreihe des
Statthalters Friedrich Hein-
rich von Oranien, die später
in der Galerie des Berliner
Schlosses war, jetzt sich im
Schloß Grünewald befindet,
den Kaiser Claudius, dessen
grimmes Profil beschattet
ist, 1621 einen Knaben,
dem Lichte und dem
schauer abgewandt in
Flötenspiel versunken
(in Kassel). Das Selbstbild-
nis des 1587/88 Geborenen,
das ihn etwa dreißigjährig
darstellt, wird in diesen
Jahren entstanden sein. In
der Beleuchtung ist er wohl
nicht seinem großen Vor-
bild Caravaggio gefolgt, der
immer noch eine gewisse
Klarheit des Körpers er-
strebte, sondern seinem rö-
mischen Zeitgenossen Bor-
gianni, von dem wir ähn-
lich kühn verdunkelte
Selbstbildnisse kennen; eins
davon in Braunschweig ist
ihm erst neuerdings zuge-
wiesen worden. Aber in un-
serem Bilde ist in die Zu-
kunft weisend, wie der
Schatten in den Luftraum
gebannt vor dem Hellen
steht. Man denkt nicht nur
an Rembrandt, auch an Ca-
rei Fabritius und Vermeer.
Giovanni Santi, Madonna — Holz, 67:45 cm — Wien, Kunsthandel
(Photo Kunsthandel)
noch gebend und auch für die deutsche Gra-
phik von Einfluß. Es hatte uns mit den
Burne-Jones, Beardsley, Rossetti bis auf die
Cameron, Dodd, Brangwyn, Strang, Nicolson
und alle die anderen künstlerisch immer etwas
zu sagen. Bei unseren Liebhabern sind diese
Blätter, besonders aber die Farbstiche von
Bartolozzi, Watson, Earlom, Ward, Smith und
sonstigen in England, meist nach Vorlagen von
Romney, Morland, Gainsborough und anderen
neueren und älteren Meistern tätigen Punk-
tierstechern und Schabkünstlern von jeher be-
liebte Sammelobjekte gewesen.
Hans Zeeck
Englische Graphik
Berlin, Kupferstichkabinett
Wie stark die auf dem Festlande meist nach
ihrer Malerei bewertete und darum oft erheb-
lich unterschätzte neuere englische Kunst den-
noch im gesamteuropäischen Schaffen zur
Geltung kommt, erweist eine Ausstellung im
Berliner Kupferstichkabinett. Die
hier von Direktor Winkler vorgenommene
Meindert Hobbema, Landschaft
Signiert. Holz, 33 : 42 cm — Ehern. Sg. Onnes van Nijenrode
Ausstellung: W. Paech, Amsterdam
(Photo Besitzer)
DIE WELTKUNST
sich unsere Variante gegenständlich, von un-
bedeutenden Einzelheiten in Haar und Gewan-
dung der Madonna, sowie der verschiedenen
Mauerhöhe abgesehen, hauptsächlich durch
den andersartigen Hintergrund. Die reiche
Gebirgslandschaft auf dem Bild in Budapest
hat auf dem Wiener Bild einem goldfarbenen,
sparsam ornamentierten Grund weichen müs-
sen, wodurch der hieratische Charakter des
Andachtsbildes gegenüber dem idyllischen
Charakter des Budapester Bildes stärker be-
tont erscheint.
Wiederholungen unserer Fassung finden
sich in der Sammlung Lanckoronski in Wien
und im Museum des Stiftes zu Klosterneuburg.
Von diesen ist die erstere zweifellos eine eigen-
händige Arbeit des Jacopo da Valenza (vgl.
Ausgew. Kunstwerke aus der Sammlung
Lanckoronski, 1918, Taf. 21), dem Fiocco auch
unser Bild zuweist. In Klosterneuburg handelt
es sich um eine alte Kopie, die mit unserem
Bild in den Einzelheiten enger zusammengeht
als das Bild der Sammlung Lanckoronski
(C. Drexler — C. List, Tafelbilder aus dem
Museum des Stiftes Klosterneuburg, Taf. 17).
Manches befremdet allerdings an jenem, so
die gegenüber den anderen Wiederholungen
und dem Bild in Budapest zumal an dem
Christuskind hervortretende größere Leben-
digkeit des Ausdruckes. Auch ist der Kinder-
körper viel realistischer gestaltet als auf den
anderen Gemälden, was besonders an den
Gliedmaßen und an der naturwahren (auf
den Varianten überaus steifen und ungeschick-
ten) Formung der linken Hand auffällt. Diese
Umstände veranlassen uns denn auch gegen-
über Fioccos Annahme der Autorschaft Ja-
copo da Valenzas an unserem Bilde zur Vor-
sicht und lassen uns mit der Möglichkeit rech-
nen, daß es sich hier um eine jüngere Kopie
handelt.
Stephan Poglayen-Neuwall
Ein Selbstbildnis
Hendrick ter Bruggliens
Die Schule vonUtrecht und Rembrandt
Von Kult Erich Simon
{Photo Alinaril
IIANS BURGHARD
Farbstiche / Antiquitäten / China
Berlin W35, Vicioriasir. 2. / Telefon: Liilzow B2 6380
der
Be-
sein
ist
gende, stark endende Nase und das runde
Knollenkinn. Wenn man wirklich annehmen
müßte, daß auf unserem Gemälde die Arbeits-
kappe und der Zirkel — der auch die Bemü-
hung des Malers um Maß und Form bedeuten
könnte — die Ausrüstung eines Architekten
(oder Bildhauers) wären, so würde uns ter
Brugghen, was in seiner Zeit nichts Ungewöhn-
liches, unter einem universaleren Aspekt er-
scheinen.
Daß ter Brugghen der bedeutendste Künst-
ler der Utrechter Schule war, ist neuerdings
erkannt worden; der Ruhm des früh Verstor-
benen war von dem Honthorsts verdunkelt,
viele seiner Werke trugen den Namen des ge-
wandteren Konkurrenten. Als Sandrart, der
über seinen Lehrer Honthorst sehr ausführlich
ist, über ter Brugghen nur kurz schrieb, daß
er „durch tiefsinnige jedoch schwermütige Ge-
danken die Natur und derselben unfreundliche
Mängel sehr wohl, aber unangenehm gefolgt“,
war ter Brugghens Sohn so erbittert, daß er
eine gedruckte Entgegnung verfaßte: Sandrart
(„der Esel, der dem toten Löwen einen Tritt
versetzt“) habe böswillig verschwiegen, daß
Rubens, dessen Führer er war, während seines
Ein Bild aus der Sammlung der Selbstbild-
nisse in den Uffizien zu Florenz kann uns wich-
tige Aufschlüsse geben über die immer noch
nicht genügend gewürdigte kunstgeschichtliche
Bedeutung der Schule von Utrecht. Es galt
von Alters her als ein Selbstbildnis Gerard van
Honthorsts. Oldenbourg bemerkte zuerst, daß
das Gesicht mit dessen Zügen keine Aehnlich-
keit hat und erklärte es, als das Bildnis eines
Architekten, für ein Werk des Johann Liss.
Aber alle Eigenheiten des Bildes, der spähende
Blick und die Rücksichtslosigkeit, mit der das
Modell dem Gestaltungswillen unterworfen
wird, lassen keinen Zweifel, daß die alte Mei-
nung, es sei ein Selbstbildnis, richtig ist. Schon
die malerischen Eigenheiten, die lockere, doch
sichere Modellierung und die Beleuchtung, er-
weisen es als das Werk eines anderen Utrech-
ters: Hendricks ter Brugghen. Dazu kommt
die Uebereinstimmung mit einem Selbstbildnis
ter Brugghens, das Bodart gestochen hat, wenn
der Maler hier auch, etwas älter, Schnurrbart
und Locken trägt: es ist dasselbe breite Ge-
sicht. wuchtig in Stirn und Backenknochen,
charakteristisch besonders die breite, vorsprin-
Ein Werk Karel van Manders d.Ä.
Ein Gemälde des Malers, Künstlerbiogra-
phen und Dichters Karel van Mander d. Ae.
(geb. 1548 zu Meulebeke, gest. 1606 zu Amster-
dam) befindet sich z. Zt. im Münchener Kunst-
handel (s. Abb. S. 4). Dargestellt ist die alt-
testamentliche Geschichte von Jephta, der
seine ihm begegnende Tochter opfern muß.
Das Bild zeigt die für Manders Frühzeit nach
seiner Niederlassung in Haarlem (1583) cha-
rakteristische Mischung von flämisch-roman-
istischen mit italienischen Stilelementen, die
starke Betonung der Landschaft und ähnliche
Figuren wie noch die beiden 1600 gemalten
Hendrick ter Brugghen, Selbstbildnis
Florenz, Uffizien
Auswahl von Hauptmeistern der Graphik be-
rücksichtigt nicht nur die stellenweise füh-
rend gewesene Rolle Englands auf dem Ge-
biete des illustrierten Buches. Sie läßt auch
von den Zeiten Hogarths und des Farbstiches
an bis zu den Tagen, wo durch Seymour Ha-
den, Robinson, Whistler, Legros und ihre Zeit-
genossen und Nachfolger mit immer freier,
knapper und intensiver werdenden Linien und
Lichtgebungen Wirkungen von einer kaum
noch zu übertreffenden Noblesse und Voll-
kommenheit erzielt werden, den von der eng-
lischen Graphik umschlossenen Reichtum der
Themenwechsel erstehen. Die große Phan-
tasiekunst Shakespeares findet noch in den
Blättern der Sittenschilde¬
rung ihren Nachklang, die
mit einem scharfen Realis¬
mus aus der Fülle des Le-
bens schöpfen. Dessen tra¬
gische und heitere Seiten
werden mit einer Einbil¬
dungskraft ohnegleichen be¬
handelt. Dann erneuert
Thomas Bewick das Holz¬
schnittverfahren. George
Cruikshank pflegt die Buch¬
illustration und wird mit
Rowlandson Pionier der po-
litischen Karikaturisten. Auf
dem Gebiet der Porträtdar-
stellung sah England da¬
mals schon auf eine Tradi¬
tion zurück, und durch eine
blendende und überlegene
Technik behaupteten die
Graphiker des Landes noch
lange ihre Vorrangstellung.
Selbst als sich von Frank¬
reich gewisse neuere
Anregungen durchsetzten,
blieb das Inselreich
Aufenthaltes in Utrecht vor allen Malern ge-
äußert habe, in den Niederlanden nur einen
Maler, mit Namen Henricus ter Brugghen, ge-
funden zu haben. Bis ins höchste Alter
kämpfte der Sohn für das Ansehen des Vaters,
er schenkte 1707 dessen Geburtsstadt Deventer
vier Evangelistenbilder, bemühte Adriaen van
der Werff um eine Lobesäußerung, die er eben-
falls drucken ließ; offenbar auf seine Veran-
lassung wurden auch zwei Bildnisse von Bod-
art radiert, deren Unterschrift uns den Inhalt
seiner verlorenen Entgegnung erhalten hat.
Das Auffallendste in unserem Bilde ist der
Einfall des Lichtes, das den größten Teil des
Gesichtes im Schatten läßt, um so mehr, als es
sich um ein Brustbild handelt. Der junge Rem-
brandt hat zwei Selbstbildnisse gemalt, auf
denen ebenfalls das Gesicht verdunkelt ist, das
früheste in Kassel durch harte Schwärzen, das
andere von 1629, in Gotha, in den Schatten
schon aufgelichtet; auch später diente ihm die
Verdunkelung des Antlitzes zur Vertiefung des
seelischen Ausdrucks. Es war dies nicht Rem-
brandts persönliches Wagnis, sondern er folgte
dem Vorgänge ter Brugghens, wie man schon
bemerkt hat, daß er Hont-
horsts Effekte des künst-
lichen Lichtes übernahm.
1620 malte ter Brugghen für
die Imperatorenreihe des
Statthalters Friedrich Hein-
rich von Oranien, die später
in der Galerie des Berliner
Schlosses war, jetzt sich im
Schloß Grünewald befindet,
den Kaiser Claudius, dessen
grimmes Profil beschattet
ist, 1621 einen Knaben,
dem Lichte und dem
schauer abgewandt in
Flötenspiel versunken
(in Kassel). Das Selbstbild-
nis des 1587/88 Geborenen,
das ihn etwa dreißigjährig
darstellt, wird in diesen
Jahren entstanden sein. In
der Beleuchtung ist er wohl
nicht seinem großen Vor-
bild Caravaggio gefolgt, der
immer noch eine gewisse
Klarheit des Körpers er-
strebte, sondern seinem rö-
mischen Zeitgenossen Bor-
gianni, von dem wir ähn-
lich kühn verdunkelte
Selbstbildnisse kennen; eins
davon in Braunschweig ist
ihm erst neuerdings zuge-
wiesen worden. Aber in un-
serem Bilde ist in die Zu-
kunft weisend, wie der
Schatten in den Luftraum
gebannt vor dem Hellen
steht. Man denkt nicht nur
an Rembrandt, auch an Ca-
rei Fabritius und Vermeer.
Giovanni Santi, Madonna — Holz, 67:45 cm — Wien, Kunsthandel
(Photo Kunsthandel)
noch gebend und auch für die deutsche Gra-
phik von Einfluß. Es hatte uns mit den
Burne-Jones, Beardsley, Rossetti bis auf die
Cameron, Dodd, Brangwyn, Strang, Nicolson
und alle die anderen künstlerisch immer etwas
zu sagen. Bei unseren Liebhabern sind diese
Blätter, besonders aber die Farbstiche von
Bartolozzi, Watson, Earlom, Ward, Smith und
sonstigen in England, meist nach Vorlagen von
Romney, Morland, Gainsborough und anderen
neueren und älteren Meistern tätigen Punk-
tierstechern und Schabkünstlern von jeher be-
liebte Sammelobjekte gewesen.
Hans Zeeck
Englische Graphik
Berlin, Kupferstichkabinett
Wie stark die auf dem Festlande meist nach
ihrer Malerei bewertete und darum oft erheb-
lich unterschätzte neuere englische Kunst den-
noch im gesamteuropäischen Schaffen zur
Geltung kommt, erweist eine Ausstellung im
Berliner Kupferstichkabinett. Die
hier von Direktor Winkler vorgenommene
Meindert Hobbema, Landschaft
Signiert. Holz, 33 : 42 cm — Ehern. Sg. Onnes van Nijenrode
Ausstellung: W. Paech, Amsterdam
(Photo Besitzer)