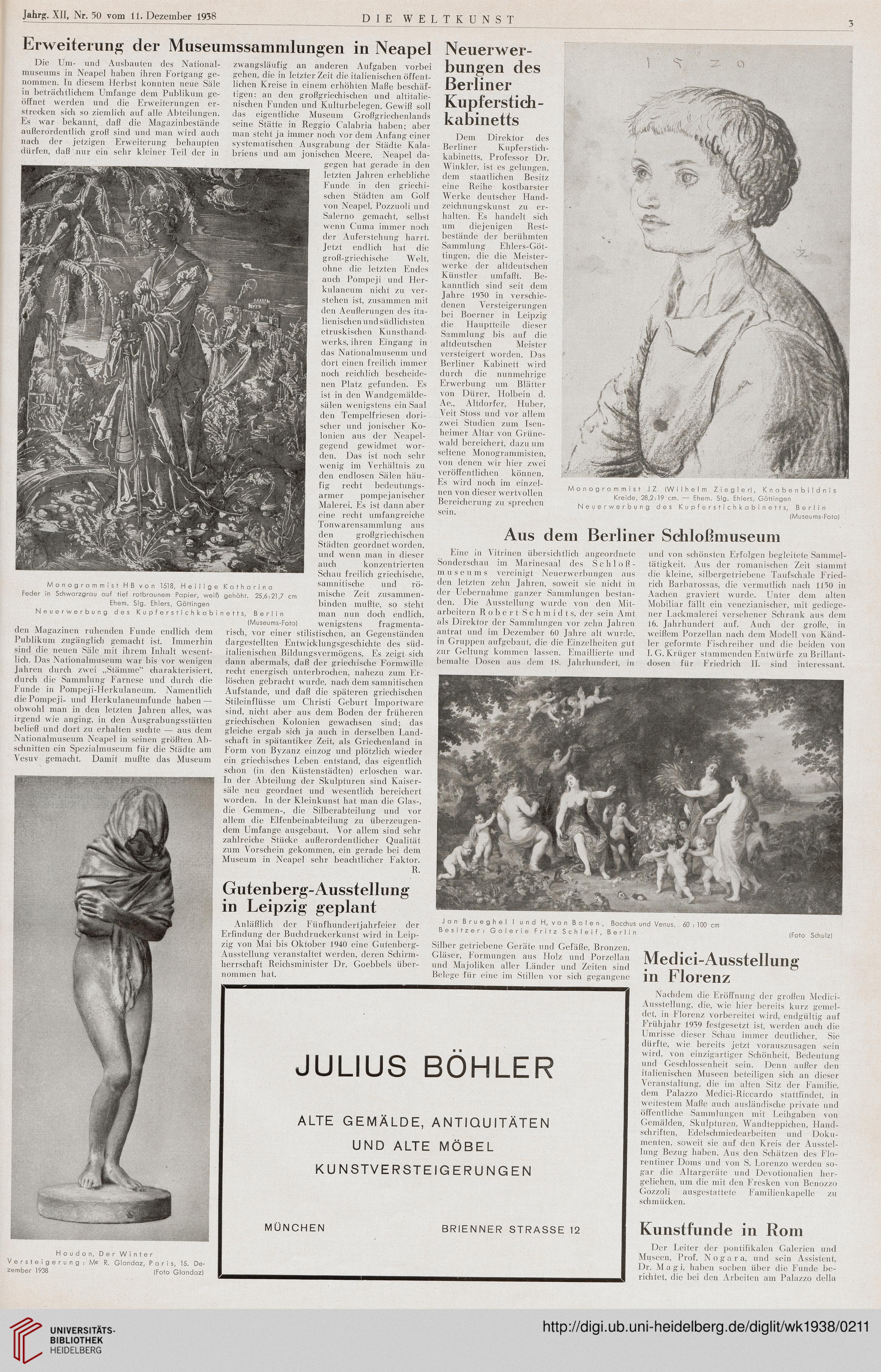Jahrg. XII, Nr. 50 vom 11. Dezember 1958
DIE WELTKUNST
5
Erweiterung der Museumssammlungen in Neapel
Monogrammist JZ (W ilhelm Ziegler), Knabenbildnis
Kreide, 28,2:19 cm. — Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen
Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts, Berlin
(Museums-Foto)
Aus dem Berliner Schloßmuseum
Die Um- und Ausbauten des National-
museums in Neapel haben ihren Fortgang- ge-
nommen. In diesem Herbst konnten neue Säle
in beträchtlichem Umfange dem Publikum ge-
öffnet werden und die Erweiterungen er-
strecken sich so ziemlich auf alle Abteilungen.
Es war bekannt, daß die Magazinbestände
außerordentlich groß sind und man wird auch
nach der jetzigen Erweiterung behaupten
dürfen, daß nur ein sehr kleiner Teil der in
den Magazinen ruhenden Funde endlich dem
Publikum zugänglich gemacht ist. Immerhin
sind die neuen Säle mit ihrem Inhalt wesent-
lich. Das Nationalmuseum war bis vor wenigen
Jahren durch zwei „Stämme“ charakterisiert,
durch die Sammlung Farnese und durch die
Funde in Pompeji-Herkulaneum. Namentlich
die Pompeji- und Herkulaneumfunde haben —
obwohl man in den letzten Jahren alles, was
irgend wie anging, in den Ausgrabungsstätten
beließ und dort zu erhalten suchte — aus dem
Nationalmuseum Neapel in seinen größten Ab-
schnitten ein Spezialmuseum für die Städte am
Vesuv gemacht. Damit mußte das Museum
Houdon, Der Winter
Versteigerung: Me R. Glandaz, Paris, 15. De-
zember 1938 (Foto Glandaz)
zwangsläufig an anderen Aufgaben vorbei
gehen, die in letzter Zeit die italienischen öffent-
lichen Kreise in einem erhöhten Maße beschäf-
tigen: an den großgriechischen und altitalie-
nischen Funden und Kulturbelegen. Gewiß soll
das eigentliche Museum Großgriechenlands
seine Stätte in Reggio Calabria haben; aber
man steht ja immer noch vor dem Anfang einer
systematischen Ausgrabung der Städte Kala-
briens und am jonischen Meere. Neapel da-
gegen hat gerade in den
letzten Jahren erhebliche
Funde in den griechi-
schen Städten am Golf
von Neapel, Pozzuoli und
Salerno gemacht, selbst
wenn Cuma immer noch
der Auferstehung harrt.
Jetzt endlich hat die
groß-griechische Welt,
ohne die letzten Endes
auch Pompeji und Her-
kulaneum nicht zu ver-
stehen ist, zusammen mit
den Aeußerungen des ita-
lienischen und südlichsten
etruskischen Kunsthand-
werks, ihren Eingang in
das Nationalmuseum und
dort einen freilich immer
noch reichlich bescheide-
nen Platz gefunden. Es
ist in den Wandgemälde-
sälen wenigstens ein Saal
den Tempelfriesen dori-
scher und jonischer Ko-
lonien aus der Neapel-
gegend gewidmet wor-
den. Das ist noch sehr
wenig im Verhältnis, zu
den endlosen Sälen häu-
fig recht bedeutungs-
armer pompe janischer
Malerei. Es ist dann aber
eine recht umfangreiche
Tonwarensammlung aus
den großgriechischen
Städten geordnet worden,
und wenn man in dieser
auch konzentrierten
Schau freilich griechische,
samnitische und rö-
mische Zeit zusammen-
binden mußte, so steht
man nun doch endlich,
wenigstens fragmenta-
risch, vor einer stilistischen, an Gegenständen
dargestellten Entwicklungsgeschichte des süd-
italienischen Bildungsvermögens. Es zeigt sich
dann abermals, daß der griechische Formwille
recht energisch unterbrochen, nahezu zum Er-
löschen gebracht wurde, nach dem samnitischen
Aufstande, und daß die späteren griechischen
Stileinfliisse um Christi Geburt Importware
sind, nicht aber aus dem Boden der früheren
griechischen Kolonien gewachsen sind; das
gleiche ergab sich ja auch in derselben Land-
schaft in spätantiker Zeit, als Griechenland in
Form von Byzanz einzog und plötzlich wieder
ein griechisches Leben entstand, das eigentlich
schon (in den Küstenstädten) erloschen war.
In der Abteilung der Skulpturen sind Kaiser-
säle neu geordnet und wesentlich bereichert
worden. In der Kleinkunst hat man die Glas-,
die Gemmen-, die Silberabteilung und vor
allem die Elfenbeinabteilung zu überzeugen-
dem Umfange ausgebaut. Vor allem sind sehr
zahlreiche Stücke außerordentlicher Qualität
zum Vorschein gekommen, ein gerade bei dem
Museum in Neapel sehr beachtlicher Faktor.
R.
Gutenberg-Ausstellung
in Leipzig geplant
Anläßlich der Fünfhundertjahrfeier der
Erfindung der Buchdruckerkunst wird in Leip-
zig von Mai bis Oktober 1940 eine Gutenberg-
Ausstellung veranstaltet werden, deren Schirm-
herrschaft Reichsminister Dr. Goebbels über-
nommen hat.
Neuerwer-
bungen des
Berliner
Kupferstich-
kabinetts
Dem Direktor des
Berliner Kupferstich-
kabinetts, Professor Dr.
Winkler, ist es gelungen,
dem staatlichen Besitz
eine Reihe kostbarster
Werke deutscher Hand-
zeichnungskunst zu er-
halten. Es handelt sich
um diejenigen Rest-
bestände der berühmten
Sammlung Ehlers-Göt-
tingen, die die Meister-
werke der altdeutschen
Künstler umfaßt. Be-
kanntlich sind seit dem
Jahre 1950 in verschie-
denen Versteigerungen
bei Boerner in Leipzig
die Hauptteile dieser
Sammlung bis auf die
altdeutschen Meister
versteigert worden. Das
Berliner Kabinett wird
durch die nunmehrige
Erwerbung um Blätter
von Dürer, Holbein d.
Ae., Altdorfer, Huber,
Veit Stoss und vor allem
zwei Studien zum Isen-
lieimer Altar von Grüne-
wald bereichert, dazu um
seltene Monogrammisten,
von denen wir hier zwei
veröffentlichen können.
Es wird noch im einzel-
nen von dieser wertvollen
Bereicherung zu sprechen
sein.
Eine in Vitrinen übersichtlich angeordnete
Sonderschau im Marinesaal des Schloß-
museums vereinigt Neuerwerbungen aus
den letzten zehn Jahren, soweit sie nicht in
der Uebernahme ganzer Sammlungen bestan-
den. Die Ausstellung wurde von den Mit-
arbeitern Robert Schmidts, der sein Amt
als Direktor der Sammlungen vor zehn Jahren
antrat und im Dezember 60 Jahre alt wurde,
in Gruppen aufgebaut, die die Einzelheiten gut
zur Geltung kommen lassen. Emaillierte und
bemalte Dosen aus dem 18. Jahrhundert, in
Silber getriebene Geräte und Gefäße, Bronzen,
Gläser, Formungen aus Holz und Porzellan
und Majoliken aller Länder und Zeiten sind
Belege für eine im Stillen vor sich gegangene
und von schönsten Erfolgen begleitete Sammel-
tätigkeit. Aus der romanischen Zeit stammt
die kleine, silbergetriebene Taufschale Fried-
rich Barbarossas, die vermutlich nach 1150 in
Aachen graviert wurde. Unter dem alten
Mobiliar fällt ein venezianischer, mit gediege-
ner Lackmalerei versehener Schrank aus dem
16. Jahrhundert auf. Auch der große, in
weißem Porzellan nach dem Modell von Kand-
ier geformte Fischreiher und die beiden von
I. G. Krüger stammenden Entwürfe zu Brillant-
dosen für Friedrich II. sind interessant.
Nachdem die Eröffnung der großen Medici-
Ausstellung, die, wie hier bereits kurz gemel-
det, in Florenz vorbereitet wird, endgültig auf
Frühjahr 1959 festgesetzt ist, werden auch die
Umri sse dieser Schau immer deutlicher. Sie
dürfte, wie bereits jetzt vorauszusagen sein
wird, von einzigartiger Schönheit, Bedeutung
und Geschlossenheit sein. Denn außer den
italienischen Museen beteiligen sich an dieser
Veranstaltung, die im alten Sitz der Familie,
dem Palazzo Medici-Riccardo stattfindet, in
weitestem Maße auch ausländische private und
öffentliche Sammlungen mit Leihgaben von
Gemälden, Skulpturen, Wandteppichen, Hand-
schriften, Edelschmiedearbeiten und Doku-
menten, soweit sie auf den Kreis der Ausstel-
lung Bezug haben. Aus den Schätzen des Flo-
rentiner Doms und von S. Lorenzo werden so-
gar die Altargeräte und Devotionalien her-
geliehen, um die mit den Fresken von Benozzo
Gozzoli ausgestattete Familienkapelle zu
schmücken.
Kunstfunde in Rom
Der Leiter der pontifikalen Galerien und
Museen, Prof. N o g a r a, und sein Assistent,
Dr. Magi, haben soeben über die Funde be-
richtet, die bei den Arbeiten am Palazzo della
JULIUS BÖHLER
ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN
UND ALTE MÖBEL
KUNSTVERSTEIGERUNGEN
MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12
Monogrammist HB von 1518, Heilige Katharina
Feder in Schwarzgrau auf tief rotbraunem Papier, weiß gehöht.
Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen
Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts,
25,6:21,7 cm
Berlin
(Museums-Foto)
Jan Brueghel I und H, van Baien, Bacchus und Venus. 60 : 100 cm
Besitzer: Galerie Fritz Schleif, Berlin
(Foto Schulz)
Medici-Ausstellung
in Florenz
DIE WELTKUNST
5
Erweiterung der Museumssammlungen in Neapel
Monogrammist JZ (W ilhelm Ziegler), Knabenbildnis
Kreide, 28,2:19 cm. — Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen
Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts, Berlin
(Museums-Foto)
Aus dem Berliner Schloßmuseum
Die Um- und Ausbauten des National-
museums in Neapel haben ihren Fortgang- ge-
nommen. In diesem Herbst konnten neue Säle
in beträchtlichem Umfange dem Publikum ge-
öffnet werden und die Erweiterungen er-
strecken sich so ziemlich auf alle Abteilungen.
Es war bekannt, daß die Magazinbestände
außerordentlich groß sind und man wird auch
nach der jetzigen Erweiterung behaupten
dürfen, daß nur ein sehr kleiner Teil der in
den Magazinen ruhenden Funde endlich dem
Publikum zugänglich gemacht ist. Immerhin
sind die neuen Säle mit ihrem Inhalt wesent-
lich. Das Nationalmuseum war bis vor wenigen
Jahren durch zwei „Stämme“ charakterisiert,
durch die Sammlung Farnese und durch die
Funde in Pompeji-Herkulaneum. Namentlich
die Pompeji- und Herkulaneumfunde haben —
obwohl man in den letzten Jahren alles, was
irgend wie anging, in den Ausgrabungsstätten
beließ und dort zu erhalten suchte — aus dem
Nationalmuseum Neapel in seinen größten Ab-
schnitten ein Spezialmuseum für die Städte am
Vesuv gemacht. Damit mußte das Museum
Houdon, Der Winter
Versteigerung: Me R. Glandaz, Paris, 15. De-
zember 1938 (Foto Glandaz)
zwangsläufig an anderen Aufgaben vorbei
gehen, die in letzter Zeit die italienischen öffent-
lichen Kreise in einem erhöhten Maße beschäf-
tigen: an den großgriechischen und altitalie-
nischen Funden und Kulturbelegen. Gewiß soll
das eigentliche Museum Großgriechenlands
seine Stätte in Reggio Calabria haben; aber
man steht ja immer noch vor dem Anfang einer
systematischen Ausgrabung der Städte Kala-
briens und am jonischen Meere. Neapel da-
gegen hat gerade in den
letzten Jahren erhebliche
Funde in den griechi-
schen Städten am Golf
von Neapel, Pozzuoli und
Salerno gemacht, selbst
wenn Cuma immer noch
der Auferstehung harrt.
Jetzt endlich hat die
groß-griechische Welt,
ohne die letzten Endes
auch Pompeji und Her-
kulaneum nicht zu ver-
stehen ist, zusammen mit
den Aeußerungen des ita-
lienischen und südlichsten
etruskischen Kunsthand-
werks, ihren Eingang in
das Nationalmuseum und
dort einen freilich immer
noch reichlich bescheide-
nen Platz gefunden. Es
ist in den Wandgemälde-
sälen wenigstens ein Saal
den Tempelfriesen dori-
scher und jonischer Ko-
lonien aus der Neapel-
gegend gewidmet wor-
den. Das ist noch sehr
wenig im Verhältnis, zu
den endlosen Sälen häu-
fig recht bedeutungs-
armer pompe janischer
Malerei. Es ist dann aber
eine recht umfangreiche
Tonwarensammlung aus
den großgriechischen
Städten geordnet worden,
und wenn man in dieser
auch konzentrierten
Schau freilich griechische,
samnitische und rö-
mische Zeit zusammen-
binden mußte, so steht
man nun doch endlich,
wenigstens fragmenta-
risch, vor einer stilistischen, an Gegenständen
dargestellten Entwicklungsgeschichte des süd-
italienischen Bildungsvermögens. Es zeigt sich
dann abermals, daß der griechische Formwille
recht energisch unterbrochen, nahezu zum Er-
löschen gebracht wurde, nach dem samnitischen
Aufstande, und daß die späteren griechischen
Stileinfliisse um Christi Geburt Importware
sind, nicht aber aus dem Boden der früheren
griechischen Kolonien gewachsen sind; das
gleiche ergab sich ja auch in derselben Land-
schaft in spätantiker Zeit, als Griechenland in
Form von Byzanz einzog und plötzlich wieder
ein griechisches Leben entstand, das eigentlich
schon (in den Küstenstädten) erloschen war.
In der Abteilung der Skulpturen sind Kaiser-
säle neu geordnet und wesentlich bereichert
worden. In der Kleinkunst hat man die Glas-,
die Gemmen-, die Silberabteilung und vor
allem die Elfenbeinabteilung zu überzeugen-
dem Umfange ausgebaut. Vor allem sind sehr
zahlreiche Stücke außerordentlicher Qualität
zum Vorschein gekommen, ein gerade bei dem
Museum in Neapel sehr beachtlicher Faktor.
R.
Gutenberg-Ausstellung
in Leipzig geplant
Anläßlich der Fünfhundertjahrfeier der
Erfindung der Buchdruckerkunst wird in Leip-
zig von Mai bis Oktober 1940 eine Gutenberg-
Ausstellung veranstaltet werden, deren Schirm-
herrschaft Reichsminister Dr. Goebbels über-
nommen hat.
Neuerwer-
bungen des
Berliner
Kupferstich-
kabinetts
Dem Direktor des
Berliner Kupferstich-
kabinetts, Professor Dr.
Winkler, ist es gelungen,
dem staatlichen Besitz
eine Reihe kostbarster
Werke deutscher Hand-
zeichnungskunst zu er-
halten. Es handelt sich
um diejenigen Rest-
bestände der berühmten
Sammlung Ehlers-Göt-
tingen, die die Meister-
werke der altdeutschen
Künstler umfaßt. Be-
kanntlich sind seit dem
Jahre 1950 in verschie-
denen Versteigerungen
bei Boerner in Leipzig
die Hauptteile dieser
Sammlung bis auf die
altdeutschen Meister
versteigert worden. Das
Berliner Kabinett wird
durch die nunmehrige
Erwerbung um Blätter
von Dürer, Holbein d.
Ae., Altdorfer, Huber,
Veit Stoss und vor allem
zwei Studien zum Isen-
lieimer Altar von Grüne-
wald bereichert, dazu um
seltene Monogrammisten,
von denen wir hier zwei
veröffentlichen können.
Es wird noch im einzel-
nen von dieser wertvollen
Bereicherung zu sprechen
sein.
Eine in Vitrinen übersichtlich angeordnete
Sonderschau im Marinesaal des Schloß-
museums vereinigt Neuerwerbungen aus
den letzten zehn Jahren, soweit sie nicht in
der Uebernahme ganzer Sammlungen bestan-
den. Die Ausstellung wurde von den Mit-
arbeitern Robert Schmidts, der sein Amt
als Direktor der Sammlungen vor zehn Jahren
antrat und im Dezember 60 Jahre alt wurde,
in Gruppen aufgebaut, die die Einzelheiten gut
zur Geltung kommen lassen. Emaillierte und
bemalte Dosen aus dem 18. Jahrhundert, in
Silber getriebene Geräte und Gefäße, Bronzen,
Gläser, Formungen aus Holz und Porzellan
und Majoliken aller Länder und Zeiten sind
Belege für eine im Stillen vor sich gegangene
und von schönsten Erfolgen begleitete Sammel-
tätigkeit. Aus der romanischen Zeit stammt
die kleine, silbergetriebene Taufschale Fried-
rich Barbarossas, die vermutlich nach 1150 in
Aachen graviert wurde. Unter dem alten
Mobiliar fällt ein venezianischer, mit gediege-
ner Lackmalerei versehener Schrank aus dem
16. Jahrhundert auf. Auch der große, in
weißem Porzellan nach dem Modell von Kand-
ier geformte Fischreiher und die beiden von
I. G. Krüger stammenden Entwürfe zu Brillant-
dosen für Friedrich II. sind interessant.
Nachdem die Eröffnung der großen Medici-
Ausstellung, die, wie hier bereits kurz gemel-
det, in Florenz vorbereitet wird, endgültig auf
Frühjahr 1959 festgesetzt ist, werden auch die
Umri sse dieser Schau immer deutlicher. Sie
dürfte, wie bereits jetzt vorauszusagen sein
wird, von einzigartiger Schönheit, Bedeutung
und Geschlossenheit sein. Denn außer den
italienischen Museen beteiligen sich an dieser
Veranstaltung, die im alten Sitz der Familie,
dem Palazzo Medici-Riccardo stattfindet, in
weitestem Maße auch ausländische private und
öffentliche Sammlungen mit Leihgaben von
Gemälden, Skulpturen, Wandteppichen, Hand-
schriften, Edelschmiedearbeiten und Doku-
menten, soweit sie auf den Kreis der Ausstel-
lung Bezug haben. Aus den Schätzen des Flo-
rentiner Doms und von S. Lorenzo werden so-
gar die Altargeräte und Devotionalien her-
geliehen, um die mit den Fresken von Benozzo
Gozzoli ausgestattete Familienkapelle zu
schmücken.
Kunstfunde in Rom
Der Leiter der pontifikalen Galerien und
Museen, Prof. N o g a r a, und sein Assistent,
Dr. Magi, haben soeben über die Funde be-
richtet, die bei den Arbeiten am Palazzo della
JULIUS BÖHLER
ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN
UND ALTE MÖBEL
KUNSTVERSTEIGERUNGEN
MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12
Monogrammist HB von 1518, Heilige Katharina
Feder in Schwarzgrau auf tief rotbraunem Papier, weiß gehöht.
Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen
Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts,
25,6:21,7 cm
Berlin
(Museums-Foto)
Jan Brueghel I und H, van Baien, Bacchus und Venus. 60 : 100 cm
Besitzer: Galerie Fritz Schleif, Berlin
(Foto Schulz)
Medici-Ausstellung
in Florenz