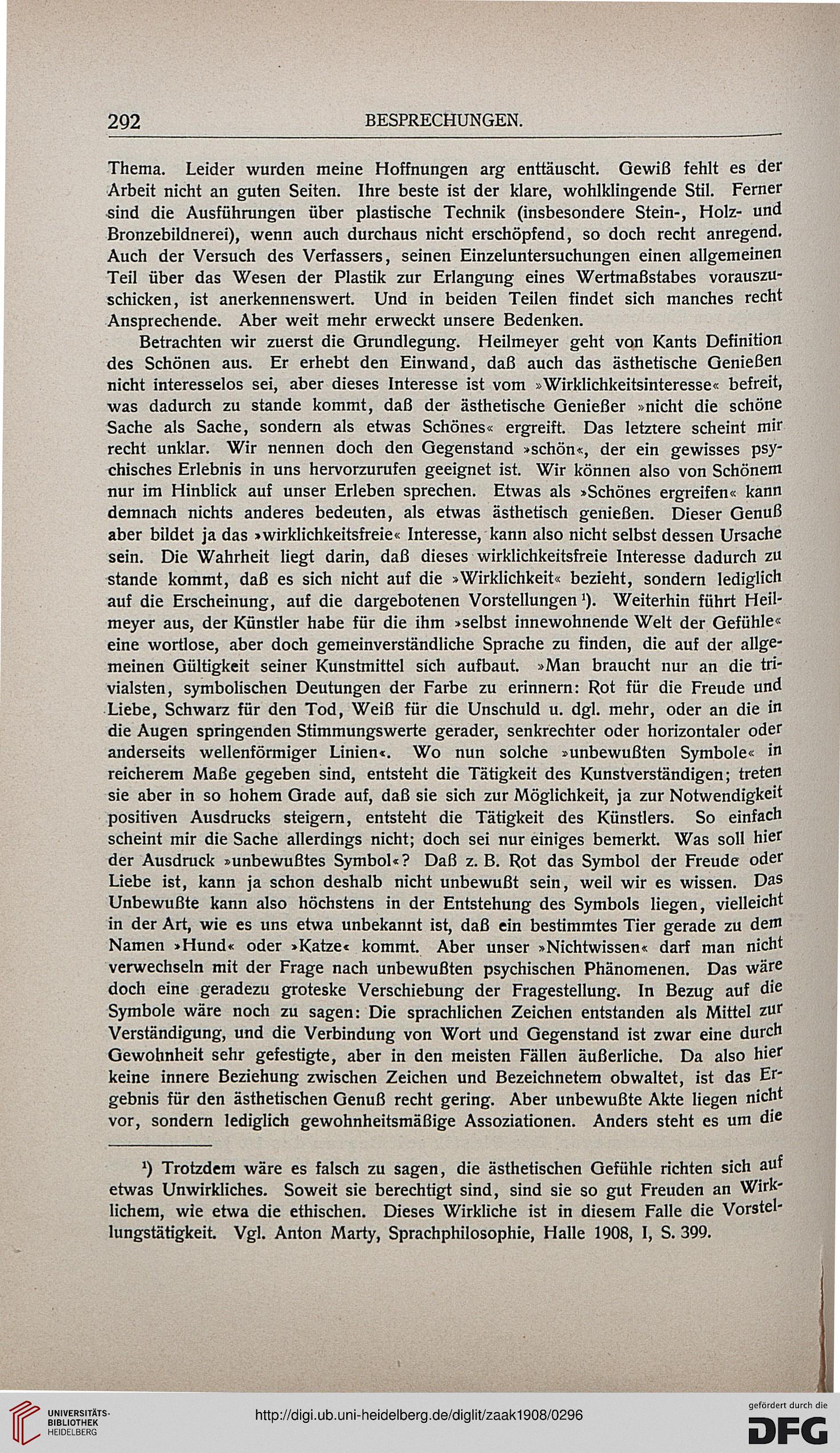292
BESPRECHUNGEN.
Thema. Leider wurden meine Hoffnungen arg enttäuscht. Gewiß fehlt es der
Arbeit nicht an guten Seiten. Ihre beste ist der klare, wohlklingende Stil. Ferner
sind die Ausführungen über plastische Technik (insbesondere Stein-, Holz- und
Bronzebildnerei), wenn auch durchaus nicht erschöpfend, so doch recht anregend.
Auch der Versuch des Verfassers, seinen Einzeluntersuchungen einen allgemeinen
Teil über das Wesen der Plastik zur Erlangung eines Wertmaßstabes vorauszu-
schicken, ist anerkennenswert. Und in beiden Teilen findet sich manches recht
Ansprechende. Aber weit mehr erweckt unsere Bedenken.
Betrachten wir zuerst die Grundlegung. Heilmeyer geht von Kants Definition
des Schönen aus. Er erhebt den Einwand, daß auch das ästhetische Genießen
nicht interesselos sei, aber dieses Interesse ist vom »Wirklichkeitsinteresse« befreit,
was dadurch zu stände kommt, daß der ästhetische Genießer »nicht die schöne
Sache als Sache, sondern als etwas Schönes« ergreift. Das letztere scheint mir
recht unklar. Wir nennen doch den Gegenstand »schön«, der ein gewisses psy-
chisches Erlebnis in uns hervorzurufen geeignet ist. Wir können also von Schönem
nur im Hinblick auf unser Erleben sprechen. Etwas als »Schönes ergreifen« kann
demnach nichts anderes bedeuten, als etwas ästhetisch genießen. Dieser Genuß
aber bildet ja das »wirklichkeitsfreie« Interesse, kann also nicht selbst dessen Ursache
sein. Die Wahrheit liegt darin, daß dieses wirklichkeitsfreie Interesse dadurch zu
stände kommt, daß es sich nicht auf die »Wirklichkeit« bezieht, sondern lediglich
auf die Erscheinung, auf die dargebotenen Vorstellungen'). Weiterhin führt Heil-
meyer aus, der Künstler habe für die ihm »selbst innewohnende Welt der Gefühle«
eine wortlose, aber doch gemeinverständliche Sprache zu finden, die auf der allge-
meinen Gültigkeit seiner Kunstmittel sich aufbaut. »Man braucht nur an die tri-
vialsten, symbolischen Deutungen der Farbe zu erinnern: Rot für die Freude und
Liebe, Schwarz für den Tod, Weiß für die Unschuld u. dgl. mehr, oder an die in
die Augen springenden Stimmungswerte gerader, senkrechter oder horizontaler oder
anderseits wellenförmiger Linien«. Wo nun solche »unbewußten Symbole« in
reicherem Maße gegeben sind, entsteht die Tätigkeit des Kunstverständigen; treten
sie aber in so hohem Grade auf, daß sie sich zur Möglichkeit, ja zur Notwendigkeit
positiven Ausdrucks steigern, entsteht die Tätigkeit des Künstlers. So einfach
scheint mir die Sache allerdings nicht; doch sei nur einiges bemerkt. Was soll hier
der Ausdruck »unbewußtes Symbol«? Daß z. B. Rot das Symbol der Freude oder
Liebe ist, kann ja schon deshalb nicht unbewußt sein, weil wir es wissen. Das
Unbewußte kann also höchstens in der Entstehung des Symbols liegen, vielleicht
in der Art, wie es uns etwa unbekannt ist, daß ein bestimmtes Tier gerade zu dem
Namen »Hund« oder »Katze« kommt. Aber unser »Nichtwissen« darf man nicht
verwechseln mit der Frage nach unbewußten psychischen Phänomenen. Das wäre
doch eine geradezu groteske Verschiebung der Fragestellung. In Bezug auf d'e
Symbole wäre noch zu sagen: Die sprachlichen Zeichen entstanden als Mittel zur
Verständigung, und die Verbindung von Wort und Gegenstand ist zwar eine durch
Gewohnheit sehr gefestigte, aber in den meisten Fällen äußerliche. Da also hier
keine innere Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem obwaltet, ist das Er-
gebnis für den ästhetischen Genuß recht gering. Aber unbewußte Akte liegen nicht
vor, sondern lediglich gewohnheitsmäßige Assoziationen. Anders steht es um die
') Trotzdem wäre es falsch zu sagen, die ästhetischen Gefühle richten sich auf
etwas Unwirkliches. Soweit sie berechtigt sind, sind sie so gut Freuden an Wirk-
lichem, wie etwa die ethischen. Dieses Wirkliche ist in diesem Falle die Vorstel-
lungstätigkeii Vgl. Anton Marty, Sprachphilosophie, Halle 1908, I, S. 399.
BESPRECHUNGEN.
Thema. Leider wurden meine Hoffnungen arg enttäuscht. Gewiß fehlt es der
Arbeit nicht an guten Seiten. Ihre beste ist der klare, wohlklingende Stil. Ferner
sind die Ausführungen über plastische Technik (insbesondere Stein-, Holz- und
Bronzebildnerei), wenn auch durchaus nicht erschöpfend, so doch recht anregend.
Auch der Versuch des Verfassers, seinen Einzeluntersuchungen einen allgemeinen
Teil über das Wesen der Plastik zur Erlangung eines Wertmaßstabes vorauszu-
schicken, ist anerkennenswert. Und in beiden Teilen findet sich manches recht
Ansprechende. Aber weit mehr erweckt unsere Bedenken.
Betrachten wir zuerst die Grundlegung. Heilmeyer geht von Kants Definition
des Schönen aus. Er erhebt den Einwand, daß auch das ästhetische Genießen
nicht interesselos sei, aber dieses Interesse ist vom »Wirklichkeitsinteresse« befreit,
was dadurch zu stände kommt, daß der ästhetische Genießer »nicht die schöne
Sache als Sache, sondern als etwas Schönes« ergreift. Das letztere scheint mir
recht unklar. Wir nennen doch den Gegenstand »schön«, der ein gewisses psy-
chisches Erlebnis in uns hervorzurufen geeignet ist. Wir können also von Schönem
nur im Hinblick auf unser Erleben sprechen. Etwas als »Schönes ergreifen« kann
demnach nichts anderes bedeuten, als etwas ästhetisch genießen. Dieser Genuß
aber bildet ja das »wirklichkeitsfreie« Interesse, kann also nicht selbst dessen Ursache
sein. Die Wahrheit liegt darin, daß dieses wirklichkeitsfreie Interesse dadurch zu
stände kommt, daß es sich nicht auf die »Wirklichkeit« bezieht, sondern lediglich
auf die Erscheinung, auf die dargebotenen Vorstellungen'). Weiterhin führt Heil-
meyer aus, der Künstler habe für die ihm »selbst innewohnende Welt der Gefühle«
eine wortlose, aber doch gemeinverständliche Sprache zu finden, die auf der allge-
meinen Gültigkeit seiner Kunstmittel sich aufbaut. »Man braucht nur an die tri-
vialsten, symbolischen Deutungen der Farbe zu erinnern: Rot für die Freude und
Liebe, Schwarz für den Tod, Weiß für die Unschuld u. dgl. mehr, oder an die in
die Augen springenden Stimmungswerte gerader, senkrechter oder horizontaler oder
anderseits wellenförmiger Linien«. Wo nun solche »unbewußten Symbole« in
reicherem Maße gegeben sind, entsteht die Tätigkeit des Kunstverständigen; treten
sie aber in so hohem Grade auf, daß sie sich zur Möglichkeit, ja zur Notwendigkeit
positiven Ausdrucks steigern, entsteht die Tätigkeit des Künstlers. So einfach
scheint mir die Sache allerdings nicht; doch sei nur einiges bemerkt. Was soll hier
der Ausdruck »unbewußtes Symbol«? Daß z. B. Rot das Symbol der Freude oder
Liebe ist, kann ja schon deshalb nicht unbewußt sein, weil wir es wissen. Das
Unbewußte kann also höchstens in der Entstehung des Symbols liegen, vielleicht
in der Art, wie es uns etwa unbekannt ist, daß ein bestimmtes Tier gerade zu dem
Namen »Hund« oder »Katze« kommt. Aber unser »Nichtwissen« darf man nicht
verwechseln mit der Frage nach unbewußten psychischen Phänomenen. Das wäre
doch eine geradezu groteske Verschiebung der Fragestellung. In Bezug auf d'e
Symbole wäre noch zu sagen: Die sprachlichen Zeichen entstanden als Mittel zur
Verständigung, und die Verbindung von Wort und Gegenstand ist zwar eine durch
Gewohnheit sehr gefestigte, aber in den meisten Fällen äußerliche. Da also hier
keine innere Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem obwaltet, ist das Er-
gebnis für den ästhetischen Genuß recht gering. Aber unbewußte Akte liegen nicht
vor, sondern lediglich gewohnheitsmäßige Assoziationen. Anders steht es um die
') Trotzdem wäre es falsch zu sagen, die ästhetischen Gefühle richten sich auf
etwas Unwirkliches. Soweit sie berechtigt sind, sind sie so gut Freuden an Wirk-
lichem, wie etwa die ethischen. Dieses Wirkliche ist in diesem Falle die Vorstel-
lungstätigkeii Vgl. Anton Marty, Sprachphilosophie, Halle 1908, I, S. 399.