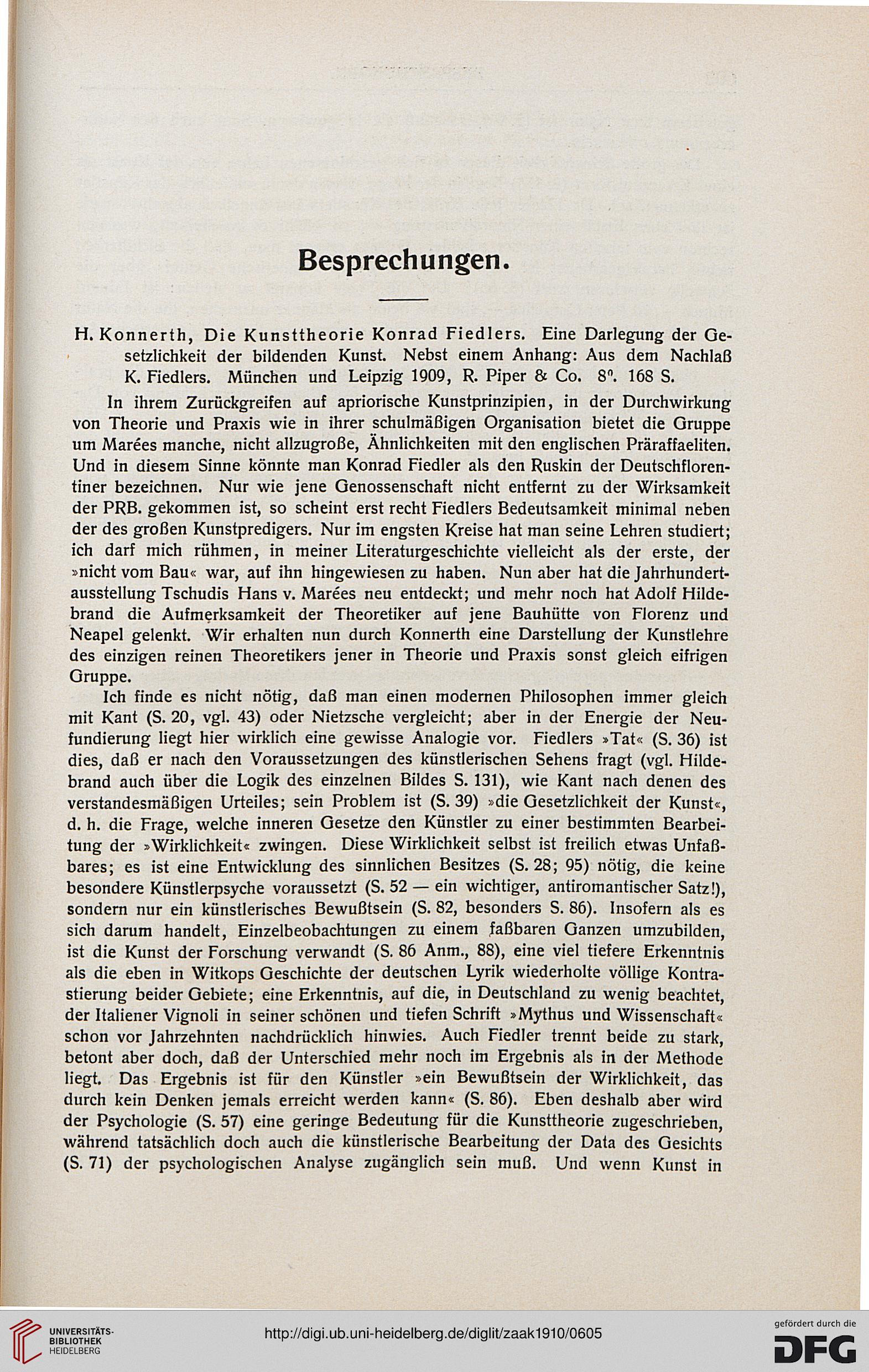Besprechungen.
H. Konnerth, Die Kunsttheorie Konrad Fiedlers. Eine Darlegung der Ge-
setzlichkeit der bildenden Kunst. Nebst einem Anhang: Aus dem Nachlaß
K. Fiedlers. München und Leipzig 1909, R. Piper & Co. 8". 168 S.
In ihrem Zurückgreifen auf apriorische Kunstprinzipien, in der Durchwirkung
von Theorie und Praxis wie in ihrer schulmäßigen Organisation bietet die Gruppe
um Marees manche, nicht allzugroße, Ähnlichkeiten mit den englischen Präraffaeliten.
Und in diesem Sinne könnte man Konrad Fiedler als den Ruskin der Deutschfloren-
tiner bezeichnen. Nur wie jene Genossenschaft nicht entfernt zu der Wirksamkeit
der PRB. gekommen ist, so scheint erst recht Fiedlers Bedeutsamkeit minimal neben
der des großen Kunstpredigers. Nur im engsten Kreise hat man seine Lehren studiert;
ich darf mich rühmen, in meiner Literaturgeschichte vielleicht als der erste, der
»nicht vom Bau« war, auf ihn hingewiesen zu haben. Nun aber hat die Jahrhundert-
ausstellung Tschudis Hans v. Marees neu entdeckt; und mehr noch hat Adolf Hilde-
brand die Aufmerksamkeit der Theoretiker auf jene Bauhütte von Florenz und
Neapel gelenkt. Wir erhalten nun durch Konnerth eine Darstellung der Kunstlehre
des einzigen reinen Theoretikers jener in Theorie und Praxis sonst gleich eifrigen
Gruppe.
Ich finde es nicht nötig, daß man einen modernen Philosophen immer gleich
mit Kant (S. 20, vgl. 43) oder Nietzsche vergleicht; aber in der Energie der Neu-
fundierung liegt hier wirklich eine gewisse Analogie vor. Fiedlers »Tat« (S. 36) ist
dies, daß er nach den Voraussetzungen des künstlerischen Sehens fragt (vgl. Hilde-
brand auch über die Logik des einzelnen Bildes S. 131), wie Kant nach denen des
verstandesmäßigen Urteiles; sein Problem ist (S. 39) »die Gesetzlichkeit der Kunst«,
d. h. die Frage, welche inneren Gesetze den Künstler zu einer bestimmten Bearbei-
tung der »Wirklichkeit« zwingen. Diese Wirklichkeit selbst ist freilich etwas Unfaß-
bares; es ist eine Entwicklung des sinnlichen Besitzes (S. 28; 95) nötig, die keine
besondere Künstlerpsyche voraussetzt (S. 52 — ein wichtiger, antiromantischer Satz!),
sondern nur ein künstlerisches Bewußtsein (S. 82, besonders S. 86). Insofern als es
sich darum handelt, Einzelbeobachtungen zu einem faßbaren Ganzen umzubilden,
ist die Kunst der Forschung verwandt (S. 86 Anm., 88), eine viel tiefere Erkenntnis
als die eben in Witkops Geschichte der deutschen Lyrik wiederholte völlige Kontra-
stierung beider Gebiete; eine Erkenntnis, auf die, in Deutschland zu wenig beachtet,
der Italiener Vignoli in seiner schönen und tiefen Schrift »Mythus und Wissenschaft«
schon vor Jahrzehnten nachdrücklich hinwies. Auch Fiedler trennt beide zu stark,
betont aber doch, daß der Unterschied mehr noch im Ergebnis als in der Methode
liegt. Das Ergebnis ist für den Künstler »ein Bewußtsein der Wirklichkeit, das
durch kein Denken jemals erreicht werden kann« (S. 86). Eben deshalb aber wird
der Psychologie (S. 57) eine geringe Bedeutung für die Kunsttheorie zugeschrieben,
während tatsächlich doch auch die künstlerische Bearbeitung der Data des Gesichts
(S. 71) der psychologischen Analyse zugänglich sein muß. Und wenn Kunst in
H. Konnerth, Die Kunsttheorie Konrad Fiedlers. Eine Darlegung der Ge-
setzlichkeit der bildenden Kunst. Nebst einem Anhang: Aus dem Nachlaß
K. Fiedlers. München und Leipzig 1909, R. Piper & Co. 8". 168 S.
In ihrem Zurückgreifen auf apriorische Kunstprinzipien, in der Durchwirkung
von Theorie und Praxis wie in ihrer schulmäßigen Organisation bietet die Gruppe
um Marees manche, nicht allzugroße, Ähnlichkeiten mit den englischen Präraffaeliten.
Und in diesem Sinne könnte man Konrad Fiedler als den Ruskin der Deutschfloren-
tiner bezeichnen. Nur wie jene Genossenschaft nicht entfernt zu der Wirksamkeit
der PRB. gekommen ist, so scheint erst recht Fiedlers Bedeutsamkeit minimal neben
der des großen Kunstpredigers. Nur im engsten Kreise hat man seine Lehren studiert;
ich darf mich rühmen, in meiner Literaturgeschichte vielleicht als der erste, der
»nicht vom Bau« war, auf ihn hingewiesen zu haben. Nun aber hat die Jahrhundert-
ausstellung Tschudis Hans v. Marees neu entdeckt; und mehr noch hat Adolf Hilde-
brand die Aufmerksamkeit der Theoretiker auf jene Bauhütte von Florenz und
Neapel gelenkt. Wir erhalten nun durch Konnerth eine Darstellung der Kunstlehre
des einzigen reinen Theoretikers jener in Theorie und Praxis sonst gleich eifrigen
Gruppe.
Ich finde es nicht nötig, daß man einen modernen Philosophen immer gleich
mit Kant (S. 20, vgl. 43) oder Nietzsche vergleicht; aber in der Energie der Neu-
fundierung liegt hier wirklich eine gewisse Analogie vor. Fiedlers »Tat« (S. 36) ist
dies, daß er nach den Voraussetzungen des künstlerischen Sehens fragt (vgl. Hilde-
brand auch über die Logik des einzelnen Bildes S. 131), wie Kant nach denen des
verstandesmäßigen Urteiles; sein Problem ist (S. 39) »die Gesetzlichkeit der Kunst«,
d. h. die Frage, welche inneren Gesetze den Künstler zu einer bestimmten Bearbei-
tung der »Wirklichkeit« zwingen. Diese Wirklichkeit selbst ist freilich etwas Unfaß-
bares; es ist eine Entwicklung des sinnlichen Besitzes (S. 28; 95) nötig, die keine
besondere Künstlerpsyche voraussetzt (S. 52 — ein wichtiger, antiromantischer Satz!),
sondern nur ein künstlerisches Bewußtsein (S. 82, besonders S. 86). Insofern als es
sich darum handelt, Einzelbeobachtungen zu einem faßbaren Ganzen umzubilden,
ist die Kunst der Forschung verwandt (S. 86 Anm., 88), eine viel tiefere Erkenntnis
als die eben in Witkops Geschichte der deutschen Lyrik wiederholte völlige Kontra-
stierung beider Gebiete; eine Erkenntnis, auf die, in Deutschland zu wenig beachtet,
der Italiener Vignoli in seiner schönen und tiefen Schrift »Mythus und Wissenschaft«
schon vor Jahrzehnten nachdrücklich hinwies. Auch Fiedler trennt beide zu stark,
betont aber doch, daß der Unterschied mehr noch im Ergebnis als in der Methode
liegt. Das Ergebnis ist für den Künstler »ein Bewußtsein der Wirklichkeit, das
durch kein Denken jemals erreicht werden kann« (S. 86). Eben deshalb aber wird
der Psychologie (S. 57) eine geringe Bedeutung für die Kunsttheorie zugeschrieben,
während tatsächlich doch auch die künstlerische Bearbeitung der Data des Gesichts
(S. 71) der psychologischen Analyse zugänglich sein muß. Und wenn Kunst in