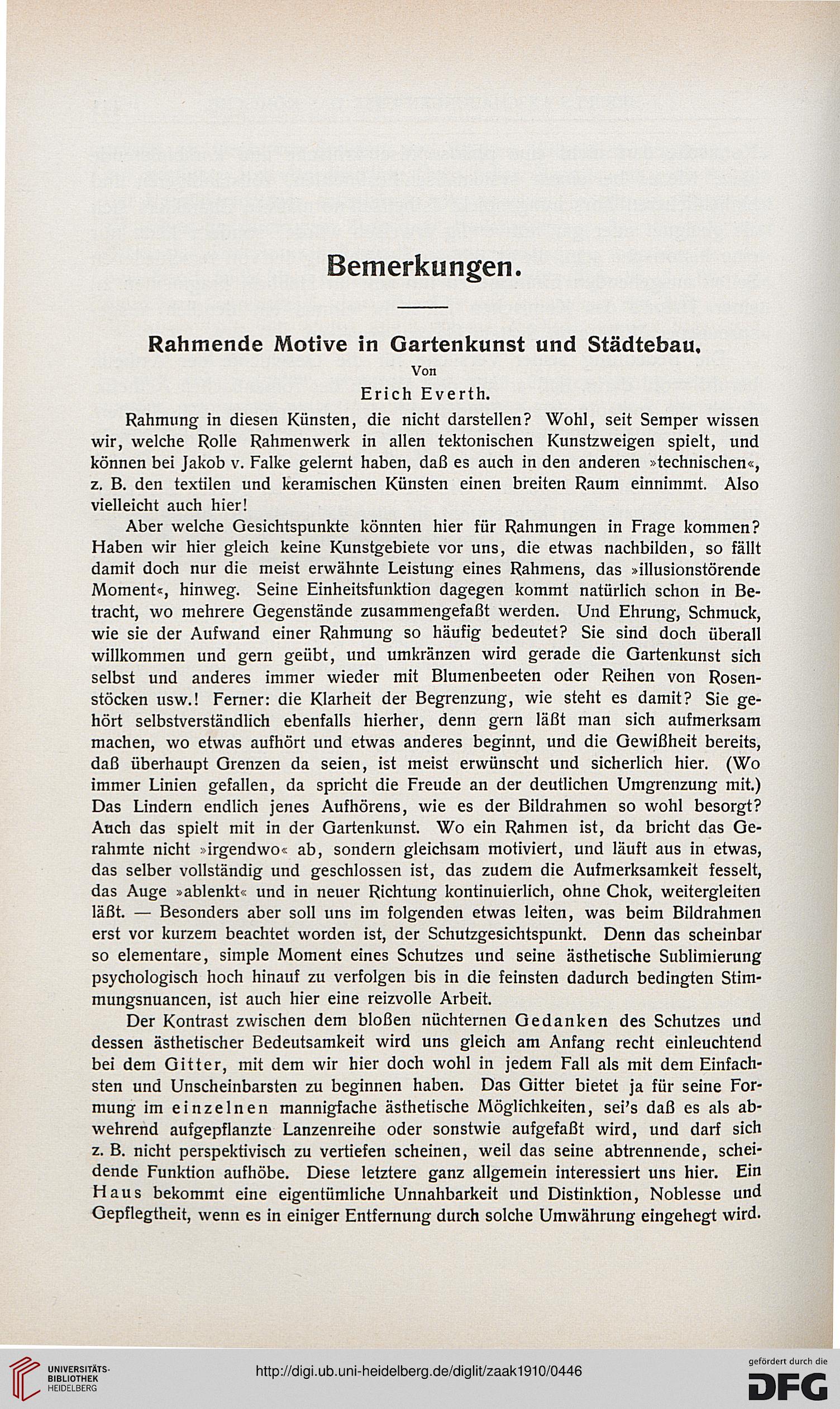Bemerkungen.
Rahmende Motive in Gartenkunst und Städtebau,
Von
Erich Everth.
Rahmung in diesen Künsten, die nicht darstellen? Wohl, seit Semper wissen
wir, welche Rolle Rahmenwerk in allen tektonischen Kunstzweigen spielt, und
können bei Jakob v. Falke gelernt haben, daß es auch in den anderen »technischen«,
z. B. den textilen und keramischen Künsten einen breiten Raum einnimmt. Also
vielleicht auch hier!
Aber welche Gesichtspunkte könnten hier für Rahmungen in Frage kommen?
Haben wir hier gleich keine Kunstgebiete vor uns, die etwas nachbilden, so fällt
damit doch nur die meist erwähnte Leistung eines Rahmens, das »illusionstörende
Moment«, hinweg. Seine Einheitsfunktion dagegen kommt natürlich schon in Be-
tracht, wo mehrere Gegenstände zusammengefaßt werden. Und Ehrung, Schmuck,
wie sie der Aufwand einer Rahmung so häufig bedeutet? Sie sind doch überall
willkommen und gern geübt, und umkränzen wird gerade die Gartenkunst sich
selbst und anderes immer wieder mit Blumenbeeten oder Reihen von Rosen-
stöcken usw.! Ferner: die Klarheit der Begrenzung, wie steht es damit? Sie ge-
hört selbstverständlich ebenfalls hierher, denn gern läßt man sich aufmerksam
machen, wo etwas aufhört und etwas anderes beginnt, und die Gewißheit bereits,
daß überhaupt Grenzen da seien, ist meist erwünscht und sicherlich hier. (Wo
immer Linien gefallen, da spricht die Freude an der deutlichen Umgrenzung mit.)
Das Lindern endlich jenes Aufhörens, wie es der Bildrahmen so wohl besorgt?
Auch das spielt mit in der Gartenkunst. Wo ein Rahmen ist, da bricht das Ge-
rahmte nicht ^irgendwo« ab, sondern gleichsam motiviert, und läuft aus in etwas,
das selber vollständig und geschlossen ist, das zudem die Aufmerksamkeit fesselt,
das Auge »ablenkt« und in neuer Richtung kontinuierlich, ohne Chok, weitergleiten
läßt. — Besonders aber soll uns im folgenden etwas leiten, was beim Bildrahmen
erst vor kurzem beachtet worden ist, der Schutzgesichtspunkt. Denn das scheinbar
so elementare, simple Moment eines Schutzes und seine ästhetische Sublimierung
psychologisch hoch hinauf zu verfolgen bis in die feinsten dadurch bedingten Stim-
mungsnuancen, ist auch hier eine reizvolle Arbeit.
Der Kontrast zwischen dem bloßen nüchternen Gedanken des Schutzes und
dessen ästhetischer Bedeutsamkeit wird uns gleich am Anfang recht einleuchtend
bei dem Gitter, mit dem wir hier doch wohl in jedem Fall als mit dem Einfach-
sten und Unscheinbarsten zu beginnen haben. Das Gitter bietet ja für seine For-
mung im einzelnen mannigfache ästhetische Möglichkeiten, sei's daß es als ab-
wehrend aufgepflanzte Lanzenreihe oder sonstwie aufgefaßt wird, und darf sich
z. B. nicht perspektivisch zu vertiefen scheinen, weil das seine abtrennende, schei-
dende Funktion aufhöbe. Diese letztere ganz allgemein interessiert uns hier. Ein
Haus bekommt eine eigentümliche Unnahbarkeit und Distinktion, Noblesse und
Gepflegtheit, wenn es in einiger Entfernung durch solche Umwährung eingehegt wird.
Rahmende Motive in Gartenkunst und Städtebau,
Von
Erich Everth.
Rahmung in diesen Künsten, die nicht darstellen? Wohl, seit Semper wissen
wir, welche Rolle Rahmenwerk in allen tektonischen Kunstzweigen spielt, und
können bei Jakob v. Falke gelernt haben, daß es auch in den anderen »technischen«,
z. B. den textilen und keramischen Künsten einen breiten Raum einnimmt. Also
vielleicht auch hier!
Aber welche Gesichtspunkte könnten hier für Rahmungen in Frage kommen?
Haben wir hier gleich keine Kunstgebiete vor uns, die etwas nachbilden, so fällt
damit doch nur die meist erwähnte Leistung eines Rahmens, das »illusionstörende
Moment«, hinweg. Seine Einheitsfunktion dagegen kommt natürlich schon in Be-
tracht, wo mehrere Gegenstände zusammengefaßt werden. Und Ehrung, Schmuck,
wie sie der Aufwand einer Rahmung so häufig bedeutet? Sie sind doch überall
willkommen und gern geübt, und umkränzen wird gerade die Gartenkunst sich
selbst und anderes immer wieder mit Blumenbeeten oder Reihen von Rosen-
stöcken usw.! Ferner: die Klarheit der Begrenzung, wie steht es damit? Sie ge-
hört selbstverständlich ebenfalls hierher, denn gern läßt man sich aufmerksam
machen, wo etwas aufhört und etwas anderes beginnt, und die Gewißheit bereits,
daß überhaupt Grenzen da seien, ist meist erwünscht und sicherlich hier. (Wo
immer Linien gefallen, da spricht die Freude an der deutlichen Umgrenzung mit.)
Das Lindern endlich jenes Aufhörens, wie es der Bildrahmen so wohl besorgt?
Auch das spielt mit in der Gartenkunst. Wo ein Rahmen ist, da bricht das Ge-
rahmte nicht ^irgendwo« ab, sondern gleichsam motiviert, und läuft aus in etwas,
das selber vollständig und geschlossen ist, das zudem die Aufmerksamkeit fesselt,
das Auge »ablenkt« und in neuer Richtung kontinuierlich, ohne Chok, weitergleiten
läßt. — Besonders aber soll uns im folgenden etwas leiten, was beim Bildrahmen
erst vor kurzem beachtet worden ist, der Schutzgesichtspunkt. Denn das scheinbar
so elementare, simple Moment eines Schutzes und seine ästhetische Sublimierung
psychologisch hoch hinauf zu verfolgen bis in die feinsten dadurch bedingten Stim-
mungsnuancen, ist auch hier eine reizvolle Arbeit.
Der Kontrast zwischen dem bloßen nüchternen Gedanken des Schutzes und
dessen ästhetischer Bedeutsamkeit wird uns gleich am Anfang recht einleuchtend
bei dem Gitter, mit dem wir hier doch wohl in jedem Fall als mit dem Einfach-
sten und Unscheinbarsten zu beginnen haben. Das Gitter bietet ja für seine For-
mung im einzelnen mannigfache ästhetische Möglichkeiten, sei's daß es als ab-
wehrend aufgepflanzte Lanzenreihe oder sonstwie aufgefaßt wird, und darf sich
z. B. nicht perspektivisch zu vertiefen scheinen, weil das seine abtrennende, schei-
dende Funktion aufhöbe. Diese letztere ganz allgemein interessiert uns hier. Ein
Haus bekommt eine eigentümliche Unnahbarkeit und Distinktion, Noblesse und
Gepflegtheit, wenn es in einiger Entfernung durch solche Umwährung eingehegt wird.