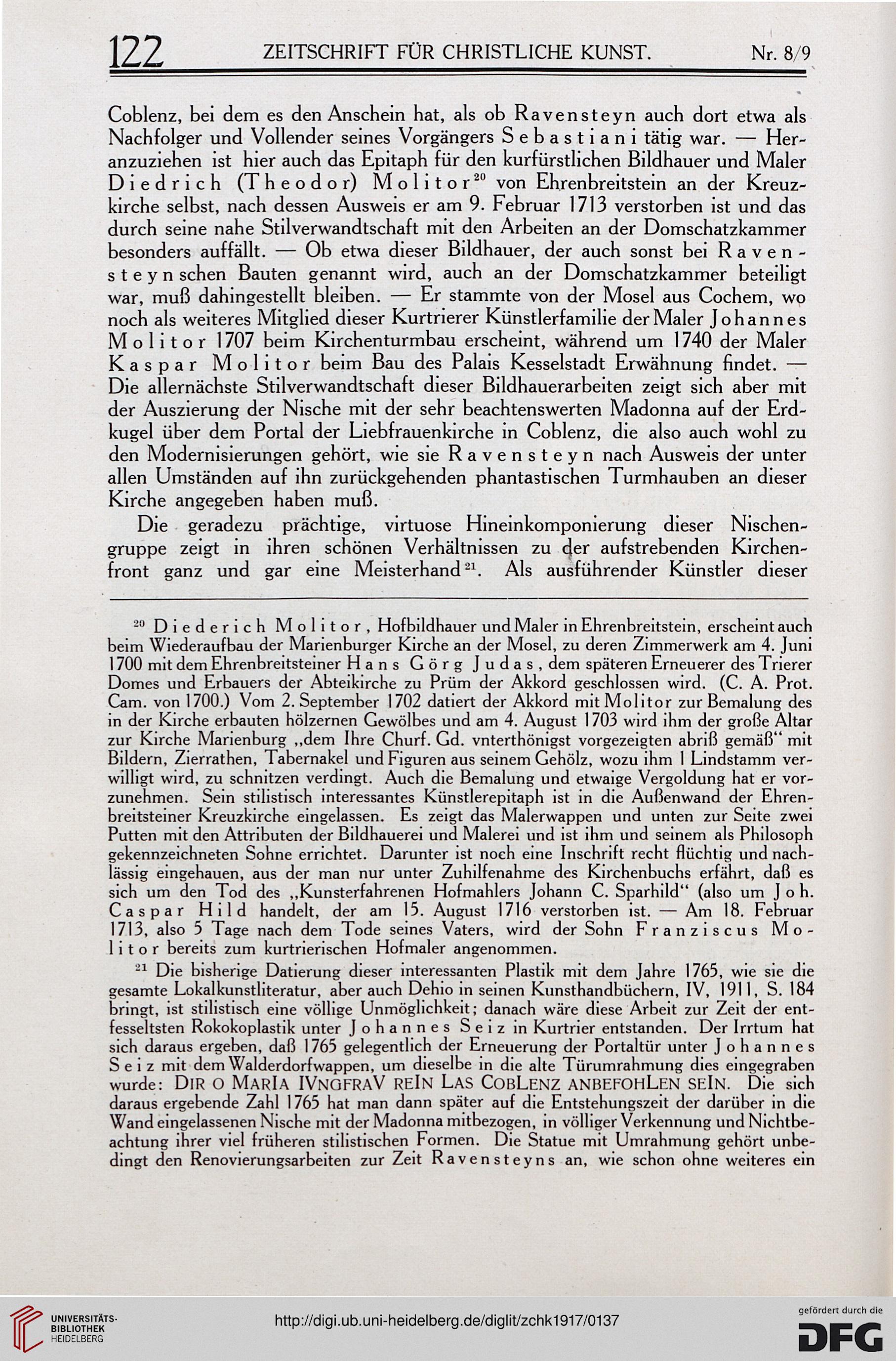122
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 8/9
Coblenz, bei dem es den Anschein hat, als ob Ravensteyn auch dort etwa als
Nachfolger und Vollender seines Vorgängers Sebastiani tätig war. — Her-
anzuziehen ist hier auch das Epitaph für den kurfürstlichen Bildhauer und Maler
Diedrich (Theodor) Molitor20 von Ehrenbreitstein an der Kreuz-
kirche selbst, nach dessen Ausweis er am 9. Februar 1713 verstorben ist und das
durch seine nahe Stilverwandtschaft mit den Arbeiten an der Domschatzkammer
besonders auffällt. — Ob etwa dieser Bildhauer, der auch sonst bei Raven-
steyn sehen Bauten genannt wird, auch an der Domschatzkammer beteiligt
war, muß dahingestellt bleiben. — Er stammte von der Mosel aus Cochem, wo
noch als weiteres Mitglied dieser Kurtrierer Künstlerfamilie der Maler Johannes
M o 1 i t o r 1707 beim Kirchenturmbau erscheint, während um 1740 der Maler
Kaspar Molitor beim Bau des Palais Kesselstadt Erwähnung findet. —
Die allernächste Stilverwandtschaft dieser Bildhauerarbeiten zeigt sich aber mit
der Auszierung der Nische mit der sehr beachtenswerten Madonna auf der Erd-
kugel über dem Portal der Liebfrauenkirche in Coblenz, die also auch wohl zu
den Modernisierungen gehört, wie sie Ravensteyn nach Ausweis der unter
allen Umständen auf ihn zurückgehenden phantastischen Turmhauben an dieser
Kirche angegeben haben muß.
Die geradezu prächtige, virtuose Hineinkomponierung dieser Nischen-
gruppe zeigt in ihren schönen Verhältnissen zu <\er aufstrebenden Kirchen-
front ganz und gar eine Meisterhand21. Als ausführender Künstler dieser
20 Diederich Molitor, Hofbildhauer und Maler in Ehrenbreitstein, erscheintauch
beim Wiederaufbau der Manenburger Kirche an der Mosel, zu deren Zimmerwerk am 4. Juni
1700 mit dem Ehrenbreitsteiner Hans Görg Judas, dem späteren Erneuerer des Trierer
Domes und Erbauers der Abteikirche zu Prüm der Akkord geschlossen wird. (C. A. Prot.
Cam. von 1700.) Vom 2. September 1702 datiert der Akkord mit Molitor zur Bemalung des
in der Kirche erbauten hölzernen Gewölbes und am 4. August 1703 wird ihm der große Altar
zur Kirche Marienburg „dem Ihre Churf. Gd. vnterthönigst vorgezeigten abriß gemäß" mit
Bildern, Zierrathen, Tabernakel und Figuren aus seinem Gehölz, wozu ihm 1 Lindstamm ver-
willigt wird, zu schnitzen verdingt. Auch die Bemalung und etwaige Vergoldung hat er vor-
zunehmen. Sem stilistisch interessantes Künstlerepitaph ist in die Außenwand der Ehren-
breitsteiner Kreuzkirche eingelassen. Es zeigt das Malerwappen und unten zur Seite zwei
Putten mit den Attributen der Bildhauerei und Malerei und ist ihm und seinem als Philosoph
gekennzeichneten Sohne errichtet. Darunter ist noch eine Inschrift recht flüchtig und nach-
lässig eingehauen, aus der man nur unter Zuhilfenahme des Kirchenbuchs erfährt, daß es
sich um den Tod des „Kunsterfahrenen Hofmahlers Johann C. Sparhild" (also um J o h.
Caspar Hild handelt, der am 15. August 1716 verstorben ist. — Am 18. Februar
1713, also 5 Tage nach dem Tode seines Vaters, wird der Sohn Franziscus Mo-
li t o r bereits zum kurtrierischen Hofmaler angenommen.
21 Die bisherige Datierung dieser interessanten Plastik mit dem Jahre 1765, wie sie die
gesamte Lokalkunstliteratur, aber auch Dehio in seinen Kunsthandbüchern, IV, 1911, S. 184
bringt, ist stilistisch eine völlige Unmöglichkeit; danach wäre diese Arbeit zur Zeit der ent-
fesseltsten Rokokoplastik unter Johannes Seiz in Kurtrier entstanden. Der Irrtum hat
sich daraus ergeben, daß 1765 gelegentlich der Erneuerung der Portaltür unter Johannes
Seiz mit dem Walderdorfwappen, um dieselbe in die alte Türumrahmung dies eingegraben
wurde: DlR O MARIA IVnQFRAV RElN LAS COBLENZ ANBEFOHLEN SEIN. Die sich
daraus ergebende Zahl 1765 hat man dann später auf die Entstehungszeit der darüber in die
Wand eingelassenen Nische mit der Madonna mitbezogen, in völliger Verkennung und Nichtbe-
achtung ihrer viel früheren stilistischen Formen. Die Statue mit Umrahmung gehört unbe-
dingt den Renovierungsarbeiten zur Zeit Ravensteyns an, wie schon ohne weiteres ein
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 8/9
Coblenz, bei dem es den Anschein hat, als ob Ravensteyn auch dort etwa als
Nachfolger und Vollender seines Vorgängers Sebastiani tätig war. — Her-
anzuziehen ist hier auch das Epitaph für den kurfürstlichen Bildhauer und Maler
Diedrich (Theodor) Molitor20 von Ehrenbreitstein an der Kreuz-
kirche selbst, nach dessen Ausweis er am 9. Februar 1713 verstorben ist und das
durch seine nahe Stilverwandtschaft mit den Arbeiten an der Domschatzkammer
besonders auffällt. — Ob etwa dieser Bildhauer, der auch sonst bei Raven-
steyn sehen Bauten genannt wird, auch an der Domschatzkammer beteiligt
war, muß dahingestellt bleiben. — Er stammte von der Mosel aus Cochem, wo
noch als weiteres Mitglied dieser Kurtrierer Künstlerfamilie der Maler Johannes
M o 1 i t o r 1707 beim Kirchenturmbau erscheint, während um 1740 der Maler
Kaspar Molitor beim Bau des Palais Kesselstadt Erwähnung findet. —
Die allernächste Stilverwandtschaft dieser Bildhauerarbeiten zeigt sich aber mit
der Auszierung der Nische mit der sehr beachtenswerten Madonna auf der Erd-
kugel über dem Portal der Liebfrauenkirche in Coblenz, die also auch wohl zu
den Modernisierungen gehört, wie sie Ravensteyn nach Ausweis der unter
allen Umständen auf ihn zurückgehenden phantastischen Turmhauben an dieser
Kirche angegeben haben muß.
Die geradezu prächtige, virtuose Hineinkomponierung dieser Nischen-
gruppe zeigt in ihren schönen Verhältnissen zu <\er aufstrebenden Kirchen-
front ganz und gar eine Meisterhand21. Als ausführender Künstler dieser
20 Diederich Molitor, Hofbildhauer und Maler in Ehrenbreitstein, erscheintauch
beim Wiederaufbau der Manenburger Kirche an der Mosel, zu deren Zimmerwerk am 4. Juni
1700 mit dem Ehrenbreitsteiner Hans Görg Judas, dem späteren Erneuerer des Trierer
Domes und Erbauers der Abteikirche zu Prüm der Akkord geschlossen wird. (C. A. Prot.
Cam. von 1700.) Vom 2. September 1702 datiert der Akkord mit Molitor zur Bemalung des
in der Kirche erbauten hölzernen Gewölbes und am 4. August 1703 wird ihm der große Altar
zur Kirche Marienburg „dem Ihre Churf. Gd. vnterthönigst vorgezeigten abriß gemäß" mit
Bildern, Zierrathen, Tabernakel und Figuren aus seinem Gehölz, wozu ihm 1 Lindstamm ver-
willigt wird, zu schnitzen verdingt. Auch die Bemalung und etwaige Vergoldung hat er vor-
zunehmen. Sem stilistisch interessantes Künstlerepitaph ist in die Außenwand der Ehren-
breitsteiner Kreuzkirche eingelassen. Es zeigt das Malerwappen und unten zur Seite zwei
Putten mit den Attributen der Bildhauerei und Malerei und ist ihm und seinem als Philosoph
gekennzeichneten Sohne errichtet. Darunter ist noch eine Inschrift recht flüchtig und nach-
lässig eingehauen, aus der man nur unter Zuhilfenahme des Kirchenbuchs erfährt, daß es
sich um den Tod des „Kunsterfahrenen Hofmahlers Johann C. Sparhild" (also um J o h.
Caspar Hild handelt, der am 15. August 1716 verstorben ist. — Am 18. Februar
1713, also 5 Tage nach dem Tode seines Vaters, wird der Sohn Franziscus Mo-
li t o r bereits zum kurtrierischen Hofmaler angenommen.
21 Die bisherige Datierung dieser interessanten Plastik mit dem Jahre 1765, wie sie die
gesamte Lokalkunstliteratur, aber auch Dehio in seinen Kunsthandbüchern, IV, 1911, S. 184
bringt, ist stilistisch eine völlige Unmöglichkeit; danach wäre diese Arbeit zur Zeit der ent-
fesseltsten Rokokoplastik unter Johannes Seiz in Kurtrier entstanden. Der Irrtum hat
sich daraus ergeben, daß 1765 gelegentlich der Erneuerung der Portaltür unter Johannes
Seiz mit dem Walderdorfwappen, um dieselbe in die alte Türumrahmung dies eingegraben
wurde: DlR O MARIA IVnQFRAV RElN LAS COBLENZ ANBEFOHLEN SEIN. Die sich
daraus ergebende Zahl 1765 hat man dann später auf die Entstehungszeit der darüber in die
Wand eingelassenen Nische mit der Madonna mitbezogen, in völliger Verkennung und Nichtbe-
achtung ihrer viel früheren stilistischen Formen. Die Statue mit Umrahmung gehört unbe-
dingt den Renovierungsarbeiten zur Zeit Ravensteyns an, wie schon ohne weiteres ein