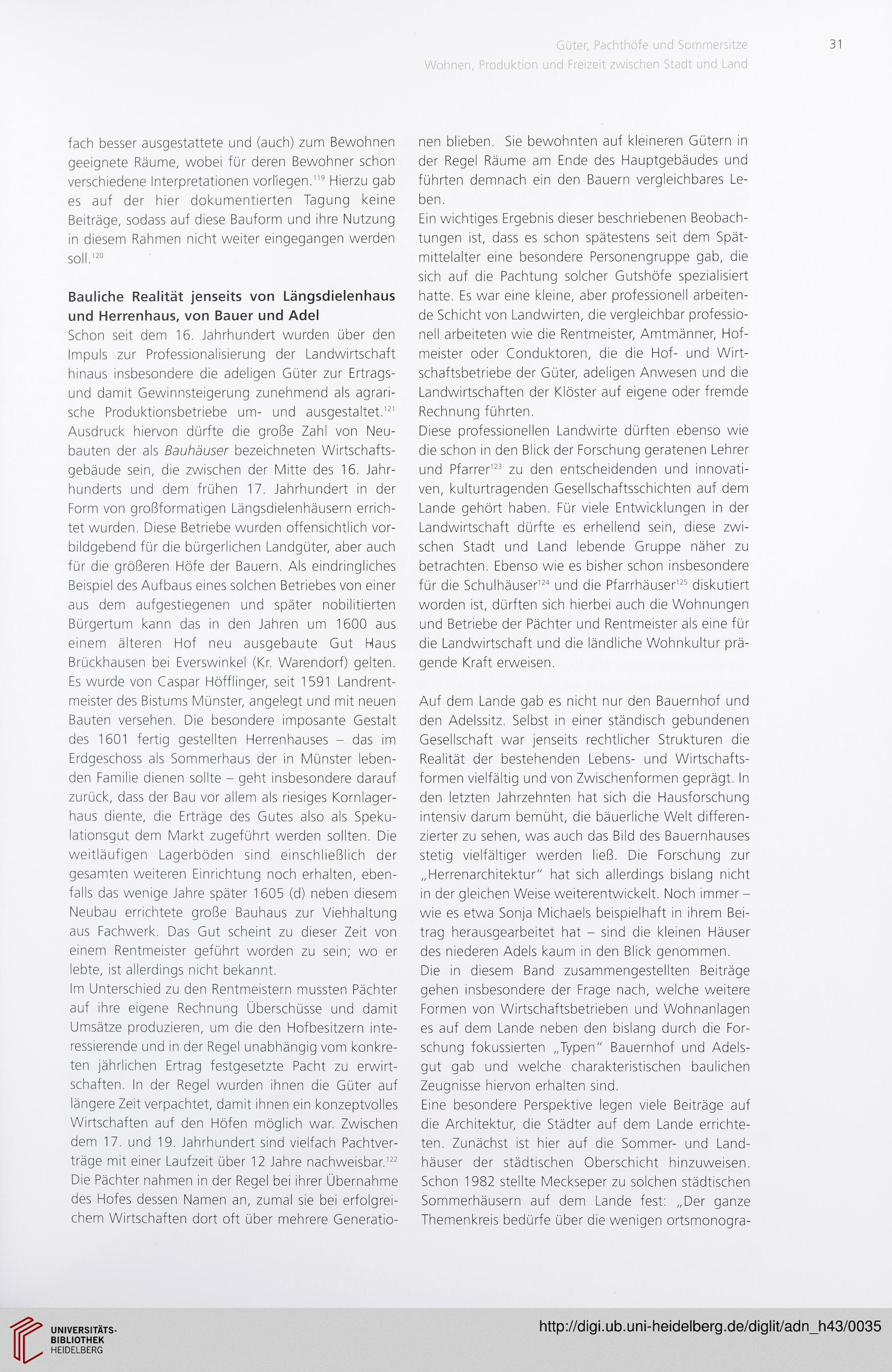Güter, Pachthöfe und Sommersitze
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
fach besser ausgestattete und (auch) zum Bewohnen
geeignete Räume, wobei für deren Bewohner schon
verschiedene Interpretationen vorliegen.119 Hierzu gab
es auf der hier dokumentierten Tagung keine
Beiträge, sodass auf diese Bauform und ihre Nutzung
in diesem Rahmen nicht weiter eingegangen werden
soll.120
Bauliche Realität jenseits von Längsdielenhaus
und Herrenhaus, von Bauer und Adel
Schon seit dem 16. Jahrhundert wurden über den
Impuls zur Professionalisierung der Landwirtschaft
hinaus insbesondere die adeligen Güter zur Ertrags-
und damit Gewinnsteigerung zunehmend als agrari-
sche Produktionsbetriebe um- und ausgestaltet.121
Ausdruck hiervon dürfte die große Zahl von Neu-
bauten der als Bauhäuser bezeichneten Wirtschafts-
gebäude sein, die zwischen der Mitte des 16. Jahr-
hunderts und dem frühen 17. Jahrhundert in der
Form von großformatigen Längsdielenhäusern errich-
tet wurden. Diese Betriebe wurden offensichtlich vor-
bildgebend für die bürgerlichen Landgüter, aber auch
für die größeren Höfe der Bauern. Als eindringliches
Beispiel des Aufbaus eines solchen Betriebes von einer
aus dem aufgestiegenen und später nobilitierten
Bürgertum kann das in den Jahren um 1600 aus
einem älteren Hof neu ausgebaute Gut Haus
Brückhausen bei Everswinkel (Kr. Warendorf) gelten.
Es wurde von Caspar Höfflinger, seit 1591 Landrent-
meister des Bistums Münster, angelegt und mit neuen
Bauten versehen. Die besondere imposante Gestalt
des 1601 fertig gestellten Herrenhauses - das im
Erdgeschoss als Sommerhaus der in Münster leben-
den Familie dienen sollte - geht insbesondere darauf
zurück, dass der Bau vor allem als riesiges Kornlager-
haus diente, die Erträge des Gutes also als Speku-
lationsgut dem Markt zugeführt werden sollten. Die
weitläufigen Lagerböden sind einschließlich der
gesamten weiteren Einrichtung noch erhalten, eben-
falls das wenige Jahre später 1605 (d) neben diesem
Neubau errichtete große Bauhaus zur Viehhaltung
aus Fachwerk. Das Gut scheint zu dieser Zeit von
einem Rentmeister geführt worden zu sein; wo er
lebte, ist allerdings nicht bekannt.
Im Unterschied zu den Rentmeistern mussten Pächter
auf ihre eigene Rechnung Überschüsse und damit
Umsätze produzieren, um die den Hofbesitzern inte-
ressierende und in der Regel unabhängig vom konkre-
ten jährlichen Ertrag festgesetzte Pacht zu erwirt-
schaften. In der Regel wurden ihnen die Güter auf
längere Zeit verpachtet, damit ihnen ein konzeptvolles
Wirtschaften auf den Höfen möglich war. Zwischen
dem 17. und 19. Jahrhundert sind vielfach Pachtver-
träge mit einer Laufzeit über 12 Jahre nachweisbar.122
Die Pächter nahmen in der Regel bei ihrer Übernahme
des Hofes dessen Namen an, zumal sie bei erfolgrei-
chem Wirtschaften dort oft über mehrere Generatio-
nen blieben. Sie bewohnten auf kleineren Gütern in
der Regel Räume am Ende des Hauptgebäudes und
führten demnach ein den Bauern vergleichbares Le-
ben.
Ein wichtiges Ergebnis dieser beschriebenen Beobach-
tungen ist, dass es schon spätestens seit dem Spät-
mittelalter eine besondere Personengruppe gab, die
sich auf die Pachtung solcher Gutshöfe spezialisiert
hatte. Es war eine kleine, aber professionell arbeiten-
de Schicht von Landwirten, die vergleichbar professio-
nell arbeiteten wie die Rentmeister, Amtmänner, Hof-
meister oder Conduktoren, die die Hof- und Wirt-
schaftsbetriebe der Güter, adeligen Anwesen und die
Landwirtschaften der Klöster auf eigene oder fremde
Rechnung führten.
Diese professionellen Landwirte dürften ebenso wie
die schon in den Blick der Forschung geratenen Lehrer
und Pfarrer123 zu den entscheidenden und innovati-
ven, kulturtragenden Gesellschaftsschichten auf dem
Lande gehört haben. Für viele Entwicklungen in der
Landwirtschaft dürfte es erhellend sein, diese zwi-
schen Stadt und Land lebende Gruppe näher zu
betrachten. Ebenso wie es bisher schon insbesondere
für die Schulhäuser124 und die Pfarrhäuser125 diskutiert
worden ist, dürften sich hierbei auch die Wohnungen
und Betriebe der Pächter und Rentmeister als eine für
die Landwirtschaft und die ländliche Wohnkultur prä-
gende Kraft erweisen.
Auf dem Lande gab es nicht nur den Bauernhof und
den Adelssitz. Selbst in einer ständisch gebundenen
Gesellschaft war jenseits rechtlicher Strukturen die
Realität der bestehenden Lebens- und Wirtschafts-
formen vielfältig und von Zwischenformen geprägt. In
den letzten Jahrzehnten hat sich die Hausforschung
intensiv darum bemüht, die bäuerliche Welt differen-
zierter zu sehen, was auch das Bild des Bauernhauses
stetig vielfältiger werden ließ. Die Forschung zur
„Herrenarchitektur" hat sich allerdings bislang nicht
in der gleichen Weise weiterentwickelt. Noch immer-
wie es etwa Sonja Michaels beispielhaft in ihrem Bei-
trag herausgearbeitet hat - sind die kleinen Häuser
des niederen Adels kaum in den Blick genommen.
Die in diesem Band zusammengestellten Beiträge
gehen insbesondere der Frage nach, welche weitere
Formen von Wirtschaftsbetrieben und Wohnanlagen
es auf dem Lande neben den bislang durch die For-
schung fokussierten „Typen" Bauernhof und Adels-
gut gab und welche charakteristischen baulichen
Zeugnisse hiervon erhalten sind.
Eine besondere Perspektive legen viele Beiträge auf
die Architektur, die Städter auf dem Lande errichte-
ten. Zunächst ist hier auf die Sommer- und Land-
häuser der städtischen Oberschicht hinzuweisen.
Schon 1982 stellte Meckseper zu solchen städtischen
Sommerhäusern auf dem Lande fest: „Der ganze
Themenkreis bedürfe über die wenigen ortsmonogra-
31
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
fach besser ausgestattete und (auch) zum Bewohnen
geeignete Räume, wobei für deren Bewohner schon
verschiedene Interpretationen vorliegen.119 Hierzu gab
es auf der hier dokumentierten Tagung keine
Beiträge, sodass auf diese Bauform und ihre Nutzung
in diesem Rahmen nicht weiter eingegangen werden
soll.120
Bauliche Realität jenseits von Längsdielenhaus
und Herrenhaus, von Bauer und Adel
Schon seit dem 16. Jahrhundert wurden über den
Impuls zur Professionalisierung der Landwirtschaft
hinaus insbesondere die adeligen Güter zur Ertrags-
und damit Gewinnsteigerung zunehmend als agrari-
sche Produktionsbetriebe um- und ausgestaltet.121
Ausdruck hiervon dürfte die große Zahl von Neu-
bauten der als Bauhäuser bezeichneten Wirtschafts-
gebäude sein, die zwischen der Mitte des 16. Jahr-
hunderts und dem frühen 17. Jahrhundert in der
Form von großformatigen Längsdielenhäusern errich-
tet wurden. Diese Betriebe wurden offensichtlich vor-
bildgebend für die bürgerlichen Landgüter, aber auch
für die größeren Höfe der Bauern. Als eindringliches
Beispiel des Aufbaus eines solchen Betriebes von einer
aus dem aufgestiegenen und später nobilitierten
Bürgertum kann das in den Jahren um 1600 aus
einem älteren Hof neu ausgebaute Gut Haus
Brückhausen bei Everswinkel (Kr. Warendorf) gelten.
Es wurde von Caspar Höfflinger, seit 1591 Landrent-
meister des Bistums Münster, angelegt und mit neuen
Bauten versehen. Die besondere imposante Gestalt
des 1601 fertig gestellten Herrenhauses - das im
Erdgeschoss als Sommerhaus der in Münster leben-
den Familie dienen sollte - geht insbesondere darauf
zurück, dass der Bau vor allem als riesiges Kornlager-
haus diente, die Erträge des Gutes also als Speku-
lationsgut dem Markt zugeführt werden sollten. Die
weitläufigen Lagerböden sind einschließlich der
gesamten weiteren Einrichtung noch erhalten, eben-
falls das wenige Jahre später 1605 (d) neben diesem
Neubau errichtete große Bauhaus zur Viehhaltung
aus Fachwerk. Das Gut scheint zu dieser Zeit von
einem Rentmeister geführt worden zu sein; wo er
lebte, ist allerdings nicht bekannt.
Im Unterschied zu den Rentmeistern mussten Pächter
auf ihre eigene Rechnung Überschüsse und damit
Umsätze produzieren, um die den Hofbesitzern inte-
ressierende und in der Regel unabhängig vom konkre-
ten jährlichen Ertrag festgesetzte Pacht zu erwirt-
schaften. In der Regel wurden ihnen die Güter auf
längere Zeit verpachtet, damit ihnen ein konzeptvolles
Wirtschaften auf den Höfen möglich war. Zwischen
dem 17. und 19. Jahrhundert sind vielfach Pachtver-
träge mit einer Laufzeit über 12 Jahre nachweisbar.122
Die Pächter nahmen in der Regel bei ihrer Übernahme
des Hofes dessen Namen an, zumal sie bei erfolgrei-
chem Wirtschaften dort oft über mehrere Generatio-
nen blieben. Sie bewohnten auf kleineren Gütern in
der Regel Räume am Ende des Hauptgebäudes und
führten demnach ein den Bauern vergleichbares Le-
ben.
Ein wichtiges Ergebnis dieser beschriebenen Beobach-
tungen ist, dass es schon spätestens seit dem Spät-
mittelalter eine besondere Personengruppe gab, die
sich auf die Pachtung solcher Gutshöfe spezialisiert
hatte. Es war eine kleine, aber professionell arbeiten-
de Schicht von Landwirten, die vergleichbar professio-
nell arbeiteten wie die Rentmeister, Amtmänner, Hof-
meister oder Conduktoren, die die Hof- und Wirt-
schaftsbetriebe der Güter, adeligen Anwesen und die
Landwirtschaften der Klöster auf eigene oder fremde
Rechnung führten.
Diese professionellen Landwirte dürften ebenso wie
die schon in den Blick der Forschung geratenen Lehrer
und Pfarrer123 zu den entscheidenden und innovati-
ven, kulturtragenden Gesellschaftsschichten auf dem
Lande gehört haben. Für viele Entwicklungen in der
Landwirtschaft dürfte es erhellend sein, diese zwi-
schen Stadt und Land lebende Gruppe näher zu
betrachten. Ebenso wie es bisher schon insbesondere
für die Schulhäuser124 und die Pfarrhäuser125 diskutiert
worden ist, dürften sich hierbei auch die Wohnungen
und Betriebe der Pächter und Rentmeister als eine für
die Landwirtschaft und die ländliche Wohnkultur prä-
gende Kraft erweisen.
Auf dem Lande gab es nicht nur den Bauernhof und
den Adelssitz. Selbst in einer ständisch gebundenen
Gesellschaft war jenseits rechtlicher Strukturen die
Realität der bestehenden Lebens- und Wirtschafts-
formen vielfältig und von Zwischenformen geprägt. In
den letzten Jahrzehnten hat sich die Hausforschung
intensiv darum bemüht, die bäuerliche Welt differen-
zierter zu sehen, was auch das Bild des Bauernhauses
stetig vielfältiger werden ließ. Die Forschung zur
„Herrenarchitektur" hat sich allerdings bislang nicht
in der gleichen Weise weiterentwickelt. Noch immer-
wie es etwa Sonja Michaels beispielhaft in ihrem Bei-
trag herausgearbeitet hat - sind die kleinen Häuser
des niederen Adels kaum in den Blick genommen.
Die in diesem Band zusammengestellten Beiträge
gehen insbesondere der Frage nach, welche weitere
Formen von Wirtschaftsbetrieben und Wohnanlagen
es auf dem Lande neben den bislang durch die For-
schung fokussierten „Typen" Bauernhof und Adels-
gut gab und welche charakteristischen baulichen
Zeugnisse hiervon erhalten sind.
Eine besondere Perspektive legen viele Beiträge auf
die Architektur, die Städter auf dem Lande errichte-
ten. Zunächst ist hier auf die Sommer- und Land-
häuser der städtischen Oberschicht hinzuweisen.
Schon 1982 stellte Meckseper zu solchen städtischen
Sommerhäusern auf dem Lande fest: „Der ganze
Themenkreis bedürfe über die wenigen ortsmonogra-
31