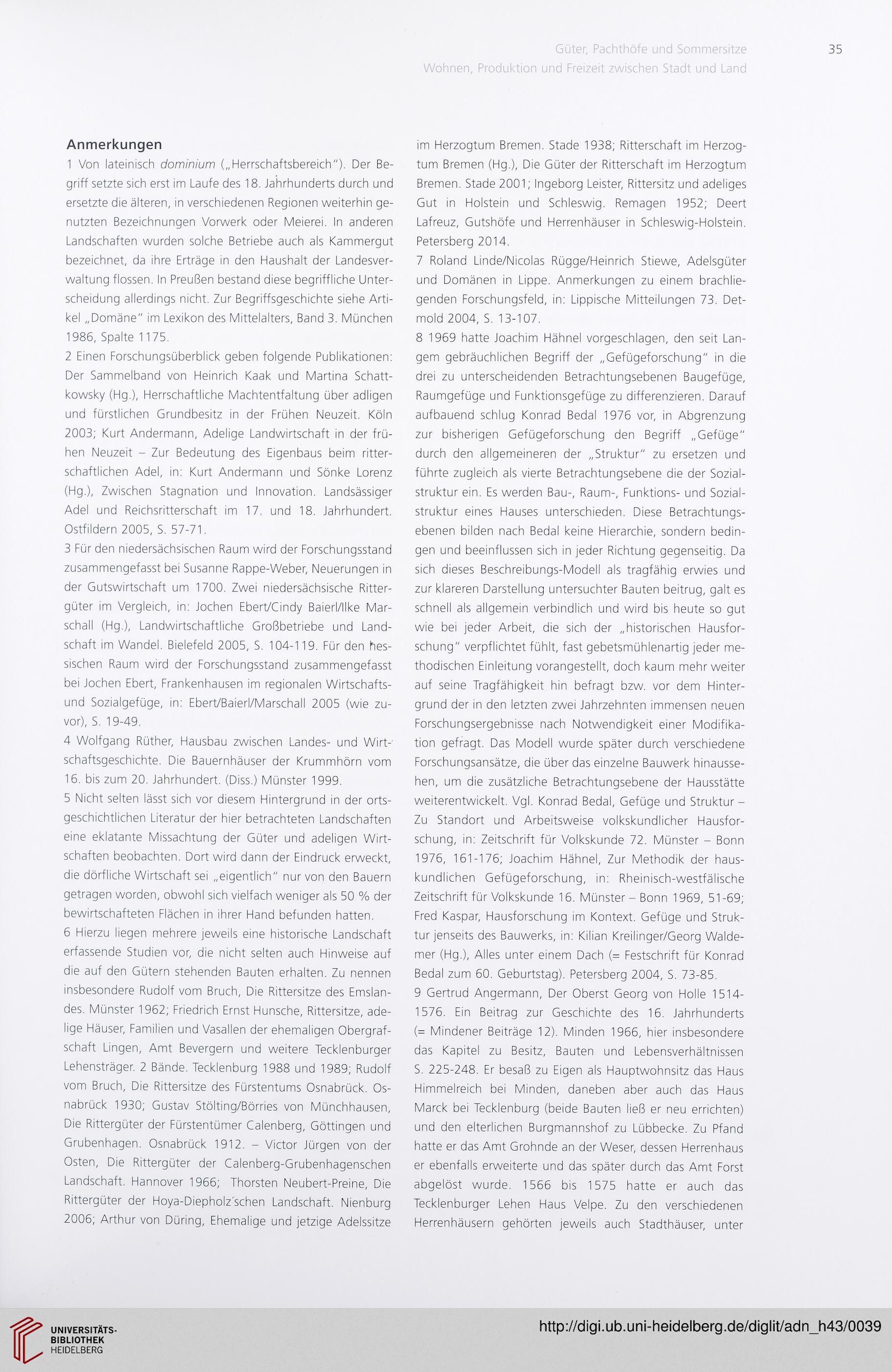Güter, Pachthöfe und Sommersitze
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
Anmerkungen
1 Von lateinisch dominium („Herrschaftsbereich"). Der Be-
griff setzte sich erst im Laufe des 18. Jahrhunderts durch und
ersetzte die älteren, in verschiedenen Regionen weiterhin ge-
nutzten Bezeichnungen Vorwerk oder Meierei. In anderen
Landschaften wurden solche Betriebe auch als Kammergut
bezeichnet, da ihre Erträge in den Haushalt der Landesver-
waltung flössen. In Preußen bestand diese begriffliche Unter-
scheidung allerdings nicht. Zur Begriffsgeschichte siehe Arti-
kel „Domäne" im Lexikon des Mittelalters, Band 3. München
1986, Spalte 1175.
2 Einen Forschungsüberblick geben folgende Publikationen:
Der Sammelband von Heinrich Kaak und Martina Schatt-
kowsky (Hg.), Herrschaftliche Machtentfaltung über adligen
und fürstlichen Grundbesitz in der Frühen Neuzeit. Köln
2003; Kurt Andermann, Adelige Landwirtschaft in der frü-
hen Neuzeit - Zur Bedeutung des Eigenbaus beim ritter-
schaftlichen Adel, in: Kurt Andermann und Sönke Lorenz
(Hg.), Zwischen Stagnation und Innovation. Landsässiger
Adel und Reichsritterschaft im 17. und 18. Jahrhundert.
Ostfildern 2005, S. 57-71.
3 Für den niedersächsischen Raum wird der Forschungsstand
zusammengefasst bei Susanne Rappe-Weber, Neuerungen in
der Gutswirtschaft um 1700. Zwei niedersächsische Ritter-
güter im Vergleich, in: Jochen Ebert/Cindy Baierl/Ilke Mar-
schall (Hg.), Landwirtschaftliche Großbetriebe und Land-
schaft im Wandel. Bielefeld 2005, S. 104-119. Für den hes-
sischen Raum wird der Forschungsstand zusammengefasst
bei Jochen Ebert, Frankenhausen im regionalen Wirtschafts-
und Sozialgefüge, in: Ebert/Baierl/Marschall 2005 (wie zu-
vor), S. 19-49.
4 Wolfgang Rüther, Hausbau zwischen Landes- und Wirt-
schaftsgeschichte. Die Bauernhäuser der Krummhörn vom
16. bis zum 20. Jahrhundert. (Diss.) Münster 1999.
5 Nicht selten lässt sich vor diesem Hintergrund in der orts-
geschichtlichen Literatur der hier betrachteten Landschaften
eine eklatante Missachtung der Güter und adeligen Wirt-
schaften beobachten. Dort wird dann der Eindruck erweckt,
die dörfliche Wirtschaft sei „eigentlich" nur von den Bauern
getragen worden, obwohl sich vielfach weniger als 50 % der
bewirtschafteten Flächen in ihrer Hand befunden hatten.
6 Hierzu liegen mehrere jeweils eine historische Landschaft
erfassende Studien vor, die nicht selten auch Hinweise auf
die auf den Gütern stehenden Bauten erhalten. Zu nennen
insbesondere Rudolf vom Bruch, Die Rittersitze des Emslan-
des. Münster 1962; Friedrich Ernst Hunsche, Rittersitze, ade-
lige Häuser, Familien und Vasallen der ehemaligen Obergraf-
schaft Lingen, Amt Bevergern und weitere Tecklenburger
Lehensträger. 2 Bände. Tecklenburg 1988 und 1989; Rudolf
vom Bruch, Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück. Os-
nabrück 1930; Gustav Stölting/Börries von Münchhausen,
Die Rittergüter der Fürstentümer Calenberg, Göttingen und
Grubenhagen. Osnabrück 1912. - Victor Jürgen von der
Osten, Die Rittergüter der Calenberg-Grubenhagenschen
Landschaft. Hannover 1966; Thorsten Neubert-Preine, Die
Rittergüter der Hoya-Diepholz'schen Landschaft. Nienburg
2006; Arthur von Düring, Ehemalige und jetzige Adelssitze
im Herzogtum Bremen. Stade 1938; Ritterschaft im Herzog-
tum Bremen (Hg.), Die Güter der Ritterschaft im Herzogtum
Bremen. Stade 2001; Ingeborg Leister, Rittersitz und adeliges
Gut in Holstein und Schleswig. Remagen 1952; Deert
Lafreuz, Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein.
Petersberg 2014.
7 Roland Linde/Nicolas Rügge/Heinrich Stiewe, Adelsgüter
und Domänen in Lippe. Anmerkungen zu einem brachlie-
genden Forschungsfeld, in: Lippische Mitteilungen 73. Det-
mold 2004, S. 13-107.
8 1969 hatte Joachim Hähnel vorgeschlagen, den seit Lan-
gem gebräuchlichen Begriff der „Gefügeforschung" in die
drei zu unterscheidenden Betrachtungsebenen Baugefüge,
Raumgefüge und Funktionsgefüge zu differenzieren. Darauf
aufbauend schlug Konrad Bedal 1976 vor, in Abgrenzung
zur bisherigen Gefügeforschung den Begriff „Gefüge"
durch den allgemeineren der „Struktur" zu ersetzen und
führte zugleich als vierte Betrachtungsebene die der Sozial-
struktur ein. Es werden Bau-, Raum-, Funktions- und Sozial-
struktur eines Hauses unterschieden. Diese Betrachtungs-
ebenen bilden nach Bedal keine Hierarchie, sondern bedin-
gen und beeinflussen sich in jeder Richtung gegenseitig. Da
sich dieses Beschreibungs-Modell als tragfähig erwies und
zur klareren Darstellung untersuchter Bauten beitrug, galt es
schnell als allgemein verbindlich und wird bis heute so gut
wie bei jeder Arbeit, die sich der „historischen Hausfor-
schung" verpflichtet fühlt, fast gebetsmühlenartig jeder me-
thodischen Einleitung vorangestellt, doch kaum mehr weiter
auf seine Tragfähigkeit hin befragt bzw. vor dem Hinter-
grund der in den letzten zwei Jahrzehnten immensen neuen
Forschungsergebnisse nach Notwendigkeit einer Modifika-
tion gefragt. Das Modell wurde später durch verschiedene
Forschungsansätze, die über das einzelne Bauwerk hinausse-
hen, um die zusätzliche Betrachtungsebene der Hausstätte
weiterentwickelt. Vgl. Konrad Bedal, Gefüge und Struktur-
Zu Standort und Arbeitsweise volkskundlicher Hausfor-
schung, in: Zeitschrift für Volkskunde 72. Münster - Bonn
1976, 161-176; Joachim Hähnel, Zur Methodik der haus-
kundlichen Gefügeforschung, in: Rheinisch-westfälische
Zeitschrift für Volkskunde 16. Münster - Bonn 1969, 51-69;
Fred Kaspar, Hausforschung im Kontext. Gefüge und Struk-
tur jenseits des Bauwerks, in: Kilian Kreilinger/Georg Walde-
mer (Hg.), Alles unter einem Dach (= Festschrift für Konrad
Bedal zum 60. Geburtstag). Petersberg 2004, S. 73-85.
9 Gertrud Angermann, Der Oberst Georg von Holle 1514-
1576. Ein Beitrag zur Geschichte des 16. Jahrhunderts
(= Mindener Beiträge 12). Minden 1966, hier insbesondere
das Kapitel zu Besitz, Bauten und Lebensverhältnissen
S. 225-248. Er besaß zu Eigen als Hauptwohnsitz das Haus
Himmelreich bei Minden, daneben aber auch das Haus
Marek bei Tecklenburg (beide Bauten ließ er neu errichten)
und den elterlichen Burgmannshof zu Lübbecke. Zu Pfand
hatte er das Amt Grohnde an der Weser, dessen Herrenhaus
er ebenfalls erweiterte und das später durch das Amt Forst
abgelöst wurde. 1566 bis 1575 hatte er auch das
Tecklenburger Lehen Haus Velpe. Zu den verschiedenen
Herrenhäusern gehörten jeweils auch Stadthäuser, unter
35
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
Anmerkungen
1 Von lateinisch dominium („Herrschaftsbereich"). Der Be-
griff setzte sich erst im Laufe des 18. Jahrhunderts durch und
ersetzte die älteren, in verschiedenen Regionen weiterhin ge-
nutzten Bezeichnungen Vorwerk oder Meierei. In anderen
Landschaften wurden solche Betriebe auch als Kammergut
bezeichnet, da ihre Erträge in den Haushalt der Landesver-
waltung flössen. In Preußen bestand diese begriffliche Unter-
scheidung allerdings nicht. Zur Begriffsgeschichte siehe Arti-
kel „Domäne" im Lexikon des Mittelalters, Band 3. München
1986, Spalte 1175.
2 Einen Forschungsüberblick geben folgende Publikationen:
Der Sammelband von Heinrich Kaak und Martina Schatt-
kowsky (Hg.), Herrschaftliche Machtentfaltung über adligen
und fürstlichen Grundbesitz in der Frühen Neuzeit. Köln
2003; Kurt Andermann, Adelige Landwirtschaft in der frü-
hen Neuzeit - Zur Bedeutung des Eigenbaus beim ritter-
schaftlichen Adel, in: Kurt Andermann und Sönke Lorenz
(Hg.), Zwischen Stagnation und Innovation. Landsässiger
Adel und Reichsritterschaft im 17. und 18. Jahrhundert.
Ostfildern 2005, S. 57-71.
3 Für den niedersächsischen Raum wird der Forschungsstand
zusammengefasst bei Susanne Rappe-Weber, Neuerungen in
der Gutswirtschaft um 1700. Zwei niedersächsische Ritter-
güter im Vergleich, in: Jochen Ebert/Cindy Baierl/Ilke Mar-
schall (Hg.), Landwirtschaftliche Großbetriebe und Land-
schaft im Wandel. Bielefeld 2005, S. 104-119. Für den hes-
sischen Raum wird der Forschungsstand zusammengefasst
bei Jochen Ebert, Frankenhausen im regionalen Wirtschafts-
und Sozialgefüge, in: Ebert/Baierl/Marschall 2005 (wie zu-
vor), S. 19-49.
4 Wolfgang Rüther, Hausbau zwischen Landes- und Wirt-
schaftsgeschichte. Die Bauernhäuser der Krummhörn vom
16. bis zum 20. Jahrhundert. (Diss.) Münster 1999.
5 Nicht selten lässt sich vor diesem Hintergrund in der orts-
geschichtlichen Literatur der hier betrachteten Landschaften
eine eklatante Missachtung der Güter und adeligen Wirt-
schaften beobachten. Dort wird dann der Eindruck erweckt,
die dörfliche Wirtschaft sei „eigentlich" nur von den Bauern
getragen worden, obwohl sich vielfach weniger als 50 % der
bewirtschafteten Flächen in ihrer Hand befunden hatten.
6 Hierzu liegen mehrere jeweils eine historische Landschaft
erfassende Studien vor, die nicht selten auch Hinweise auf
die auf den Gütern stehenden Bauten erhalten. Zu nennen
insbesondere Rudolf vom Bruch, Die Rittersitze des Emslan-
des. Münster 1962; Friedrich Ernst Hunsche, Rittersitze, ade-
lige Häuser, Familien und Vasallen der ehemaligen Obergraf-
schaft Lingen, Amt Bevergern und weitere Tecklenburger
Lehensträger. 2 Bände. Tecklenburg 1988 und 1989; Rudolf
vom Bruch, Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück. Os-
nabrück 1930; Gustav Stölting/Börries von Münchhausen,
Die Rittergüter der Fürstentümer Calenberg, Göttingen und
Grubenhagen. Osnabrück 1912. - Victor Jürgen von der
Osten, Die Rittergüter der Calenberg-Grubenhagenschen
Landschaft. Hannover 1966; Thorsten Neubert-Preine, Die
Rittergüter der Hoya-Diepholz'schen Landschaft. Nienburg
2006; Arthur von Düring, Ehemalige und jetzige Adelssitze
im Herzogtum Bremen. Stade 1938; Ritterschaft im Herzog-
tum Bremen (Hg.), Die Güter der Ritterschaft im Herzogtum
Bremen. Stade 2001; Ingeborg Leister, Rittersitz und adeliges
Gut in Holstein und Schleswig. Remagen 1952; Deert
Lafreuz, Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein.
Petersberg 2014.
7 Roland Linde/Nicolas Rügge/Heinrich Stiewe, Adelsgüter
und Domänen in Lippe. Anmerkungen zu einem brachlie-
genden Forschungsfeld, in: Lippische Mitteilungen 73. Det-
mold 2004, S. 13-107.
8 1969 hatte Joachim Hähnel vorgeschlagen, den seit Lan-
gem gebräuchlichen Begriff der „Gefügeforschung" in die
drei zu unterscheidenden Betrachtungsebenen Baugefüge,
Raumgefüge und Funktionsgefüge zu differenzieren. Darauf
aufbauend schlug Konrad Bedal 1976 vor, in Abgrenzung
zur bisherigen Gefügeforschung den Begriff „Gefüge"
durch den allgemeineren der „Struktur" zu ersetzen und
führte zugleich als vierte Betrachtungsebene die der Sozial-
struktur ein. Es werden Bau-, Raum-, Funktions- und Sozial-
struktur eines Hauses unterschieden. Diese Betrachtungs-
ebenen bilden nach Bedal keine Hierarchie, sondern bedin-
gen und beeinflussen sich in jeder Richtung gegenseitig. Da
sich dieses Beschreibungs-Modell als tragfähig erwies und
zur klareren Darstellung untersuchter Bauten beitrug, galt es
schnell als allgemein verbindlich und wird bis heute so gut
wie bei jeder Arbeit, die sich der „historischen Hausfor-
schung" verpflichtet fühlt, fast gebetsmühlenartig jeder me-
thodischen Einleitung vorangestellt, doch kaum mehr weiter
auf seine Tragfähigkeit hin befragt bzw. vor dem Hinter-
grund der in den letzten zwei Jahrzehnten immensen neuen
Forschungsergebnisse nach Notwendigkeit einer Modifika-
tion gefragt. Das Modell wurde später durch verschiedene
Forschungsansätze, die über das einzelne Bauwerk hinausse-
hen, um die zusätzliche Betrachtungsebene der Hausstätte
weiterentwickelt. Vgl. Konrad Bedal, Gefüge und Struktur-
Zu Standort und Arbeitsweise volkskundlicher Hausfor-
schung, in: Zeitschrift für Volkskunde 72. Münster - Bonn
1976, 161-176; Joachim Hähnel, Zur Methodik der haus-
kundlichen Gefügeforschung, in: Rheinisch-westfälische
Zeitschrift für Volkskunde 16. Münster - Bonn 1969, 51-69;
Fred Kaspar, Hausforschung im Kontext. Gefüge und Struk-
tur jenseits des Bauwerks, in: Kilian Kreilinger/Georg Walde-
mer (Hg.), Alles unter einem Dach (= Festschrift für Konrad
Bedal zum 60. Geburtstag). Petersberg 2004, S. 73-85.
9 Gertrud Angermann, Der Oberst Georg von Holle 1514-
1576. Ein Beitrag zur Geschichte des 16. Jahrhunderts
(= Mindener Beiträge 12). Minden 1966, hier insbesondere
das Kapitel zu Besitz, Bauten und Lebensverhältnissen
S. 225-248. Er besaß zu Eigen als Hauptwohnsitz das Haus
Himmelreich bei Minden, daneben aber auch das Haus
Marek bei Tecklenburg (beide Bauten ließ er neu errichten)
und den elterlichen Burgmannshof zu Lübbecke. Zu Pfand
hatte er das Amt Grohnde an der Weser, dessen Herrenhaus
er ebenfalls erweiterte und das später durch das Amt Forst
abgelöst wurde. 1566 bis 1575 hatte er auch das
Tecklenburger Lehen Haus Velpe. Zu den verschiedenen
Herrenhäusern gehörten jeweils auch Stadthäuser, unter
35