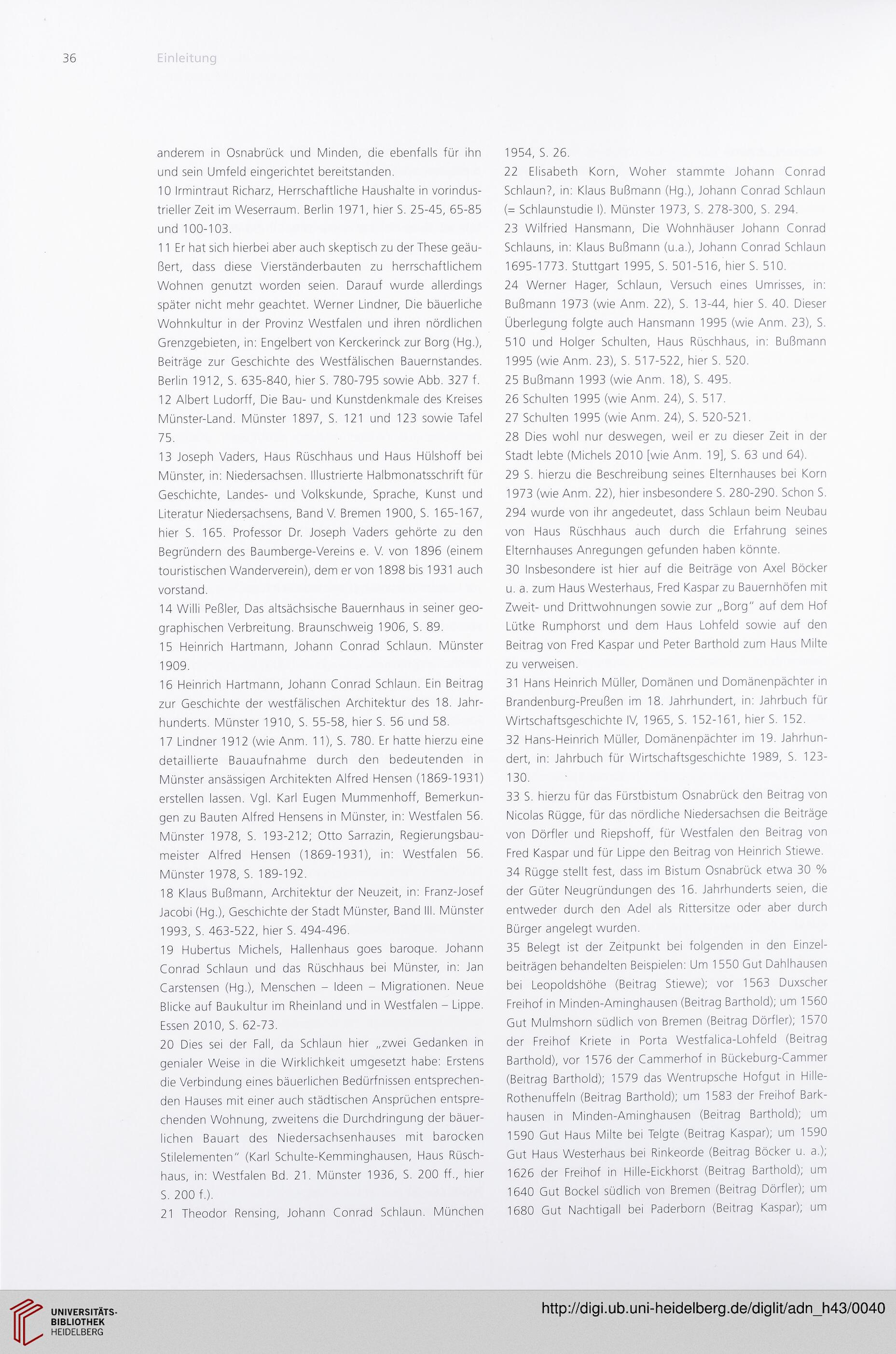36
Einleitung
anderem in Osnabrück und Minden, die ebenfalls für ihn
und sein Umfeld eingerichtet bereitstanden.
10 Irmintraut Richarz, Herrschaftliche Haushalte in vorindus-
trieller Zeit im Weserraum. Berlin 1971, hier S. 25-45, 65-85
und 100-103.
11 Er hat sich hierbei aber auch skeptisch zu der These geäu-
ßert, dass diese Vierständerbauten zu herrschaftlichem
Wohnen genutzt worden seien. Darauf wurde allerdings
später nicht mehr geachtet. Werner Lindner, Die bäuerliche
Wohnkultur in der Provinz Westfalen und ihren nördlichen
Grenzgebieten, in: Engelbert von Kerckerinck zur Borg (Hg.),
Beiträge zur Geschichte des Westfälischen Bauernstandes.
Berlin 1912, S. 635-840, hier S. 780-795 sowie Abb. 327 f.
12 Albert Ludorff, Die Bau- und Kunstdenkmale des Kreises
Münster-Land. Münster 1897, S. 121 und 123 sowie Tafel
75.
13 Joseph Vaders, Haus Rüschhaus und Haus Hülshoff bei
Münster, in: Niedersachsen. Illustrierte Halbmonatsschrift für
Geschichte, Landes- und Volkskunde, Sprache, Kunst und
Literatur Niedersachsens, Band V. Bremen 1900, S. 165-167,
hier S. 165. Professor Dr. Joseph Vaders gehörte zu den
Begründern des Baumberge-Vereins e. V. von 1896 (einem
touristischenWanderverein), dem er von 1898 bis 1931 auch
vorstand.
14 Willi Peßler, Das altsächsische Bauernhaus in seiner geo-
graphischen Verbreitung. Braunschweig 1906, S. 89.
15 Heinrich Hartmann, Johann Conrad Schlaun. Münster
1909.
16 Heinrich Hartmann, Johann Conrad Schlaun. Ein Beitrag
zur Geschichte der westfälischen Architektur des 18. Jahr-
hunderts. Münster 1910, S. 55-58, hier S. 56 und 58.
17 Lindner 1912 (wie Anm. 11), S. 780. Er hatte hierzu eine
detaillierte Bauaufnahme durch den bedeutenden in
Münster ansässigen Architekten Alfred Hensen (1869-1931)
erstellen lassen. Vgl. Karl Eugen Mummenhoff, Bemerkun-
gen zu Bauten Alfred Hensens in Münster, in: Westfalen 56.
Münster 1978, S. 193-212; Otto Sarrazin, Regierungsbau-
meister Alfred Hensen (1869-1931), in: Westfalen 56.
Münster 1978, S. 189-192.
18 Klaus Bußmann, Architektur der Neuzeit, in: Franz-Josef
Jacobi (Hg.), Geschichte der Stadt Münster, Band III. Münster
1993, S. 463-522, hier S. 494-496.
19 Hubertus Michels, Hallenhaus goes baroque. Johann
Conrad Schlaun und das Rüschhaus bei Münster, in: Jan
Carstensen (Hg.), Menschen - Ideen - Migrationen. Neue
Blicke auf Baukultur im Rheinland und in Westfalen - Lippe.
Essen 2010, S. 62-73.
20 Dies sei der Fall, da Schlaun hier „zwei Gedanken in
genialer Weise in die Wirklichkeit umgesetzt habe: Erstens
die Verbindung eines bäuerlichen Bedürfnissen entsprechen-
den Hauses mit einer auch städtischen Ansprüchen entspre-
chenden Wohnung, zweitens die Durchdringung der bäuer-
lichen Bauart des Niedersachsenhauses mit barocken
Stilelementen" (Karl Schulte-Kemminghausen, Haus Rüsch-
haus, in: Westfalen Bd. 21. Münster 1936, S. 200 ff., hier
S. 200 f.).
21 Theodor Rensing, Johann Conrad Schlaun. München
1954, S. 26.
22 Elisabeth Korn, Woher stammte Johann Conrad
Schlaun?, in: Klaus Bußmann (Hg.), Johann Conrad Schlaun
(= Schlaunstudie I). Münster 1973, S. 278-300, S. 294.
23 Wilfried Hansmann, Die Wohnhäuser Johann Conrad
Schlauns, in: Klaus Bußmann (u.a.), Johann Conrad Schlaun
1695-1773. Stuttgart 1995, S. 501-516, hier S. 510.
24 Werner Hager, Schlaun, Versuch eines Umrisses, in:
Bußmann 1973 (wie Anm. 22), S. 13-44, hier S. 40. Dieser
Überlegung folgte auch Hansmann 1995 (wie Anm. 23), S.
510 und Holger Schulten, Haus Rüschhaus, in: Bußmann
1995 (wie Anm. 23), S. 517-522, hier S. 520.
25 Bußmann 1993 (wie Anm. 18), S. 495.
26 Schulten 1995 (wie Anm. 24), S. 517.
27 Schulten 1995 (wie Anm. 24), S. 520-521.
28 Dies wohl nur deswegen, weil er zu dieser Zeit in der
Stadt lebte (Michels 2010 [wie Anm. 19], S. 63 und 64).
29 S. hierzu die Beschreibung seines Elternhauses bei Korn
1973 (wie Anm. 22), hier insbesondere S. 280-290. Schon S.
294 wurde von ihr angedeutet, dass Schlaun beim Neubau
von Haus Rüschhaus auch durch die Erfahrung seines
Elternhauses Anregungen gefunden haben könnte.
30 Insbesondere ist hier auf die Beiträge von Axel Böcker
u. a. zum Haus Westerhaus, Fred Kaspar zu Bauernhöfen mit
Zweit- und Drittwohnungen sowie zur „Borg" auf dem Hof
Lütke Rumphorst und dem Haus Lohfeld sowie auf den
Beitrag von Fred Kaspar und Peter Barthold zum Haus Milte
zu verweisen.
31 Hans Heinrich Müller, Domänen und Domänenpächter in
Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für
Wirtschaftsgeschichte IV, 1965, S. 152-161, hier S. 152.
32 Hans-Heinrich Müller, Domänenpächter im 19. Jahrhun-
dert, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1989, S. 123-
130.
33 S. hierzu für das Fürstbistum Osnabrück den Beitrag von
Nicolas Rügge, für das nördliche Niedersachsen die Beiträge
von Dörfler und Riepshoff, für Westfalen den Beitrag von
Fred Kaspar und für Lippe den Beitrag von Heinrich Stiewe.
34 Rügge stellt fest, dass im Bistum Osnabrück etwa 30 %
der Güter Neugründungen des 16. Jahrhunderts seien, die
entweder durch den Adel als Rittersitze oder aber durch
Bürger angelegt wurden.
35 Belegt ist der Zeitpunkt bei folgenden in den Einzel-
beiträgen behandelten Beispielen: Um 1550 Gut Dahlhausen
bei Leopoldshöhe (Beitrag Stiewe); vor 1563 Duxscher
Freihof in Minden-Aminghausen (Beitrag Barthold); um 1560
Gut Mulmshorn südlich von Bremen (Beitrag Dörfler); 1570
der Freihof Kriete in Porta Westfalica-Lohfeld (Beitrag
Barthold), vor 1576 der Cammerhof in Bückeburg-Cammer
(Beitrag Barthold); 1579 das Wentrupsche Hofgut in Hille-
Rothenuffeln (Beitrag Barthold); um 1583 der Freihof Bark-
hausen in Minden-Aminghausen (Beitrag Barthold); um
1590 Gut Haus Milte bei Telgte (Beitrag Kaspar); um 1590
Gut Haus Westerhaus bei Rinkeorde (Beitrag Böcker u. a.);
1626 der Freihof in Hille-Eickhorst (Beitrag Barthoid); um
1640 Gut Bockei südlich von Bremen (Beitrag Dörfler); um
1680 Gut Nachtigall bei Paderborn (Beitrag Kaspar); um
Einleitung
anderem in Osnabrück und Minden, die ebenfalls für ihn
und sein Umfeld eingerichtet bereitstanden.
10 Irmintraut Richarz, Herrschaftliche Haushalte in vorindus-
trieller Zeit im Weserraum. Berlin 1971, hier S. 25-45, 65-85
und 100-103.
11 Er hat sich hierbei aber auch skeptisch zu der These geäu-
ßert, dass diese Vierständerbauten zu herrschaftlichem
Wohnen genutzt worden seien. Darauf wurde allerdings
später nicht mehr geachtet. Werner Lindner, Die bäuerliche
Wohnkultur in der Provinz Westfalen und ihren nördlichen
Grenzgebieten, in: Engelbert von Kerckerinck zur Borg (Hg.),
Beiträge zur Geschichte des Westfälischen Bauernstandes.
Berlin 1912, S. 635-840, hier S. 780-795 sowie Abb. 327 f.
12 Albert Ludorff, Die Bau- und Kunstdenkmale des Kreises
Münster-Land. Münster 1897, S. 121 und 123 sowie Tafel
75.
13 Joseph Vaders, Haus Rüschhaus und Haus Hülshoff bei
Münster, in: Niedersachsen. Illustrierte Halbmonatsschrift für
Geschichte, Landes- und Volkskunde, Sprache, Kunst und
Literatur Niedersachsens, Band V. Bremen 1900, S. 165-167,
hier S. 165. Professor Dr. Joseph Vaders gehörte zu den
Begründern des Baumberge-Vereins e. V. von 1896 (einem
touristischenWanderverein), dem er von 1898 bis 1931 auch
vorstand.
14 Willi Peßler, Das altsächsische Bauernhaus in seiner geo-
graphischen Verbreitung. Braunschweig 1906, S. 89.
15 Heinrich Hartmann, Johann Conrad Schlaun. Münster
1909.
16 Heinrich Hartmann, Johann Conrad Schlaun. Ein Beitrag
zur Geschichte der westfälischen Architektur des 18. Jahr-
hunderts. Münster 1910, S. 55-58, hier S. 56 und 58.
17 Lindner 1912 (wie Anm. 11), S. 780. Er hatte hierzu eine
detaillierte Bauaufnahme durch den bedeutenden in
Münster ansässigen Architekten Alfred Hensen (1869-1931)
erstellen lassen. Vgl. Karl Eugen Mummenhoff, Bemerkun-
gen zu Bauten Alfred Hensens in Münster, in: Westfalen 56.
Münster 1978, S. 193-212; Otto Sarrazin, Regierungsbau-
meister Alfred Hensen (1869-1931), in: Westfalen 56.
Münster 1978, S. 189-192.
18 Klaus Bußmann, Architektur der Neuzeit, in: Franz-Josef
Jacobi (Hg.), Geschichte der Stadt Münster, Band III. Münster
1993, S. 463-522, hier S. 494-496.
19 Hubertus Michels, Hallenhaus goes baroque. Johann
Conrad Schlaun und das Rüschhaus bei Münster, in: Jan
Carstensen (Hg.), Menschen - Ideen - Migrationen. Neue
Blicke auf Baukultur im Rheinland und in Westfalen - Lippe.
Essen 2010, S. 62-73.
20 Dies sei der Fall, da Schlaun hier „zwei Gedanken in
genialer Weise in die Wirklichkeit umgesetzt habe: Erstens
die Verbindung eines bäuerlichen Bedürfnissen entsprechen-
den Hauses mit einer auch städtischen Ansprüchen entspre-
chenden Wohnung, zweitens die Durchdringung der bäuer-
lichen Bauart des Niedersachsenhauses mit barocken
Stilelementen" (Karl Schulte-Kemminghausen, Haus Rüsch-
haus, in: Westfalen Bd. 21. Münster 1936, S. 200 ff., hier
S. 200 f.).
21 Theodor Rensing, Johann Conrad Schlaun. München
1954, S. 26.
22 Elisabeth Korn, Woher stammte Johann Conrad
Schlaun?, in: Klaus Bußmann (Hg.), Johann Conrad Schlaun
(= Schlaunstudie I). Münster 1973, S. 278-300, S. 294.
23 Wilfried Hansmann, Die Wohnhäuser Johann Conrad
Schlauns, in: Klaus Bußmann (u.a.), Johann Conrad Schlaun
1695-1773. Stuttgart 1995, S. 501-516, hier S. 510.
24 Werner Hager, Schlaun, Versuch eines Umrisses, in:
Bußmann 1973 (wie Anm. 22), S. 13-44, hier S. 40. Dieser
Überlegung folgte auch Hansmann 1995 (wie Anm. 23), S.
510 und Holger Schulten, Haus Rüschhaus, in: Bußmann
1995 (wie Anm. 23), S. 517-522, hier S. 520.
25 Bußmann 1993 (wie Anm. 18), S. 495.
26 Schulten 1995 (wie Anm. 24), S. 517.
27 Schulten 1995 (wie Anm. 24), S. 520-521.
28 Dies wohl nur deswegen, weil er zu dieser Zeit in der
Stadt lebte (Michels 2010 [wie Anm. 19], S. 63 und 64).
29 S. hierzu die Beschreibung seines Elternhauses bei Korn
1973 (wie Anm. 22), hier insbesondere S. 280-290. Schon S.
294 wurde von ihr angedeutet, dass Schlaun beim Neubau
von Haus Rüschhaus auch durch die Erfahrung seines
Elternhauses Anregungen gefunden haben könnte.
30 Insbesondere ist hier auf die Beiträge von Axel Böcker
u. a. zum Haus Westerhaus, Fred Kaspar zu Bauernhöfen mit
Zweit- und Drittwohnungen sowie zur „Borg" auf dem Hof
Lütke Rumphorst und dem Haus Lohfeld sowie auf den
Beitrag von Fred Kaspar und Peter Barthold zum Haus Milte
zu verweisen.
31 Hans Heinrich Müller, Domänen und Domänenpächter in
Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für
Wirtschaftsgeschichte IV, 1965, S. 152-161, hier S. 152.
32 Hans-Heinrich Müller, Domänenpächter im 19. Jahrhun-
dert, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1989, S. 123-
130.
33 S. hierzu für das Fürstbistum Osnabrück den Beitrag von
Nicolas Rügge, für das nördliche Niedersachsen die Beiträge
von Dörfler und Riepshoff, für Westfalen den Beitrag von
Fred Kaspar und für Lippe den Beitrag von Heinrich Stiewe.
34 Rügge stellt fest, dass im Bistum Osnabrück etwa 30 %
der Güter Neugründungen des 16. Jahrhunderts seien, die
entweder durch den Adel als Rittersitze oder aber durch
Bürger angelegt wurden.
35 Belegt ist der Zeitpunkt bei folgenden in den Einzel-
beiträgen behandelten Beispielen: Um 1550 Gut Dahlhausen
bei Leopoldshöhe (Beitrag Stiewe); vor 1563 Duxscher
Freihof in Minden-Aminghausen (Beitrag Barthold); um 1560
Gut Mulmshorn südlich von Bremen (Beitrag Dörfler); 1570
der Freihof Kriete in Porta Westfalica-Lohfeld (Beitrag
Barthold), vor 1576 der Cammerhof in Bückeburg-Cammer
(Beitrag Barthold); 1579 das Wentrupsche Hofgut in Hille-
Rothenuffeln (Beitrag Barthold); um 1583 der Freihof Bark-
hausen in Minden-Aminghausen (Beitrag Barthold); um
1590 Gut Haus Milte bei Telgte (Beitrag Kaspar); um 1590
Gut Haus Westerhaus bei Rinkeorde (Beitrag Böcker u. a.);
1626 der Freihof in Hille-Eickhorst (Beitrag Barthoid); um
1640 Gut Bockei südlich von Bremen (Beitrag Dörfler); um
1680 Gut Nachtigall bei Paderborn (Beitrag Kaspar); um