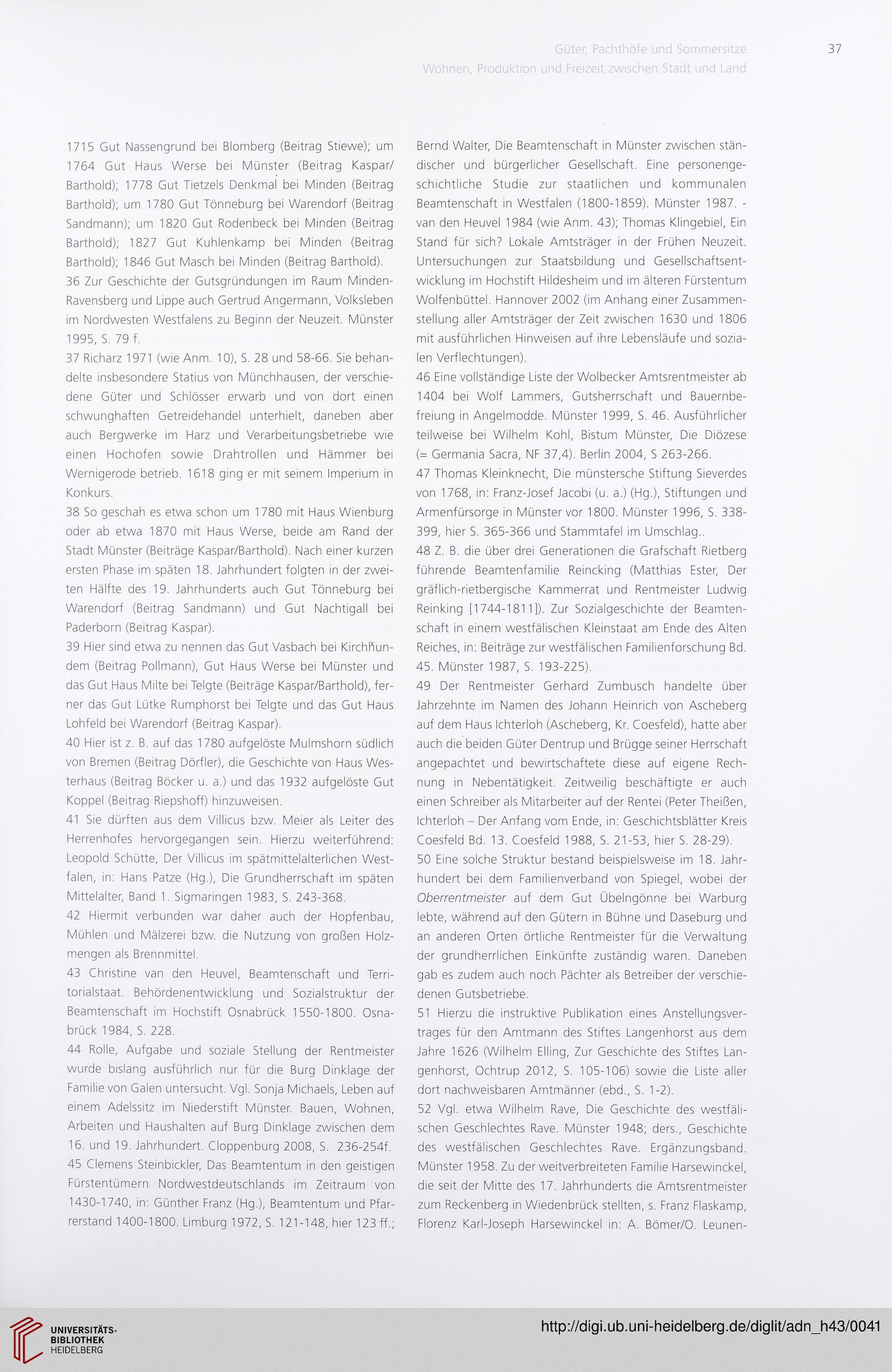Güter, Pachthöfe und Sommersitze
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
1715 Gut Nassengrund bei Blomberg (Beitrag Stiewe); um
1764 Gut Haus Werse bei Münster (Beitrag Kaspar/
Barthold); 1778 Gut Tietzels Denkmal bei Minden (Beitrag
Barthold); um 1780 Gut Tönneburg bei Warendorf (Beitrag
Sandmann); um 1820 Gut Rodenbeck bei Minden (Beitrag
Barthold); 1827 Gut Kuhlenkamp bei Minden (Beitrag
Barthold); 1846 Gut Masch bei Minden (Beitrag Barthold).
36 Zur Geschichte der Gutsgründungen im Raum Minden-
Ravensberg und Lippe auch Gertrud Angermann, Volksleben
im Nordwesten Westfalens zu Beginn der Neuzeit. Münster
1995, S. 79 f.
37 Richarz 1971 (wie Anm. 10), S. 28 und 58-66. Sie behan-
delte insbesondere Statius von Münchhausen, der verschie-
dene Güter und Schlösser erwarb und von dort einen
schwunghaften Getreidehandel unterhielt, daneben aber
auch Bergwerke im Harz und Verarbeitungsbetriebe wie
einen Hochofen sowie Drahtrollen und Hämmer bei
Wernigerode betrieb. 1618 ging er mit seinem Imperium in
Konkurs.
38 So geschah es etwa schon um 1780 mit Haus Wienburg
oder ab etwa 1870 mit Haus Werse, beide am Rand der
Stadt Münster (Beiträge Kaspar/Barthold). Nach einer kurzen
ersten Phase im späten 18. Jahrhundert folgten in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Gut Tönneburg bei
Warendorf (Beitrag Sandmann) und Gut Nachtigall bei
Paderborn (Beitrag Kaspar).
39 Hier sind etwa zu nennen das Gut Vasbach bei Kirchhun-
dem (Beitrag Pollmann), Gut Haus Werse bei Münster und
das Gut Haus Milte bei Telgte (Beiträge Kaspar/Barthold), fer-
ner das Gut Lütke Rumphorst bei Telgte und das Gut Haus
Lohfeld bei Warendorf (Beitrag Kaspar).
40 Hier ist z. B. auf das 1780 aufgelöste Mulmshorn südlich
von Bremen (Beitrag Dörfler), die Geschichte von Haus Wes-
terhaus (Beitrag Böcker u. a.) und das 1932 aufgelöste Gut
Koppel (Beitrag Riepshoff) hinzuweisen.
41 Sie dürften aus dem Villicus bzw. Meier als Leiter des
Herrenhofes hervorgegangen sein. Hierzu weiterführend:
Leopold Schütte, Der Villicus im spätmittelalterlichen West-
falen, in: Hans Patze (Hg.), Die Grundherrschaft im späten
Mittelalter, Band 1. Sigmaringen 1983, S. 243-368.
42 Hiermit verbunden war daher auch der Hopfenbau,
Mühlen und Mälzerei bzw. die Nutzung von großen Holz-
mengen als Brennmittel.
43 Christine van den Heuvel, Beamtenschaft und Terri-
torialstaat. Behördenentwicklung und Sozialstruktur der
Beamtenschaft im Hochstift Osnabrück 1550-1800. Osna-
brück 1984, S. 228.
44 Rolle, Aufgabe und soziale Stellung der Rentmeister
wurde bislang ausführlich nur für die Burg Dinklage der
Familie von Galen untersucht. Vgl. Sonja Michaels, Leben auf
einem Adelssitz im Niederstift Münster. Bauen, Wohnen,
Arbeiten und Haushalten auf Burg Dinklage zwischen dem
16. und 19. Jahrhundert. Cloppenburg 2008, S. 236-254f.
45 Clemens Steinbickler, Das Beamtentum in den geistigen
Fürstentümern Nordwestdeutschlands im Zeitraum von
1430-1740, in: Günther Franz (Hg.), Beamtentum und Pfar-
rerstand 1400-1800. Limburg 1972, S. 121-148, hier 123 ff.;
Bernd Walter, Die Beamtenschaft in Münster zwischen stän-
discher und bürgerlicher Gesellschaft. Eine personenge-
schichtliche Studie zur staatlichen und kommunalen
Beamtenschaft in Westfalen (1800-1859). Münster 1987. -
van den Heuvel 1984 (wie Anm. 43); Thomas Klingebiel, Ein
Stand für sich? Lokale Amtsträger in der Frühen Neuzeit.
Untersuchungen zur Staatsbildung und Gesellschaftsent-
wicklung im Hochstift Hildesheim und im älteren Fürstentum
Wolfenbüttel. Hannover 2002 (im Anhang einer Zusammen-
stellung aller Amtsträger der Zeit zwischen 1630 und 1806
mit ausführlichen Hinweisen auf ihre Lebensläufe und sozia-
len Verflechtungen).
46 Eine vollständige Liste der Wolbecker Amtsrentmeister ab
1404 bei Wolf Lammers, Gutsherrschaft und Bauernbe-
freiung in Angelmodde. Münster 1999, S. 46. Ausführlicher
teilweise bei Wilhelm Kohl, Bistum Münster, Die Diözese
(= Germania Sacra, NF 37,4). Berlin 2004, S 263-266.
47 Thomas Kleinknecht, Die münstersche Stiftung Sieverdes
von 1768, in: Franz-Josef Jacobi (u. a.) (Hg.), Stiftungen und
Armenfürsorge in Münster vor 1800. Münster 1996, S. 338-
399, hier S. 365-366 und Stammtafel im Umschlag..
48 Z. B. die über drei Generationen die Grafschaft Rietberg
führende Beamtenfamilie Reincking (Matthias Ester, Der
gräflich-rietbergische Kammerrat und Rentmeister Ludwig
Reinking [1744-1811]). Zur Sozialgeschichte der Beamten-
schaft in einem westfälischen Kleinstaat am Ende des Alten
Reiches, in: Beiträge zur westfälischen Familienforschung Bd.
45. Münster 1987, S. 193-225).
49 Der Rentmeister Gerhard Zumbusch handelte über
Jahrzehnte im Namen des Johann Heinrich von Ascheberg
auf dem Haus Ichterloh (Ascheberg, Kr. Coesfeld), hatte aber
auch die beiden Güter Dentrup und Brügge seiner Herrschaft
angepachtet und bewirtschaftete diese auf eigene Rech-
nung in Nebentätigkeit. Zeitweilig beschäftigte er auch
einen Schreiber als Mitarbeiter auf der Rentei (Peter Theißen,
Ichterloh - Der Anfang vom Ende, in: Geschichtsblätter Kreis
Coesfeld Bd. 13. Coesfeld 1988, S. 21-53, hier S. 28-29).
50 Eine solche Struktur bestand beispielsweise im 18. Jahr-
hundert bei dem Familienverband von Spiegel, wobei der
Oberrentmeister auf dem Gut Übelngönne bei Warburg
lebte, während auf den Gütern in Bühne und Daseburg und
an anderen Orten örtliche Rentmeister für die Verwaltung
der grundherrlichen Einkünfte zuständig waren. Daneben
gab es zudem auch noch Pächter als Betreiber der verschie-
denen Gutsbetriebe.
51 Hierzu die instruktive Publikation eines Anstellungsver-
trages für den Amtmann des Stiftes Langenhorst aus dem
Jahre 1626 (Wilhelm Eiling, Zur Geschichte des Stiftes Lan-
genhorst, Ochtrup 2012, S. 105-106) sowie die Liste aller
dort nachweisbaren Amtmänner (ebd., S. 1-2).
52 Vgl. etwa Wilhelm Rave, Die Geschichte des westfäli-
schen Geschlechtes Rave. Münster 1948; ders., Geschichte
des westfälischen Geschlechtes Rave. Ergänzungsband.
Münster 1958. Zu der weitverbreiteten Familie Harsewinckel,
die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die Amtsrentmeister
zum Reckenberg in Wiedenbrück stellten, s. Franz Flaskamp,
Florenz Karl-Joseph Harsewinckel in: A. Bömer/O. Leunen-
37
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
1715 Gut Nassengrund bei Blomberg (Beitrag Stiewe); um
1764 Gut Haus Werse bei Münster (Beitrag Kaspar/
Barthold); 1778 Gut Tietzels Denkmal bei Minden (Beitrag
Barthold); um 1780 Gut Tönneburg bei Warendorf (Beitrag
Sandmann); um 1820 Gut Rodenbeck bei Minden (Beitrag
Barthold); 1827 Gut Kuhlenkamp bei Minden (Beitrag
Barthold); 1846 Gut Masch bei Minden (Beitrag Barthold).
36 Zur Geschichte der Gutsgründungen im Raum Minden-
Ravensberg und Lippe auch Gertrud Angermann, Volksleben
im Nordwesten Westfalens zu Beginn der Neuzeit. Münster
1995, S. 79 f.
37 Richarz 1971 (wie Anm. 10), S. 28 und 58-66. Sie behan-
delte insbesondere Statius von Münchhausen, der verschie-
dene Güter und Schlösser erwarb und von dort einen
schwunghaften Getreidehandel unterhielt, daneben aber
auch Bergwerke im Harz und Verarbeitungsbetriebe wie
einen Hochofen sowie Drahtrollen und Hämmer bei
Wernigerode betrieb. 1618 ging er mit seinem Imperium in
Konkurs.
38 So geschah es etwa schon um 1780 mit Haus Wienburg
oder ab etwa 1870 mit Haus Werse, beide am Rand der
Stadt Münster (Beiträge Kaspar/Barthold). Nach einer kurzen
ersten Phase im späten 18. Jahrhundert folgten in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Gut Tönneburg bei
Warendorf (Beitrag Sandmann) und Gut Nachtigall bei
Paderborn (Beitrag Kaspar).
39 Hier sind etwa zu nennen das Gut Vasbach bei Kirchhun-
dem (Beitrag Pollmann), Gut Haus Werse bei Münster und
das Gut Haus Milte bei Telgte (Beiträge Kaspar/Barthold), fer-
ner das Gut Lütke Rumphorst bei Telgte und das Gut Haus
Lohfeld bei Warendorf (Beitrag Kaspar).
40 Hier ist z. B. auf das 1780 aufgelöste Mulmshorn südlich
von Bremen (Beitrag Dörfler), die Geschichte von Haus Wes-
terhaus (Beitrag Böcker u. a.) und das 1932 aufgelöste Gut
Koppel (Beitrag Riepshoff) hinzuweisen.
41 Sie dürften aus dem Villicus bzw. Meier als Leiter des
Herrenhofes hervorgegangen sein. Hierzu weiterführend:
Leopold Schütte, Der Villicus im spätmittelalterlichen West-
falen, in: Hans Patze (Hg.), Die Grundherrschaft im späten
Mittelalter, Band 1. Sigmaringen 1983, S. 243-368.
42 Hiermit verbunden war daher auch der Hopfenbau,
Mühlen und Mälzerei bzw. die Nutzung von großen Holz-
mengen als Brennmittel.
43 Christine van den Heuvel, Beamtenschaft und Terri-
torialstaat. Behördenentwicklung und Sozialstruktur der
Beamtenschaft im Hochstift Osnabrück 1550-1800. Osna-
brück 1984, S. 228.
44 Rolle, Aufgabe und soziale Stellung der Rentmeister
wurde bislang ausführlich nur für die Burg Dinklage der
Familie von Galen untersucht. Vgl. Sonja Michaels, Leben auf
einem Adelssitz im Niederstift Münster. Bauen, Wohnen,
Arbeiten und Haushalten auf Burg Dinklage zwischen dem
16. und 19. Jahrhundert. Cloppenburg 2008, S. 236-254f.
45 Clemens Steinbickler, Das Beamtentum in den geistigen
Fürstentümern Nordwestdeutschlands im Zeitraum von
1430-1740, in: Günther Franz (Hg.), Beamtentum und Pfar-
rerstand 1400-1800. Limburg 1972, S. 121-148, hier 123 ff.;
Bernd Walter, Die Beamtenschaft in Münster zwischen stän-
discher und bürgerlicher Gesellschaft. Eine personenge-
schichtliche Studie zur staatlichen und kommunalen
Beamtenschaft in Westfalen (1800-1859). Münster 1987. -
van den Heuvel 1984 (wie Anm. 43); Thomas Klingebiel, Ein
Stand für sich? Lokale Amtsträger in der Frühen Neuzeit.
Untersuchungen zur Staatsbildung und Gesellschaftsent-
wicklung im Hochstift Hildesheim und im älteren Fürstentum
Wolfenbüttel. Hannover 2002 (im Anhang einer Zusammen-
stellung aller Amtsträger der Zeit zwischen 1630 und 1806
mit ausführlichen Hinweisen auf ihre Lebensläufe und sozia-
len Verflechtungen).
46 Eine vollständige Liste der Wolbecker Amtsrentmeister ab
1404 bei Wolf Lammers, Gutsherrschaft und Bauernbe-
freiung in Angelmodde. Münster 1999, S. 46. Ausführlicher
teilweise bei Wilhelm Kohl, Bistum Münster, Die Diözese
(= Germania Sacra, NF 37,4). Berlin 2004, S 263-266.
47 Thomas Kleinknecht, Die münstersche Stiftung Sieverdes
von 1768, in: Franz-Josef Jacobi (u. a.) (Hg.), Stiftungen und
Armenfürsorge in Münster vor 1800. Münster 1996, S. 338-
399, hier S. 365-366 und Stammtafel im Umschlag..
48 Z. B. die über drei Generationen die Grafschaft Rietberg
führende Beamtenfamilie Reincking (Matthias Ester, Der
gräflich-rietbergische Kammerrat und Rentmeister Ludwig
Reinking [1744-1811]). Zur Sozialgeschichte der Beamten-
schaft in einem westfälischen Kleinstaat am Ende des Alten
Reiches, in: Beiträge zur westfälischen Familienforschung Bd.
45. Münster 1987, S. 193-225).
49 Der Rentmeister Gerhard Zumbusch handelte über
Jahrzehnte im Namen des Johann Heinrich von Ascheberg
auf dem Haus Ichterloh (Ascheberg, Kr. Coesfeld), hatte aber
auch die beiden Güter Dentrup und Brügge seiner Herrschaft
angepachtet und bewirtschaftete diese auf eigene Rech-
nung in Nebentätigkeit. Zeitweilig beschäftigte er auch
einen Schreiber als Mitarbeiter auf der Rentei (Peter Theißen,
Ichterloh - Der Anfang vom Ende, in: Geschichtsblätter Kreis
Coesfeld Bd. 13. Coesfeld 1988, S. 21-53, hier S. 28-29).
50 Eine solche Struktur bestand beispielsweise im 18. Jahr-
hundert bei dem Familienverband von Spiegel, wobei der
Oberrentmeister auf dem Gut Übelngönne bei Warburg
lebte, während auf den Gütern in Bühne und Daseburg und
an anderen Orten örtliche Rentmeister für die Verwaltung
der grundherrlichen Einkünfte zuständig waren. Daneben
gab es zudem auch noch Pächter als Betreiber der verschie-
denen Gutsbetriebe.
51 Hierzu die instruktive Publikation eines Anstellungsver-
trages für den Amtmann des Stiftes Langenhorst aus dem
Jahre 1626 (Wilhelm Eiling, Zur Geschichte des Stiftes Lan-
genhorst, Ochtrup 2012, S. 105-106) sowie die Liste aller
dort nachweisbaren Amtmänner (ebd., S. 1-2).
52 Vgl. etwa Wilhelm Rave, Die Geschichte des westfäli-
schen Geschlechtes Rave. Münster 1948; ders., Geschichte
des westfälischen Geschlechtes Rave. Ergänzungsband.
Münster 1958. Zu der weitverbreiteten Familie Harsewinckel,
die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die Amtsrentmeister
zum Reckenberg in Wiedenbrück stellten, s. Franz Flaskamp,
Florenz Karl-Joseph Harsewinckel in: A. Bömer/O. Leunen-
37