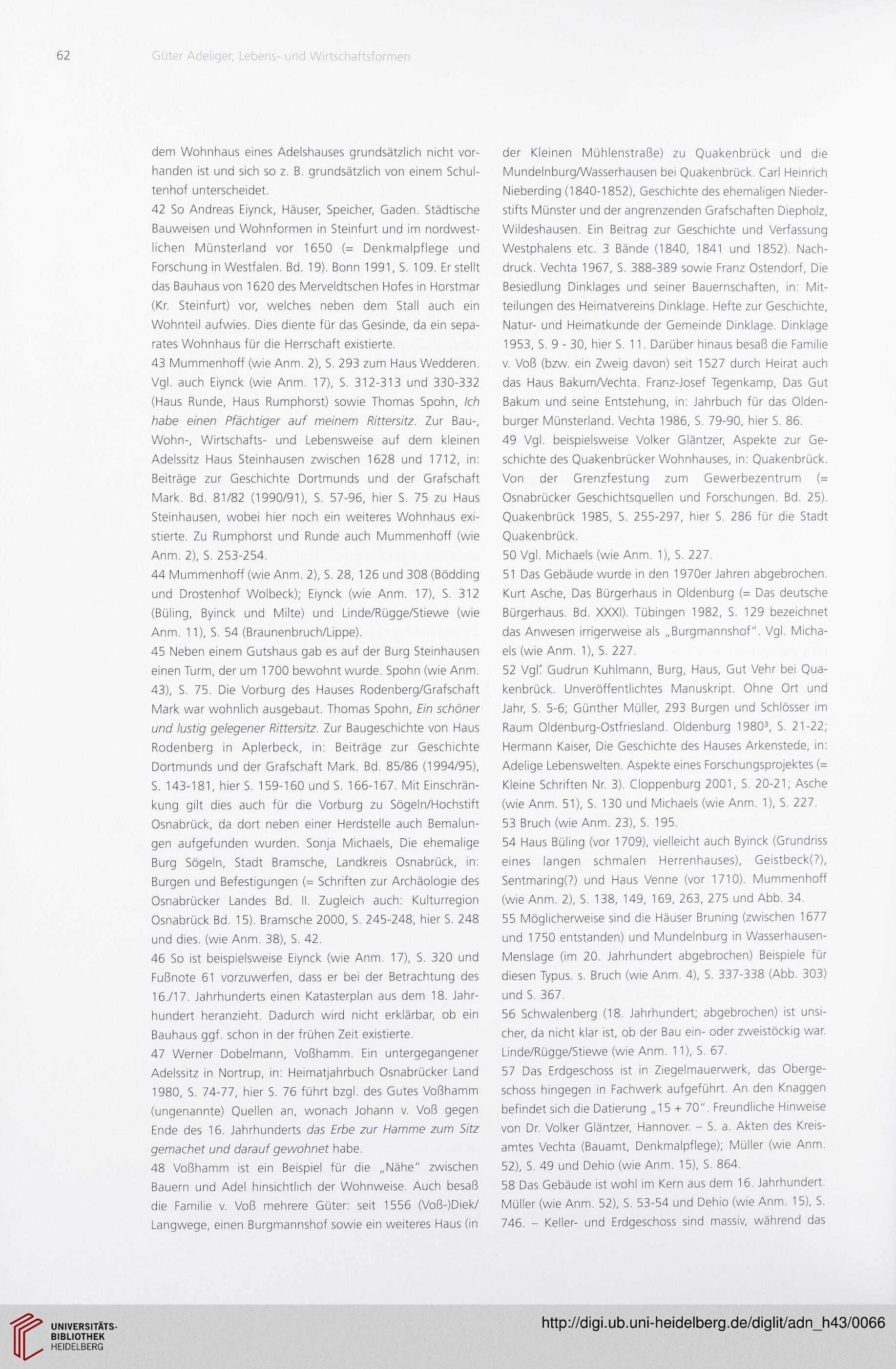62
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
dem Wohnhaus eines Adelshauses grundsätzlich nicht vor-
handen ist und sich so z. B. grundsätzlich von einem Schul-
tenhof unterscheidet.
42 So Andreas Eiynck, Häuser, Speicher, Gaden. Städtische
Bauweisen und Wohnformen in Steinfurt und im nordwest-
lichen Münsterland vor 1650 (= Denkmalpflege und
Forschung in Westfalen. Bd. 19). Bonn 1991, S. 109. Er stellt
das Bauhaus von 1620 des Merveldtschen Hofes in Horstmar
(Kr. Steinfurt) vor, welches neben dem Stall auch ein
Wohnteil aufwies. Dies diente für das Gesinde, da ein sepa-
rates Wohnhaus für die Herrschaft existierte.
43 Mummenhoff (wie Anm. 2), S. 293 zum Haus Wedderen.
Vgl. auch Eiynck (wie Anm. 17), S. 312-313 und 330-332
(Haus Runde, Haus Rumphorst) sowie Thomas Spohn, Ich
habe einen Pfächtiger auf meinem Rittersitz. Zur Bau-,
Wohn-, Wirtschafts- und Lebensweise auf dem kleinen
Adelssitz Haus Steinhausen zwischen 1628 und 1712, in:
Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft
Mark. Bd. 81/82 (1990/91), S. 57-96, hier S. 75 zu Haus
Steinhausen, wobei hier noch ein weiteres Wohnhaus exi-
stierte. Zu Rumphorst und Runde auch Mummenhoff (wie
Anm. 2), S. 253-254.
44 Mummenhoff (wie Anm. 2), S. 28, 126 und 308 (Bödding
und Drostenhof Wolbeck); Eiynck (wie Anm. 17), S. 312
(Büling, Byinck und Milte) und Linde/Rügge/Stiewe (wie
Anm. 11), S. 54 (Braunenbruch/Lippe).
45 Neben einem Gutshaus gab es auf der Burg Steinhausen
einen Turm, der um 1700 bewohnt wurde. Spohn (wie Anm.
43), S. 75. Die Vorburg des Hauses Rodenberg/Grafschaft
Mark war wohnlich ausgebaut. Thomas Spohn, Ein schöner
und lustig gelegener Rittersitz. Zur Baugeschichte von Haus
Rodenberg in Aplerbeck, in: Beiträge zur Geschichte
Dortmunds und der Grafschaft Mark. Bd. 85/86 (1994/95),
S. 143-181, hier S. 159-160 und S. 166-167. Mit Einschrän-
kung gilt dies auch für die Vorburg zu Sögeln/Hochstift
Osnabrück, da dort neben einer Herdstelle auch Bemalun-
gen aufgefunden wurden. Sonja Michaels, Die ehemalige
Burg Sögeln, Stadt Bramsche, Landkreis Osnabrück, in:
Burgen und Befestigungen (= Schriften zur Archäologie des
Osnabrücker Landes Bd. II. Zugleich auch: Kulturregion
Osnabrück Bd. 15). Bramsche 2000, S. 245-248, hier S. 248
und dies, (wie Anm. 38), S. 42.
46 So ist beispielsweise Eiynck (wie Anm. 17), S. 320 und
Fußnote 61 vorzuwerfen, dass er bei der Betrachtung des
16./17. Jahrhunderts einen Katasterplan aus dem 18. Jahr-
hundert heranzieht. Dadurch wird nicht erklärbar, ob ein
Bauhaus ggf. schon in der frühen Zeit existierte.
47 Werner Dobelmann, Voßhamm. Ein untergegangener
Adelssitz in Nortrup, in: Heimatjahrbuch Osnabrücker Land
1980, S. 74-77, hier S. 76 führt bzgl. des Gutes Voßhamm
(ungenannte) Quellen an, wonach Johann v. Voß gegen
Ende des 16. Jahrhunderts das Erbe zur Hamme zum Sitz
gemachet und darauf gewöhnet habe.
48 Voßhamm ist ein Beispiel für die „Nähe" zwischen
Bauern und Adel hinsichtlich der Wohnweise. Auch besaß
die Familie v. Voß mehrere Güter: seit 1556 (Voß-)Diek/
Langwege, einen Burgmannshof sowie ein weiteres Haus (in
der Kleinen Mühlenstraße) zu Quakenbrück und die
Mundelnburg/Wasserhausen bei Quakenbrück. Carl Heinrich
Nieberding (1840-1852), Geschichte des ehemaligen Nieder-
stifts Münster und der angrenzenden Grafschaften Diepholz,
Wildeshausen. Ein Beitrag zur Geschichte und Verfassung
Westphalens etc. 3 Bände (1840, 1841 und 1852). Nach-
druck. Vechta 1967, S. 388-389 sowie Franz Ostendorf, Die
Besiedlung Dinklages und seiner Bauernschaften, in: Mit-
teilungen des Heimatvereins Dinklage. Hefte zur Geschichte,
Natur- und Heimatkunde der Gemeinde' Dinklage. Dinklage
1953, S. 9 - 30, hier S. 11. Darüber hinaus besaß die Familie
v. Voß (bzw. ein Zweig davon) seit 1527 durch Heirat auch
das Haus Bakum/Vechta. Franz-Josef Tegenkamp, Das Gut
Bakum und seine Entstehung, in: Jahrbuch für das Olden-
burger Münsterland. Vechta 1986, S. 79-90, hier S. 86.
49 Vgl. beispielsweise Volker Gläntzer, Aspekte zur Ge-
schichte des Quakenbrücker Wohnhauses, in: Quakenbrück.
Von der Grenzfestung zum Gewerbezentrum (-
Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen. Bd. 25).
Quakenbrück 1985, S. 255-297, hier S. 286 für die Stadt
Quakenbrück.
50 Vgl. Michaels (wie Anm. 1), S. 227.
51 Das Gebäude wurde in den 1970er Jahren abgebrochen.
Kurt Asche, Das Bürgerhaus in Oldenburg (= Das deutsche
Bürgerhaus. Bd. XXXI). Tübingen 1982, S. 129 bezeichnet
das Anwesen irrigerweise als „Burgmannshof". Vgl. Micha-
els (wie Anm. 1), S. 227.
52 Vgl? Gudrun Kuhlmann, Burg, Haus, Gut Vehr bei Qua-
kenbrück. Unveröffentlichtes Manuskript. Ohne Ort und
Jahr, S. 5-6; Günther Müller, 293 Burgen und Schlösser im
Raum Oldenburg-Ostfriesland. Oldenburg 19803, S. 21-22;
Hermann Kaiser, Die Geschichte des Hauses Arkenstede, in:
Adelige Lebenswelten. Aspekte eines Forschungsprojektes (-
Kleine Schriften Nr. 3). Cloppenburg 2001, S. 20-21; Asche
(wie Anm. 51), S. 130 und Michaels (wie Anm. 1), S. 227.
53 Bruch (wie Anm. 23), S. 195.
54 Haus Büling (vor 1709), vielleicht auch Byinck (Grundriss
eines langen schmalen Herrenhauses), Geistbeck(?),
Sentmaring(?) und Haus Venne (vor 1710). Mummenhoff
(wie Anm. 2), S. 138, 149, 169, 263, 275 und Abb. 34.
55 Möglicherweise sind die Häuser Brüning (zwischen 1677
und 1750 entstanden) und Mundeinburg in Wasserhausen-
Menslage (im 20. Jahrhundert abgebrochen) Beispiele für
diesen Typus, s. Bruch (wie Anm. 4), S. 337-338 (Abb. 303)
und S. 367.
56 Schwalenberg (18. Jahrhundert; abgebrochen) ist unsi-
cher, da nicht klar ist, ob der Bau ein- oder zweistöckig war.
Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 11), S. 67.
57 Das Erdgeschoss ist in Ziegelmauerwerk, das Oberge-
schoss hingegen in Fachwerk aufgeführt. An den Knaggen
befindet sich die Datierung „15 + 70". Freundliche Hinweise
von Dr. Volker Gläntzer, Hannover. - S. a. Akten des Kreis-
amtes Vechta (Bauamt, Denkmalpflege); Müller (wie Anm.
52), S. 49 und Dehio (wie Anm. 15), S. 864.
58 Das Gebäude ist wohl im Kern aus dem 16. Jahrhundert.
Müller (wie Anm. 52), S. 53-54 und Dehio (wie Anm. 15), S.
746. - Keller- und Erdgeschoss sind massiv, während das
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
dem Wohnhaus eines Adelshauses grundsätzlich nicht vor-
handen ist und sich so z. B. grundsätzlich von einem Schul-
tenhof unterscheidet.
42 So Andreas Eiynck, Häuser, Speicher, Gaden. Städtische
Bauweisen und Wohnformen in Steinfurt und im nordwest-
lichen Münsterland vor 1650 (= Denkmalpflege und
Forschung in Westfalen. Bd. 19). Bonn 1991, S. 109. Er stellt
das Bauhaus von 1620 des Merveldtschen Hofes in Horstmar
(Kr. Steinfurt) vor, welches neben dem Stall auch ein
Wohnteil aufwies. Dies diente für das Gesinde, da ein sepa-
rates Wohnhaus für die Herrschaft existierte.
43 Mummenhoff (wie Anm. 2), S. 293 zum Haus Wedderen.
Vgl. auch Eiynck (wie Anm. 17), S. 312-313 und 330-332
(Haus Runde, Haus Rumphorst) sowie Thomas Spohn, Ich
habe einen Pfächtiger auf meinem Rittersitz. Zur Bau-,
Wohn-, Wirtschafts- und Lebensweise auf dem kleinen
Adelssitz Haus Steinhausen zwischen 1628 und 1712, in:
Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft
Mark. Bd. 81/82 (1990/91), S. 57-96, hier S. 75 zu Haus
Steinhausen, wobei hier noch ein weiteres Wohnhaus exi-
stierte. Zu Rumphorst und Runde auch Mummenhoff (wie
Anm. 2), S. 253-254.
44 Mummenhoff (wie Anm. 2), S. 28, 126 und 308 (Bödding
und Drostenhof Wolbeck); Eiynck (wie Anm. 17), S. 312
(Büling, Byinck und Milte) und Linde/Rügge/Stiewe (wie
Anm. 11), S. 54 (Braunenbruch/Lippe).
45 Neben einem Gutshaus gab es auf der Burg Steinhausen
einen Turm, der um 1700 bewohnt wurde. Spohn (wie Anm.
43), S. 75. Die Vorburg des Hauses Rodenberg/Grafschaft
Mark war wohnlich ausgebaut. Thomas Spohn, Ein schöner
und lustig gelegener Rittersitz. Zur Baugeschichte von Haus
Rodenberg in Aplerbeck, in: Beiträge zur Geschichte
Dortmunds und der Grafschaft Mark. Bd. 85/86 (1994/95),
S. 143-181, hier S. 159-160 und S. 166-167. Mit Einschrän-
kung gilt dies auch für die Vorburg zu Sögeln/Hochstift
Osnabrück, da dort neben einer Herdstelle auch Bemalun-
gen aufgefunden wurden. Sonja Michaels, Die ehemalige
Burg Sögeln, Stadt Bramsche, Landkreis Osnabrück, in:
Burgen und Befestigungen (= Schriften zur Archäologie des
Osnabrücker Landes Bd. II. Zugleich auch: Kulturregion
Osnabrück Bd. 15). Bramsche 2000, S. 245-248, hier S. 248
und dies, (wie Anm. 38), S. 42.
46 So ist beispielsweise Eiynck (wie Anm. 17), S. 320 und
Fußnote 61 vorzuwerfen, dass er bei der Betrachtung des
16./17. Jahrhunderts einen Katasterplan aus dem 18. Jahr-
hundert heranzieht. Dadurch wird nicht erklärbar, ob ein
Bauhaus ggf. schon in der frühen Zeit existierte.
47 Werner Dobelmann, Voßhamm. Ein untergegangener
Adelssitz in Nortrup, in: Heimatjahrbuch Osnabrücker Land
1980, S. 74-77, hier S. 76 führt bzgl. des Gutes Voßhamm
(ungenannte) Quellen an, wonach Johann v. Voß gegen
Ende des 16. Jahrhunderts das Erbe zur Hamme zum Sitz
gemachet und darauf gewöhnet habe.
48 Voßhamm ist ein Beispiel für die „Nähe" zwischen
Bauern und Adel hinsichtlich der Wohnweise. Auch besaß
die Familie v. Voß mehrere Güter: seit 1556 (Voß-)Diek/
Langwege, einen Burgmannshof sowie ein weiteres Haus (in
der Kleinen Mühlenstraße) zu Quakenbrück und die
Mundelnburg/Wasserhausen bei Quakenbrück. Carl Heinrich
Nieberding (1840-1852), Geschichte des ehemaligen Nieder-
stifts Münster und der angrenzenden Grafschaften Diepholz,
Wildeshausen. Ein Beitrag zur Geschichte und Verfassung
Westphalens etc. 3 Bände (1840, 1841 und 1852). Nach-
druck. Vechta 1967, S. 388-389 sowie Franz Ostendorf, Die
Besiedlung Dinklages und seiner Bauernschaften, in: Mit-
teilungen des Heimatvereins Dinklage. Hefte zur Geschichte,
Natur- und Heimatkunde der Gemeinde' Dinklage. Dinklage
1953, S. 9 - 30, hier S. 11. Darüber hinaus besaß die Familie
v. Voß (bzw. ein Zweig davon) seit 1527 durch Heirat auch
das Haus Bakum/Vechta. Franz-Josef Tegenkamp, Das Gut
Bakum und seine Entstehung, in: Jahrbuch für das Olden-
burger Münsterland. Vechta 1986, S. 79-90, hier S. 86.
49 Vgl. beispielsweise Volker Gläntzer, Aspekte zur Ge-
schichte des Quakenbrücker Wohnhauses, in: Quakenbrück.
Von der Grenzfestung zum Gewerbezentrum (-
Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen. Bd. 25).
Quakenbrück 1985, S. 255-297, hier S. 286 für die Stadt
Quakenbrück.
50 Vgl. Michaels (wie Anm. 1), S. 227.
51 Das Gebäude wurde in den 1970er Jahren abgebrochen.
Kurt Asche, Das Bürgerhaus in Oldenburg (= Das deutsche
Bürgerhaus. Bd. XXXI). Tübingen 1982, S. 129 bezeichnet
das Anwesen irrigerweise als „Burgmannshof". Vgl. Micha-
els (wie Anm. 1), S. 227.
52 Vgl? Gudrun Kuhlmann, Burg, Haus, Gut Vehr bei Qua-
kenbrück. Unveröffentlichtes Manuskript. Ohne Ort und
Jahr, S. 5-6; Günther Müller, 293 Burgen und Schlösser im
Raum Oldenburg-Ostfriesland. Oldenburg 19803, S. 21-22;
Hermann Kaiser, Die Geschichte des Hauses Arkenstede, in:
Adelige Lebenswelten. Aspekte eines Forschungsprojektes (-
Kleine Schriften Nr. 3). Cloppenburg 2001, S. 20-21; Asche
(wie Anm. 51), S. 130 und Michaels (wie Anm. 1), S. 227.
53 Bruch (wie Anm. 23), S. 195.
54 Haus Büling (vor 1709), vielleicht auch Byinck (Grundriss
eines langen schmalen Herrenhauses), Geistbeck(?),
Sentmaring(?) und Haus Venne (vor 1710). Mummenhoff
(wie Anm. 2), S. 138, 149, 169, 263, 275 und Abb. 34.
55 Möglicherweise sind die Häuser Brüning (zwischen 1677
und 1750 entstanden) und Mundeinburg in Wasserhausen-
Menslage (im 20. Jahrhundert abgebrochen) Beispiele für
diesen Typus, s. Bruch (wie Anm. 4), S. 337-338 (Abb. 303)
und S. 367.
56 Schwalenberg (18. Jahrhundert; abgebrochen) ist unsi-
cher, da nicht klar ist, ob der Bau ein- oder zweistöckig war.
Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 11), S. 67.
57 Das Erdgeschoss ist in Ziegelmauerwerk, das Oberge-
schoss hingegen in Fachwerk aufgeführt. An den Knaggen
befindet sich die Datierung „15 + 70". Freundliche Hinweise
von Dr. Volker Gläntzer, Hannover. - S. a. Akten des Kreis-
amtes Vechta (Bauamt, Denkmalpflege); Müller (wie Anm.
52), S. 49 und Dehio (wie Anm. 15), S. 864.
58 Das Gebäude ist wohl im Kern aus dem 16. Jahrhundert.
Müller (wie Anm. 52), S. 53-54 und Dehio (wie Anm. 15), S.
746. - Keller- und Erdgeschoss sind massiv, während das