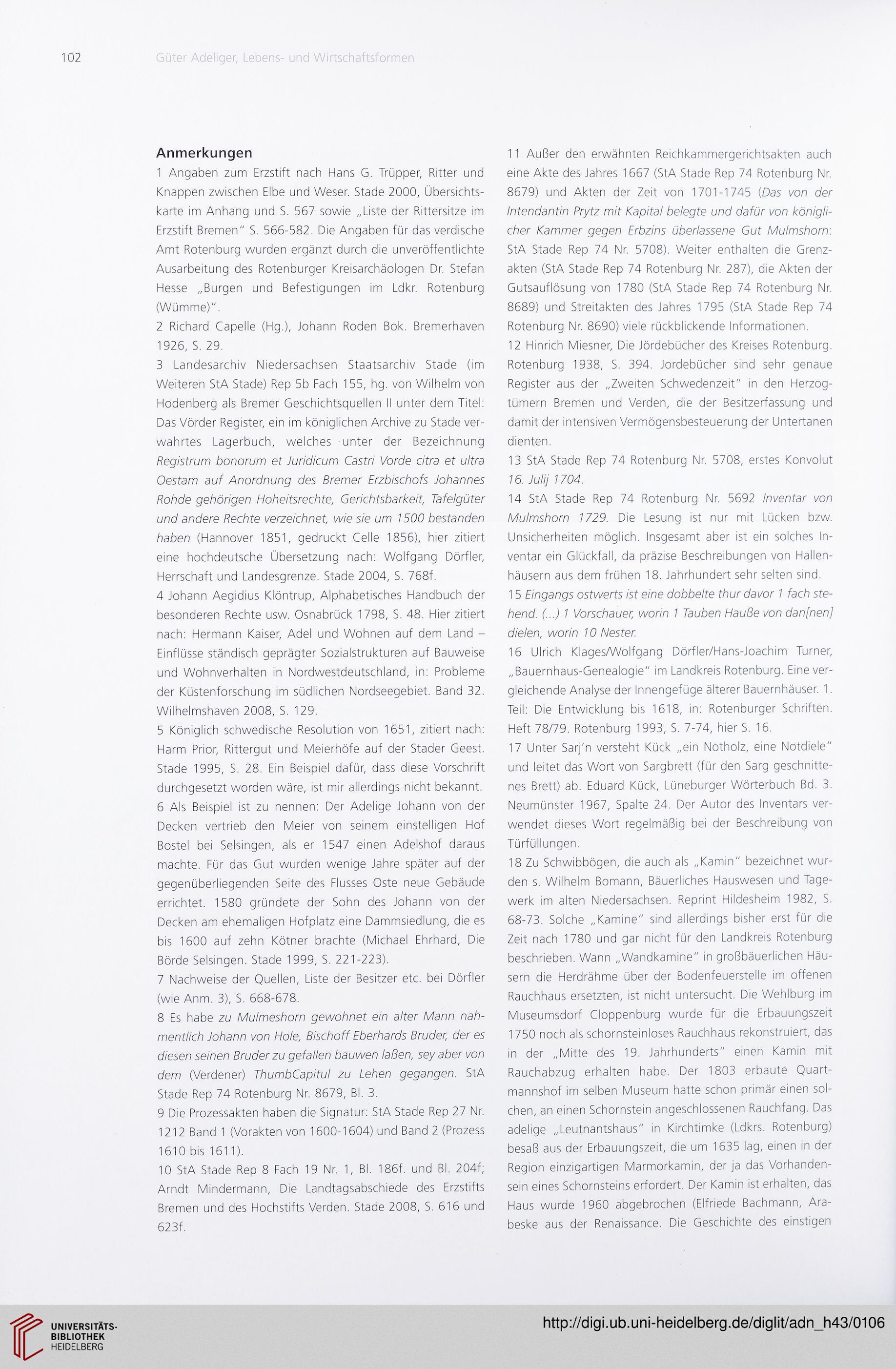102
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Angaben zum Erzstift nach Hans G. Trüpper, Ritter und
Knappen zwischen Elbe und Weser. Stade 2000, Übersichts-
karte im Anhang und S. 567 sowie „Liste der Rittersitze im
Erzstift Bremen" S. 566-582. Die Angaben für das verdische
Amt Rotenburg wurden ergänzt durch die unveröffentlichte
Ausarbeitung des Rotenburger Kreisarchäologen Dr. Stefan
Hesse „Burgen und Befestigungen im Ldkr. Rotenburg
(Wümme)".
2 Richard Capelle (Hg.), Johann Roden Bok. Bremerhaven
1926, S. 29.
3 Landesarchiv Niedersachsen Staatsarchiv Stade (im
Weiteren StA Stade) Rep 5b Fach 155, hg. von Wilhelm von
Hodenberg als Bremer Geschichtsquellen II unter dem Titel:
Das Vorder Register, ein im königlichen Archive zu Stade ver-
wahrtes Lagerbuch, welches unter der Bezeichnung
Registrum bonorum et Juridicum Castri Vorde citra et ultra
Oestam auf Anordnung des Bremer Erzbischofs Johannes
Rohde gehörigen Hoheitsrechte, Gerichtsbarkeit, Tafelgüter
und andere Rechte verzeichnet, wie sie um 1500 bestanden
haben (Hannover 1851, gedruckt Celle 1856), hier zitiert
eine hochdeutsche Übersetzung nach: Wolfgang Dörfler,
Herrschaft und Landesgrenze. Stade 2004, S. 768f.
4 Johann Aegidius Klöntrup, Alphabetisches Handbuch der
besonderen Rechte usw. Osnabrück 1798, S. 48. Hier zitiert
nach: Hermann Kaiser, Adel und Wohnen auf dem Land -
Einflüsse ständisch geprägter Sozialstrukturen auf Bauweise
und Wohnverhalten in Nordwestdeutschland, in: Probleme
der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet. Band 32.
Wilhelmshaven 2008, S. 129.
5 Königlich schwedische Resolution von 1651, zitiert nach:
Harm Prior, Rittergut und Meierhöfe auf der Stader Geest.
Stade 1995, S. 28. Ein Beispiel dafür, dass diese Vorschrift
durchgesetzt worden wäre, ist mir allerdings nicht bekannt.
6 Als Beispiel ist zu nennen: Der Adelige Johann von der
Decken vertrieb den Meier von seinem einstelligen Hof
Bostel bei Selsingen, als er 1547 einen Adelshof daraus
machte. Für das Gut wurden wenige Jahre später auf der
gegenüberliegenden Seite des Flusses Oste neue Gebäude
errichtet. 1580 gründete der Sohn des Johann von der
Decken am ehemaligen Hofplatz eine Dammsiedlung, die es
bis 1600 auf zehn Kötner brachte (Michael Ehrhard, Die
Börde Selsingen. Stade 1999, S. 221-223).
7 Nachweise der Quellen, Liste der Besitzer etc. bei Dörfler
(wie Anm. 3), S. 668-678.
8 Es habe zu Mulmeshorn gewöhnet ein alter Mann nah-
mentlich Johann von Hole, Bischoff Eberhards Bruder, der es
diesen seinen Bruder zu gefallen bau wen laßen, sey aber von
dem (Verdener) ThumbCapituI zu Lehen gegangen. StA
Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 8679, BI. 3.
9 Die Prozessakten haben die Signatur: StA Stade Rep 27 Nr.
1212 Band 1 (Vorakten von 1600-1604) und Band 2 (Prozess
1610 bis 1611).
10 StA Stade Rep 8 Fach 19 Nr. 1, Bl. 186f. und BL 204f;
Arndt Mindermann, Die Landtagsabschiede des Erzstifts
Bremen und des Hochstifts Verden. Stade 2008, S. 616 und
623f.
11 Außer den erwähnten Reichkammergerichtsakten auch
eine Akte des Jahres 1667 (StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr.
8679) und Akten der Zeit von 1701-1745 (Das von der
Intendantin Prytz mit Kapital belegte und dafür von königli-
cher Kammer gegen Erbzins überlassene Gut Mulmshorn:
StA Stade Rep 74 Nr. 5708). Weiter enthalten die Grenz-
akten (StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 287), die Akten der
Gutsauflösung von 1780 (StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr.
8689) und Streitakten des Jahres 1795 (StA Stade Rep 74
Rotenburg Nr. 8690) viele rückblickende Informationen.
12 Hinrich Miesner, Die Jördebücher des Kreises Rotenburg.
Rotenburg 1938, S. 394. Jördebücher sind sehr genaue
Register aus der „Zweiten Schwedenzeit" in den Herzog-
tümern Bremen und Verden, die der Besitzerfassung und
damit der intensiven Vermögensbesteuerung der Untertanen
dienten.
13 StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 5708, erstes Konvolut
16. Julij 1704.
14 StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 5692 Inventar von
Mulmshorn 1729. Die Lesung ist nur mit Lücken bzw.
Unsicherheiten möglich. Insgesamt aber ist ein solches In-
ventar ein Glückfall, da präzise Beschreibungen von Hallen-
häusern aus dem frühen 18. Jahrhundert sehr selten sind.
15 Eingangs ostwerts ist eine dobbelte thur davor 1 fach ste-
hend. (...) 1 Vorschauer, worin 1 Tauben Hauße von danfnen]
dielen, worin 10 Nester.
16 Ulrich Klages/Wolfgang Dörfler/Hans-Joachim Turner,
„Bauernhaus-Genealogie" im Landkreis Rotenburg. Eine ver-
gleichende Analyse der Innengefüge älterer Bauernhäuser. 1.
Teil: Die Entwicklung bis 1618, in: Rotenburger Schriften.
Heft 78/79. Rotenburg 1993, S. 7-74, hier S. 16.
17 Unter Sarj'n versteht Kück „ein Notholz, eine Notdiele"
und leitet das Wort von Sargbrett (für den Sarg geschnitte-
nes Brett) ab. Eduard Kück, Lüneburger Wörterbuch Bd. 3.
Neumünster 1967, Spalte 24. Der Autor des Inventars ver-
wendet dieses Wort regelmäßig bei der Beschreibung von
Türfüllungen.
18 Zu Schwibbögen, die auch als „Kamin" bezeichnet wur-
den s. Wilhelm Bomann, Bäuerliches Hauswesen und Tage-
werk im alten Niedersachsen. Reprint Hildesheim 1982, S.
68-73. Solche „Kamine" sind allerdings bisher erst für die
Zeit nach 1780 und gar nicht für den Landkreis Rotenburg
beschrieben. Wann „Wandkamine" in großbäuerlichen Häu-
sern die Herdrähme über der Bodenfeuerstelle im offenen
Rauchhaus ersetzten, ist nicht untersucht. Die Wehlburg im
Museumsdorf Cloppenburg wurde für die Erbauungszeit
1750 noch als schornsteinloses Rauchhaus rekonstruiert, das
in der „Mitte des 19. Jahrhunderts" einen Kamin mit
Rauchabzug erhalten habe. Der 1803 erbaute Quart-
mannshof im selben Museum hatte schon primär einen sol-
chen, an einen Schornstein angeschlossenen Rauchfang. Das
adelige „Leutnantshaus" in Kirchtimke (Ldkrs. Rotenburg)
besaß aus der Erbauungszeit, die um 1635 lag, einen in der
Region einzigartigen Marmorkamin, der ja das Vorhanden-
sein eines Schornsteins erfordert. Der Kamin ist erhalten, das
Haus wurde 1960 abgebrochen (Elfriede Bachmann, Ara-
beske aus der Renaissance. Die Geschichte des einstigen
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Angaben zum Erzstift nach Hans G. Trüpper, Ritter und
Knappen zwischen Elbe und Weser. Stade 2000, Übersichts-
karte im Anhang und S. 567 sowie „Liste der Rittersitze im
Erzstift Bremen" S. 566-582. Die Angaben für das verdische
Amt Rotenburg wurden ergänzt durch die unveröffentlichte
Ausarbeitung des Rotenburger Kreisarchäologen Dr. Stefan
Hesse „Burgen und Befestigungen im Ldkr. Rotenburg
(Wümme)".
2 Richard Capelle (Hg.), Johann Roden Bok. Bremerhaven
1926, S. 29.
3 Landesarchiv Niedersachsen Staatsarchiv Stade (im
Weiteren StA Stade) Rep 5b Fach 155, hg. von Wilhelm von
Hodenberg als Bremer Geschichtsquellen II unter dem Titel:
Das Vorder Register, ein im königlichen Archive zu Stade ver-
wahrtes Lagerbuch, welches unter der Bezeichnung
Registrum bonorum et Juridicum Castri Vorde citra et ultra
Oestam auf Anordnung des Bremer Erzbischofs Johannes
Rohde gehörigen Hoheitsrechte, Gerichtsbarkeit, Tafelgüter
und andere Rechte verzeichnet, wie sie um 1500 bestanden
haben (Hannover 1851, gedruckt Celle 1856), hier zitiert
eine hochdeutsche Übersetzung nach: Wolfgang Dörfler,
Herrschaft und Landesgrenze. Stade 2004, S. 768f.
4 Johann Aegidius Klöntrup, Alphabetisches Handbuch der
besonderen Rechte usw. Osnabrück 1798, S. 48. Hier zitiert
nach: Hermann Kaiser, Adel und Wohnen auf dem Land -
Einflüsse ständisch geprägter Sozialstrukturen auf Bauweise
und Wohnverhalten in Nordwestdeutschland, in: Probleme
der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet. Band 32.
Wilhelmshaven 2008, S. 129.
5 Königlich schwedische Resolution von 1651, zitiert nach:
Harm Prior, Rittergut und Meierhöfe auf der Stader Geest.
Stade 1995, S. 28. Ein Beispiel dafür, dass diese Vorschrift
durchgesetzt worden wäre, ist mir allerdings nicht bekannt.
6 Als Beispiel ist zu nennen: Der Adelige Johann von der
Decken vertrieb den Meier von seinem einstelligen Hof
Bostel bei Selsingen, als er 1547 einen Adelshof daraus
machte. Für das Gut wurden wenige Jahre später auf der
gegenüberliegenden Seite des Flusses Oste neue Gebäude
errichtet. 1580 gründete der Sohn des Johann von der
Decken am ehemaligen Hofplatz eine Dammsiedlung, die es
bis 1600 auf zehn Kötner brachte (Michael Ehrhard, Die
Börde Selsingen. Stade 1999, S. 221-223).
7 Nachweise der Quellen, Liste der Besitzer etc. bei Dörfler
(wie Anm. 3), S. 668-678.
8 Es habe zu Mulmeshorn gewöhnet ein alter Mann nah-
mentlich Johann von Hole, Bischoff Eberhards Bruder, der es
diesen seinen Bruder zu gefallen bau wen laßen, sey aber von
dem (Verdener) ThumbCapituI zu Lehen gegangen. StA
Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 8679, BI. 3.
9 Die Prozessakten haben die Signatur: StA Stade Rep 27 Nr.
1212 Band 1 (Vorakten von 1600-1604) und Band 2 (Prozess
1610 bis 1611).
10 StA Stade Rep 8 Fach 19 Nr. 1, Bl. 186f. und BL 204f;
Arndt Mindermann, Die Landtagsabschiede des Erzstifts
Bremen und des Hochstifts Verden. Stade 2008, S. 616 und
623f.
11 Außer den erwähnten Reichkammergerichtsakten auch
eine Akte des Jahres 1667 (StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr.
8679) und Akten der Zeit von 1701-1745 (Das von der
Intendantin Prytz mit Kapital belegte und dafür von königli-
cher Kammer gegen Erbzins überlassene Gut Mulmshorn:
StA Stade Rep 74 Nr. 5708). Weiter enthalten die Grenz-
akten (StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 287), die Akten der
Gutsauflösung von 1780 (StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr.
8689) und Streitakten des Jahres 1795 (StA Stade Rep 74
Rotenburg Nr. 8690) viele rückblickende Informationen.
12 Hinrich Miesner, Die Jördebücher des Kreises Rotenburg.
Rotenburg 1938, S. 394. Jördebücher sind sehr genaue
Register aus der „Zweiten Schwedenzeit" in den Herzog-
tümern Bremen und Verden, die der Besitzerfassung und
damit der intensiven Vermögensbesteuerung der Untertanen
dienten.
13 StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 5708, erstes Konvolut
16. Julij 1704.
14 StA Stade Rep 74 Rotenburg Nr. 5692 Inventar von
Mulmshorn 1729. Die Lesung ist nur mit Lücken bzw.
Unsicherheiten möglich. Insgesamt aber ist ein solches In-
ventar ein Glückfall, da präzise Beschreibungen von Hallen-
häusern aus dem frühen 18. Jahrhundert sehr selten sind.
15 Eingangs ostwerts ist eine dobbelte thur davor 1 fach ste-
hend. (...) 1 Vorschauer, worin 1 Tauben Hauße von danfnen]
dielen, worin 10 Nester.
16 Ulrich Klages/Wolfgang Dörfler/Hans-Joachim Turner,
„Bauernhaus-Genealogie" im Landkreis Rotenburg. Eine ver-
gleichende Analyse der Innengefüge älterer Bauernhäuser. 1.
Teil: Die Entwicklung bis 1618, in: Rotenburger Schriften.
Heft 78/79. Rotenburg 1993, S. 7-74, hier S. 16.
17 Unter Sarj'n versteht Kück „ein Notholz, eine Notdiele"
und leitet das Wort von Sargbrett (für den Sarg geschnitte-
nes Brett) ab. Eduard Kück, Lüneburger Wörterbuch Bd. 3.
Neumünster 1967, Spalte 24. Der Autor des Inventars ver-
wendet dieses Wort regelmäßig bei der Beschreibung von
Türfüllungen.
18 Zu Schwibbögen, die auch als „Kamin" bezeichnet wur-
den s. Wilhelm Bomann, Bäuerliches Hauswesen und Tage-
werk im alten Niedersachsen. Reprint Hildesheim 1982, S.
68-73. Solche „Kamine" sind allerdings bisher erst für die
Zeit nach 1780 und gar nicht für den Landkreis Rotenburg
beschrieben. Wann „Wandkamine" in großbäuerlichen Häu-
sern die Herdrähme über der Bodenfeuerstelle im offenen
Rauchhaus ersetzten, ist nicht untersucht. Die Wehlburg im
Museumsdorf Cloppenburg wurde für die Erbauungszeit
1750 noch als schornsteinloses Rauchhaus rekonstruiert, das
in der „Mitte des 19. Jahrhunderts" einen Kamin mit
Rauchabzug erhalten habe. Der 1803 erbaute Quart-
mannshof im selben Museum hatte schon primär einen sol-
chen, an einen Schornstein angeschlossenen Rauchfang. Das
adelige „Leutnantshaus" in Kirchtimke (Ldkrs. Rotenburg)
besaß aus der Erbauungszeit, die um 1635 lag, einen in der
Region einzigartigen Marmorkamin, der ja das Vorhanden-
sein eines Schornsteins erfordert. Der Kamin ist erhalten, das
Haus wurde 1960 abgebrochen (Elfriede Bachmann, Ara-
beske aus der Renaissance. Die Geschichte des einstigen