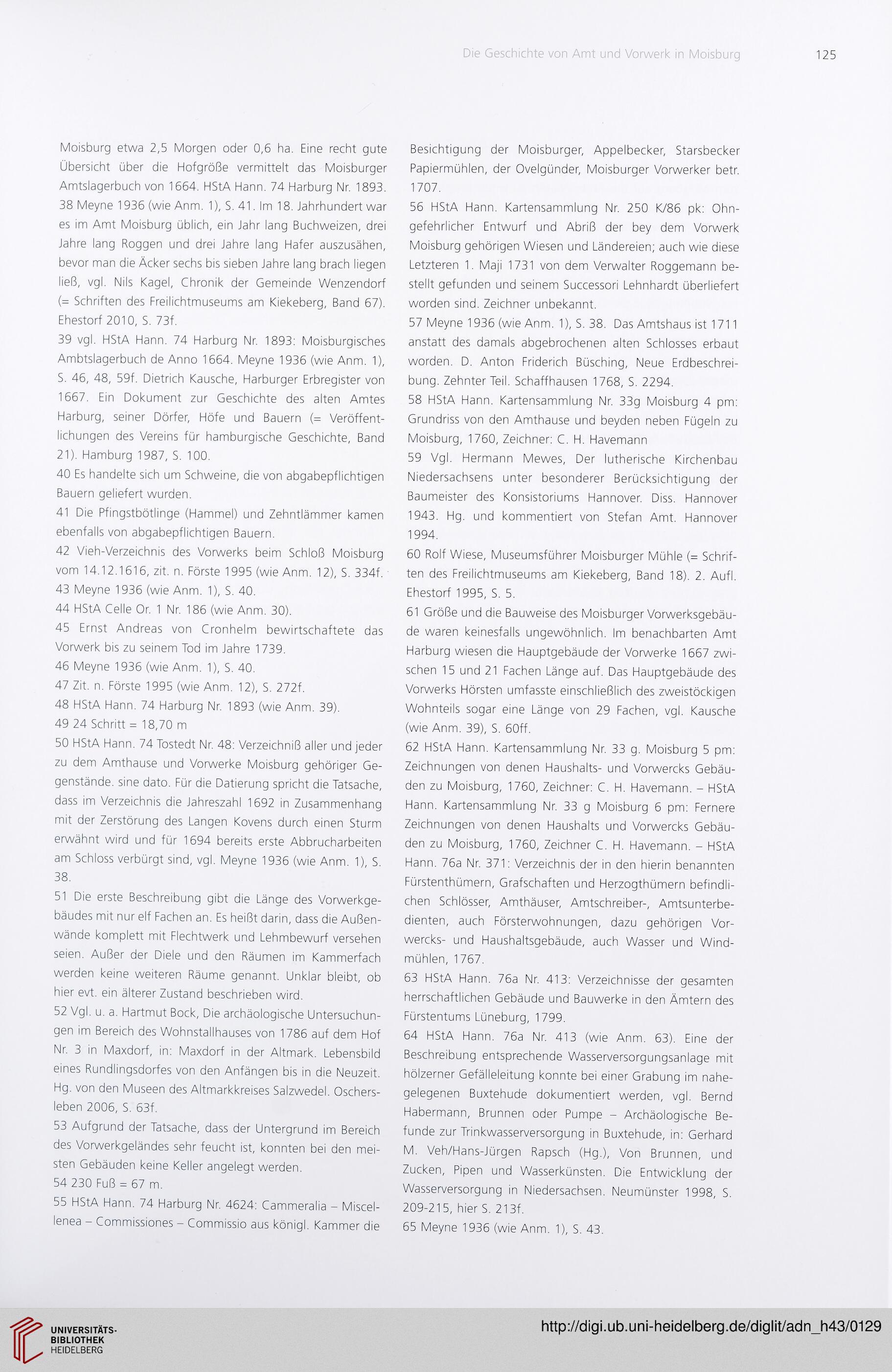Die Geschichte von Amt und Vorwerk in Moisburg
125
Moisburg etwa 2,5 Morgen oder 0,6 ha. Eine recht gute
Übersicht über die Hofgröße vermittelt das Moisburger
Amtslagerbuch von 1664. HStA Hann. 74 Harburg Nr. 1893.
38 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 41. Im 18. Jahrhundert war
es im Amt Moisburg üblich, ein Jahr lang Buchweizen, drei
Jahre lang Roggen und drei Jahre lang Hafer auszusähen,
bevor man die Äcker sechs bis sieben Jahre lang brach liegen
ließ, vgl. Nils Kagel, Chronik der Gemeinde Wenzendorf
(= Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Band 67).
Ehestorf 2010, S. 73f.
39 vgl. HStA Hann. 74 Harburg Nr. 1893: Moisburgisches
Ambtslagerbuch de Anno 1664. Meyne 1936 (wie Anm. 1),
S. 46, 48, 59f. Dietrich Kausche, Harburger Erbregister von
1667. Ein Dokument zur Geschichte des alten Amtes
Harburg, seiner Dörfer, Höfe und Bauern (= Veröffent-
lichungen des Vereins für hamburgische Geschichte, Band
21). Hamburg 1987, S. 100.
40 Es handelte sich um Schweine, die von abgabepflichtigen
Bauern geliefert wurden.
41 Die Pfingstbötlinge (Hammel) und Zehntlämmer kamen
ebenfalls von abgabepflichtigen Bauern.
42 Vieh-Verzeichnis des Vorwerks beim Schloß Moisburg
vom 14.12.1616, zit. n. Förste 1995 (wie Anm. 12), S. 334f.
43 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 40.
44 HStA Celle Or. 1 Nr. 186 (wie Anm. 30).
45 Ernst Andreas von Cronhelm bewirtschaftete das
Vorwerk bis zu seinem Tod im Jahre 1739.
46 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 40.
47 Zit. n. Förste 1995 (wie Anm. 12), S. 272f.
48 HStA Hann. 74 Harburg Nr. 1893 (wie Anm. 39).
49 24 Schritt = 18,70 m
50 HStA Hann. 74 Tostedt Nr. 48: Verzeichniß aller und jeder
zu dem Amthause und Vorwerke Moisburg gehöriger Ge-
genstände. sine dato. Für die Datierung spricht die Tatsache,
dass im Verzeichnis die Jahreszahl 1692 in Zusammenhang
mit der Zerstörung des Langen Kovens durch einen Sturm
erwähnt wird und für 1694 bereits erste Abbrucharbeiten
am Schloss verbürgt sind, vgl. Meyne 1936 (wie Anm. 1), S.
38.
51 Die erste Beschreibung gibt die Länge des Vorwerkge-
bäudes mit nur elf Fachen an. Es heißt darin, dass die Außen-
wände komplett mit Flechtwerk und Lehmbewurf versehen
seien. Außer der Diele und den Räumen im Kammerfach
werden keine weiteren Räume genannt. Unklar bleibt, ob
hier evt. ein älterer Zustand beschrieben wird.
52 Vgl. u. a. Hartmut Bock, Die archäologische Untersuchun-
gen im Bereich des Wohnstallhauses von 1786 auf dem Hof
Nr. 3 in Maxdorf, in: Maxdorf in der Altmark. Lebensbild
eines Rundlingsdorfes von den Anfängen bis in die Neuzeit.
Hg. von den Museen des Altmarkkreises Salzwedel. Oschers-
leben 2006, S. 63f.
53 Aufgrund der Tatsache, dass der Untergrund im Bereich
des Vorwerkgeländes sehr feucht ist, konnten bei den mei-
sten Gebäuden keine Keller angelegt werden.
54 230 Fuß = 67 m.
55 HStA Hann. 74 Harburg Nr. 4624: Cammeralia - Miscel-
lenea - Commissiones - Commissio aus königl. Kammer die
Besichtigung der Moisburger, Appelbecker, Starsbecker
Papiermühlen, der Ovelgünder, Moisburger Vorwerker betr.
1707.
56 HStA Hann. Kartensammlung Nr. 250 K/86 pk: Ohn-
gefehrlicher Entwurf und Abriß der bey dem Vorwerk
Moisburg gehörigen Wiesen und Ländereien; auch wie diese
Letzteren 1. Maji 1731 von dem Verwalter Roggemann be-
stellt gefunden und seinem Successori Lehnhardt überliefert
worden sind. Zeichner unbekannt.
57 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 38. Das Amtshaus ist 1711
anstatt des damals abgebrochenen alten Schlosses erbaut
worden. D. Anton Friderich Büsching, Neue Erdbeschrei-
bung. Zehnter Teil. Schaffhausen 1768, S. 2294.
58 HStA Hann. Kartensammlung Nr. 33g Moisburg 4 pm:
Grundriss von den Amthause und beyden neben Fügeln zu
Moisburg, 1760, Zeichner: C. H. Havemann
59 Vgl. Hermann Mewes, Der lutherische Kirchenbau
Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der
Baumeister des Konsistoriums Hannover. Diss. Hannover
1943. Hg. und kommentiert von Stefan Amt. Hannover
1994.
60 Rolf Wiese, Museumsführer Moisburger Mühle (= Schrif-
ten des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Band 18). 2. Aufl.
Ehestorf 1995, S. 5.
61 Größe und die Bauweise des Moisburger Vorwerksgebäu-
de waren keinesfalls ungewöhnlich. Im benachbarten Amt
Harburg wiesen die Hauptgebäude der Vorwerke 1667 zwi-
schen 15 und 21 Fachen Länge auf. Das Hauptgebäude des
Vorwerks Hörsten umfasste einschließlich des zweistöckigen
Wohnteils sogar eine Länge von 29 Fachen, vgl. Kausche
(wie Anm. 39), S. 60ff.
62 HStA Hann. Kartensammlung Nr. 33 g. Moisburg 5 pm:
Zeichnungen von denen Haushalts- und Vorwercks Gebäu-
den zu Moisburg, 1760, Zeichner: C. H. Havemann. - HStA
Hann. Kartensammlung Nr. 33 g Moisburg 6 pm: Fernere
Zeichnungen von denen Haushalts und Vorwercks Gebäu-
den zu Moisburg, 1760, Zeichner C. H. Havemann. - HStA
Hann. 76a Nr. 371: Verzeichnis der in den hierin benannten
Fürstenthümern, Grafschaften und Herzogthümern befindli-
chen Schlösser, Amthäuser, Amtschreiber-, Amtsunterbe-
dienten, auch Försterwohnungen, dazu gehörigen Vor-
wercks- und Haushaltsgebäude, auch Wasser und Wind-
mühlen, 1767.
63 HStA Hann. 76a Nr. 413: Verzeichnisse der gesamten
herrschaftlichen Gebäude und Bauwerke in den Ämtern des
Fürstentums Lüneburg, 1799.
64 HStA Hann. 76a Nr. 413 (wie Anm. 63). Eine der
Beschreibung entsprechende Wasserversorgungsanlage mit
hölzerner Gefälleleitung konnte bei einer Grabung im nahe-
gelegenen Buxtehude dokumentiert werden, vgl. Bernd
Habermann, Brunnen oder Pumpe - Archäologische Be-
funde zur Trinkwasserversorgung in Buxtehude, in: Gerhard
M. Veh/Hans-Jürgen Rapsch (Hg.), Von Brunnen, und
Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der
Wasserversorgung in Niedersachsen. Neumünster 1998, S.
209-215, hier S. 213f.
65 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 43.
125
Moisburg etwa 2,5 Morgen oder 0,6 ha. Eine recht gute
Übersicht über die Hofgröße vermittelt das Moisburger
Amtslagerbuch von 1664. HStA Hann. 74 Harburg Nr. 1893.
38 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 41. Im 18. Jahrhundert war
es im Amt Moisburg üblich, ein Jahr lang Buchweizen, drei
Jahre lang Roggen und drei Jahre lang Hafer auszusähen,
bevor man die Äcker sechs bis sieben Jahre lang brach liegen
ließ, vgl. Nils Kagel, Chronik der Gemeinde Wenzendorf
(= Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Band 67).
Ehestorf 2010, S. 73f.
39 vgl. HStA Hann. 74 Harburg Nr. 1893: Moisburgisches
Ambtslagerbuch de Anno 1664. Meyne 1936 (wie Anm. 1),
S. 46, 48, 59f. Dietrich Kausche, Harburger Erbregister von
1667. Ein Dokument zur Geschichte des alten Amtes
Harburg, seiner Dörfer, Höfe und Bauern (= Veröffent-
lichungen des Vereins für hamburgische Geschichte, Band
21). Hamburg 1987, S. 100.
40 Es handelte sich um Schweine, die von abgabepflichtigen
Bauern geliefert wurden.
41 Die Pfingstbötlinge (Hammel) und Zehntlämmer kamen
ebenfalls von abgabepflichtigen Bauern.
42 Vieh-Verzeichnis des Vorwerks beim Schloß Moisburg
vom 14.12.1616, zit. n. Förste 1995 (wie Anm. 12), S. 334f.
43 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 40.
44 HStA Celle Or. 1 Nr. 186 (wie Anm. 30).
45 Ernst Andreas von Cronhelm bewirtschaftete das
Vorwerk bis zu seinem Tod im Jahre 1739.
46 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 40.
47 Zit. n. Förste 1995 (wie Anm. 12), S. 272f.
48 HStA Hann. 74 Harburg Nr. 1893 (wie Anm. 39).
49 24 Schritt = 18,70 m
50 HStA Hann. 74 Tostedt Nr. 48: Verzeichniß aller und jeder
zu dem Amthause und Vorwerke Moisburg gehöriger Ge-
genstände. sine dato. Für die Datierung spricht die Tatsache,
dass im Verzeichnis die Jahreszahl 1692 in Zusammenhang
mit der Zerstörung des Langen Kovens durch einen Sturm
erwähnt wird und für 1694 bereits erste Abbrucharbeiten
am Schloss verbürgt sind, vgl. Meyne 1936 (wie Anm. 1), S.
38.
51 Die erste Beschreibung gibt die Länge des Vorwerkge-
bäudes mit nur elf Fachen an. Es heißt darin, dass die Außen-
wände komplett mit Flechtwerk und Lehmbewurf versehen
seien. Außer der Diele und den Räumen im Kammerfach
werden keine weiteren Räume genannt. Unklar bleibt, ob
hier evt. ein älterer Zustand beschrieben wird.
52 Vgl. u. a. Hartmut Bock, Die archäologische Untersuchun-
gen im Bereich des Wohnstallhauses von 1786 auf dem Hof
Nr. 3 in Maxdorf, in: Maxdorf in der Altmark. Lebensbild
eines Rundlingsdorfes von den Anfängen bis in die Neuzeit.
Hg. von den Museen des Altmarkkreises Salzwedel. Oschers-
leben 2006, S. 63f.
53 Aufgrund der Tatsache, dass der Untergrund im Bereich
des Vorwerkgeländes sehr feucht ist, konnten bei den mei-
sten Gebäuden keine Keller angelegt werden.
54 230 Fuß = 67 m.
55 HStA Hann. 74 Harburg Nr. 4624: Cammeralia - Miscel-
lenea - Commissiones - Commissio aus königl. Kammer die
Besichtigung der Moisburger, Appelbecker, Starsbecker
Papiermühlen, der Ovelgünder, Moisburger Vorwerker betr.
1707.
56 HStA Hann. Kartensammlung Nr. 250 K/86 pk: Ohn-
gefehrlicher Entwurf und Abriß der bey dem Vorwerk
Moisburg gehörigen Wiesen und Ländereien; auch wie diese
Letzteren 1. Maji 1731 von dem Verwalter Roggemann be-
stellt gefunden und seinem Successori Lehnhardt überliefert
worden sind. Zeichner unbekannt.
57 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 38. Das Amtshaus ist 1711
anstatt des damals abgebrochenen alten Schlosses erbaut
worden. D. Anton Friderich Büsching, Neue Erdbeschrei-
bung. Zehnter Teil. Schaffhausen 1768, S. 2294.
58 HStA Hann. Kartensammlung Nr. 33g Moisburg 4 pm:
Grundriss von den Amthause und beyden neben Fügeln zu
Moisburg, 1760, Zeichner: C. H. Havemann
59 Vgl. Hermann Mewes, Der lutherische Kirchenbau
Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der
Baumeister des Konsistoriums Hannover. Diss. Hannover
1943. Hg. und kommentiert von Stefan Amt. Hannover
1994.
60 Rolf Wiese, Museumsführer Moisburger Mühle (= Schrif-
ten des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Band 18). 2. Aufl.
Ehestorf 1995, S. 5.
61 Größe und die Bauweise des Moisburger Vorwerksgebäu-
de waren keinesfalls ungewöhnlich. Im benachbarten Amt
Harburg wiesen die Hauptgebäude der Vorwerke 1667 zwi-
schen 15 und 21 Fachen Länge auf. Das Hauptgebäude des
Vorwerks Hörsten umfasste einschließlich des zweistöckigen
Wohnteils sogar eine Länge von 29 Fachen, vgl. Kausche
(wie Anm. 39), S. 60ff.
62 HStA Hann. Kartensammlung Nr. 33 g. Moisburg 5 pm:
Zeichnungen von denen Haushalts- und Vorwercks Gebäu-
den zu Moisburg, 1760, Zeichner: C. H. Havemann. - HStA
Hann. Kartensammlung Nr. 33 g Moisburg 6 pm: Fernere
Zeichnungen von denen Haushalts und Vorwercks Gebäu-
den zu Moisburg, 1760, Zeichner C. H. Havemann. - HStA
Hann. 76a Nr. 371: Verzeichnis der in den hierin benannten
Fürstenthümern, Grafschaften und Herzogthümern befindli-
chen Schlösser, Amthäuser, Amtschreiber-, Amtsunterbe-
dienten, auch Försterwohnungen, dazu gehörigen Vor-
wercks- und Haushaltsgebäude, auch Wasser und Wind-
mühlen, 1767.
63 HStA Hann. 76a Nr. 413: Verzeichnisse der gesamten
herrschaftlichen Gebäude und Bauwerke in den Ämtern des
Fürstentums Lüneburg, 1799.
64 HStA Hann. 76a Nr. 413 (wie Anm. 63). Eine der
Beschreibung entsprechende Wasserversorgungsanlage mit
hölzerner Gefälleleitung konnte bei einer Grabung im nahe-
gelegenen Buxtehude dokumentiert werden, vgl. Bernd
Habermann, Brunnen oder Pumpe - Archäologische Be-
funde zur Trinkwasserversorgung in Buxtehude, in: Gerhard
M. Veh/Hans-Jürgen Rapsch (Hg.), Von Brunnen, und
Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der
Wasserversorgung in Niedersachsen. Neumünster 1998, S.
209-215, hier S. 213f.
65 Meyne 1936 (wie Anm. 1), S. 43.