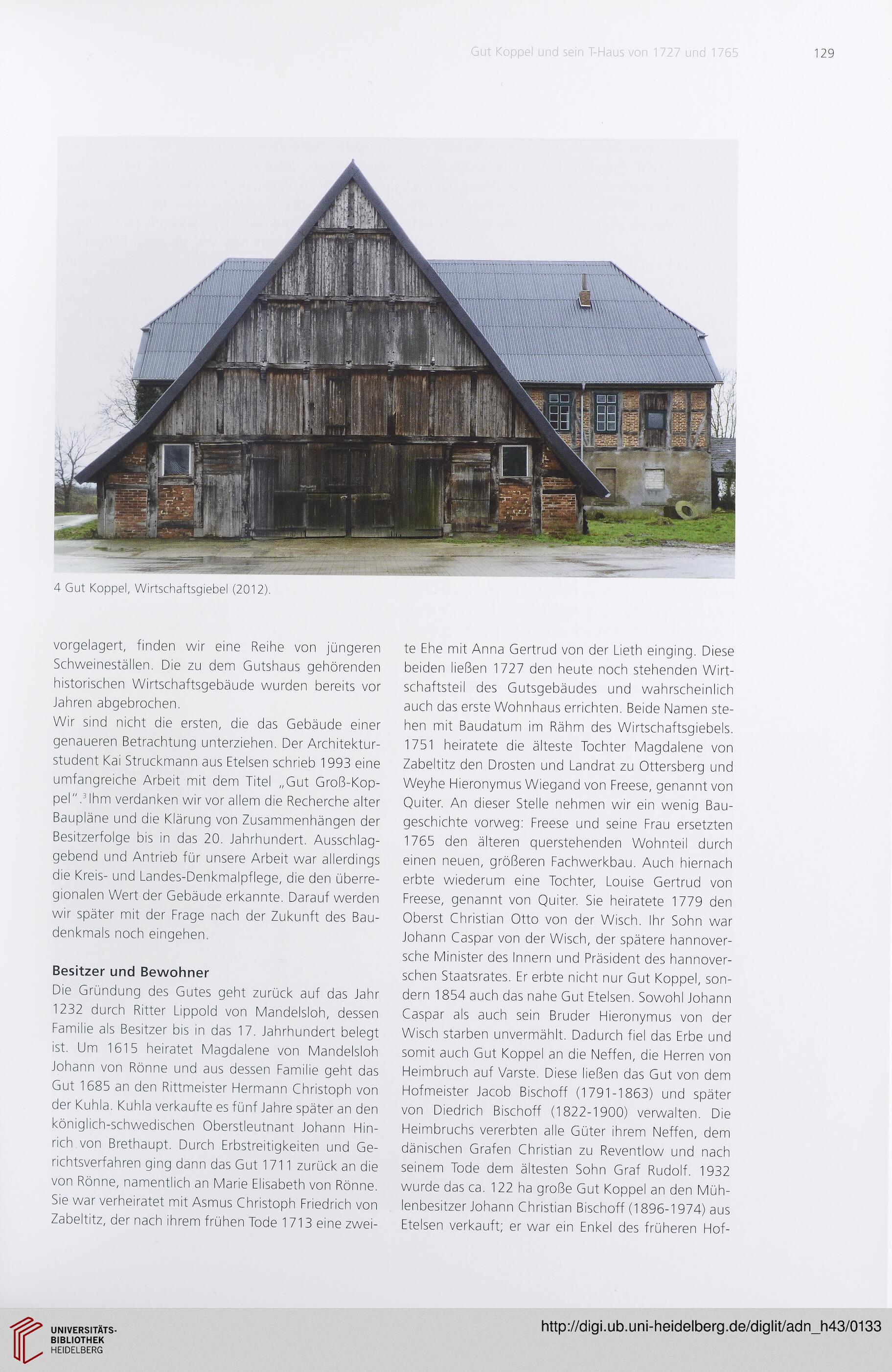Gut Koppel und sein T-Haus von 1727 und 1765
129
4 Gut Koppel, Wirtschaftsgiebel (2012).
vorgelagert, finden wir eine Reihe von jüngeren
Schweineställen. Die zu dem Gutshaus gehörenden
historischen Wirtschaftsgebäude wurden bereits vor
Jahren abgebrochen.
Wir sind nicht die ersten, die das Gebäude einer
genaueren Betrachtung unterziehen. Der Architektur-
student Kai Struckmann aus Etelsen schrieb 1993 eine
umfangreiche Arbeit mit dem Titel „Gut Groß-Kop-
pel".3lhm verdanken wir vor allem die Recherche alter
Baupläne und die Klärung von Zusammenhängen der
Besitzerfolge bis in das 20. Jahrhundert. Ausschlag-
gebend und Antrieb für unsere Arbeit war allerdings
die Kreis- und Landes-Denkmalpflege, die den überre-
gionalen Wert der Gebäude erkannte. Darauf werden
wir später mit der Frage nach der Zukunft des Bau-
denkmals noch eingehen.
Besitzer und Bewohner
Die Gründung des Gutes geht zurück auf das Jahr
1232 durch Ritter Lippold von Mandelsloh, dessen
Familie als Besitzer bis in das 17. Jahrhundert belegt
ist. Um 1615 heiratet Magdalene von Mandelsloh
Johann von Rönne und aus dessen Familie geht das
Gut 1685 an den Rittmeister Hermann Christoph von
der Kuhla. Kuhla verkaufte es fünf Jahre später an den
königlich-schwedischen Oberstleutnant Johann Hin-
rich von Brethaupt. Durch Erbstreitigkeiten und Ge-
richtsverfahren ging dann das Gut 1711 zurück an die
von Rönne, namentlich an Marie Elisabeth von Rönne.
Sie war verheiratet mit Asmus Christoph Friedrich von
Zabeltitz, der nach ihrem frühen Tode 1713 eine zwei-
te Ehe mit Anna Gertrud von der Lieth einging. Diese
beiden ließen 1727 den heute noch stehenden Wirt-
schaftsteil des Gutsgebäudes und wahrscheinlich
auch das erste Wohnhaus errichten. Beide Namen ste-
hen mit Baudatum im Rähm des Wirtschaftsgiebels.
1751 heiratete die älteste Tochter Magdalene von
Zabeltitz den Drosten und Landrat zu Ottersberg und
Weyhe Hieronymus Wiegand von Freese, genannt von
Quiter. An dieser Stelle nehmen wir ein wenig Bau-
geschichte vorweg: Freese und seine Frau ersetzten
1765 den älteren querstehenden Wohnteil durch
einen neuen, größeren Fachwerkbau. Auch hiernach
erbte wiederum eine Tochter, Louise Gertrud von
Freese, genannt von Quiter. Sie heiratete 1779 den
Oberst Christian Otto von der Wisch. Ihr Sohn war
Johann Caspar von der Wisch, der spätere hannover-
sche Minister des Innern und Präsident des hannover-
schen Staatsrates. Er erbte nicht nur Gut Koppel, son-
dern 1854 auch das nahe Gut Etelsen. Sowohl Johann
Caspar als auch sein Bruder Hieronymus von der
Wisch starben unvermählt. Dadurch fiel das Erbe und
somit auch Gut Koppel an die Neffen, die Herren von
Heimbruch auf Varste. Diese ließen das Gut von dem
Hofmeister Jacob Bischoff (1791-1863) und später
von Diedrich Bischoff (1822-1900) verwalten. Die
Heimbruchs vererbten alle Güter ihrem Neffen, dem
dänischen Grafen Christian zu Reventlow und nach
seinem Tode dem ältesten Sohn Graf Rudolf. 1932
wurde das ca. 122 ha große Gut Koppel an den Müh-
lenbesitzer Johann Christian Bischoff (1896-1974) aus
Etelsen verkauft; er war ein Enkel des früheren Hof-
129
4 Gut Koppel, Wirtschaftsgiebel (2012).
vorgelagert, finden wir eine Reihe von jüngeren
Schweineställen. Die zu dem Gutshaus gehörenden
historischen Wirtschaftsgebäude wurden bereits vor
Jahren abgebrochen.
Wir sind nicht die ersten, die das Gebäude einer
genaueren Betrachtung unterziehen. Der Architektur-
student Kai Struckmann aus Etelsen schrieb 1993 eine
umfangreiche Arbeit mit dem Titel „Gut Groß-Kop-
pel".3lhm verdanken wir vor allem die Recherche alter
Baupläne und die Klärung von Zusammenhängen der
Besitzerfolge bis in das 20. Jahrhundert. Ausschlag-
gebend und Antrieb für unsere Arbeit war allerdings
die Kreis- und Landes-Denkmalpflege, die den überre-
gionalen Wert der Gebäude erkannte. Darauf werden
wir später mit der Frage nach der Zukunft des Bau-
denkmals noch eingehen.
Besitzer und Bewohner
Die Gründung des Gutes geht zurück auf das Jahr
1232 durch Ritter Lippold von Mandelsloh, dessen
Familie als Besitzer bis in das 17. Jahrhundert belegt
ist. Um 1615 heiratet Magdalene von Mandelsloh
Johann von Rönne und aus dessen Familie geht das
Gut 1685 an den Rittmeister Hermann Christoph von
der Kuhla. Kuhla verkaufte es fünf Jahre später an den
königlich-schwedischen Oberstleutnant Johann Hin-
rich von Brethaupt. Durch Erbstreitigkeiten und Ge-
richtsverfahren ging dann das Gut 1711 zurück an die
von Rönne, namentlich an Marie Elisabeth von Rönne.
Sie war verheiratet mit Asmus Christoph Friedrich von
Zabeltitz, der nach ihrem frühen Tode 1713 eine zwei-
te Ehe mit Anna Gertrud von der Lieth einging. Diese
beiden ließen 1727 den heute noch stehenden Wirt-
schaftsteil des Gutsgebäudes und wahrscheinlich
auch das erste Wohnhaus errichten. Beide Namen ste-
hen mit Baudatum im Rähm des Wirtschaftsgiebels.
1751 heiratete die älteste Tochter Magdalene von
Zabeltitz den Drosten und Landrat zu Ottersberg und
Weyhe Hieronymus Wiegand von Freese, genannt von
Quiter. An dieser Stelle nehmen wir ein wenig Bau-
geschichte vorweg: Freese und seine Frau ersetzten
1765 den älteren querstehenden Wohnteil durch
einen neuen, größeren Fachwerkbau. Auch hiernach
erbte wiederum eine Tochter, Louise Gertrud von
Freese, genannt von Quiter. Sie heiratete 1779 den
Oberst Christian Otto von der Wisch. Ihr Sohn war
Johann Caspar von der Wisch, der spätere hannover-
sche Minister des Innern und Präsident des hannover-
schen Staatsrates. Er erbte nicht nur Gut Koppel, son-
dern 1854 auch das nahe Gut Etelsen. Sowohl Johann
Caspar als auch sein Bruder Hieronymus von der
Wisch starben unvermählt. Dadurch fiel das Erbe und
somit auch Gut Koppel an die Neffen, die Herren von
Heimbruch auf Varste. Diese ließen das Gut von dem
Hofmeister Jacob Bischoff (1791-1863) und später
von Diedrich Bischoff (1822-1900) verwalten. Die
Heimbruchs vererbten alle Güter ihrem Neffen, dem
dänischen Grafen Christian zu Reventlow und nach
seinem Tode dem ältesten Sohn Graf Rudolf. 1932
wurde das ca. 122 ha große Gut Koppel an den Müh-
lenbesitzer Johann Christian Bischoff (1896-1974) aus
Etelsen verkauft; er war ein Enkel des früheren Hof-