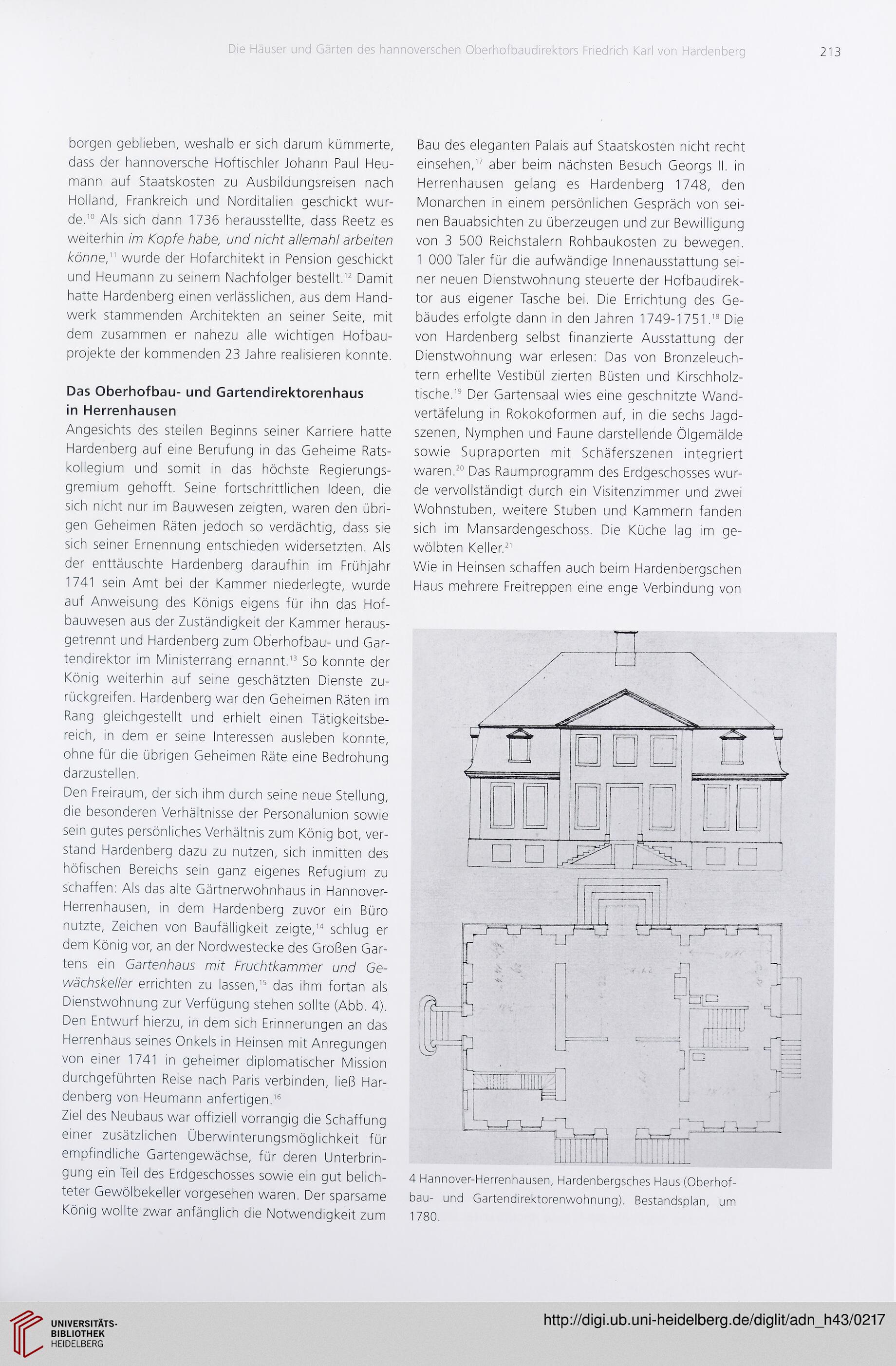Die Häuser und Gärten des hannoverschen Oberhofbaudirektors Friedrich Karl von Hardenberg
213
borgen geblieben, weshalb er sich darum kümmerte,
dass der hannoversche Hoftischler Johann Paul Heu-
mann auf Staatskosten zu Ausbildungsreisen nach
Holland, Frankreich und Norditalien geschickt wur-
de.10 Als sich dann 1736 herausstellte, dass Reetz es
weiterhin im Kopfe habe, und nicht allemahl arbeiten
könne," wurde der Hofarchitekt in Pension geschickt
und Heumann zu seinem Nachfolger bestellt.12 Damit
hatte Hardenberg einen verlässlichen, aus dem Hand-
werk stammenden Architekten an seiner Seite, mit
dem zusammen er nahezu alle wichtigen Hofbau-
projekte der kommenden 23 Jahre realisieren konnte.
Das Oberhofbau- und Gartendirektorenhaus
in Herrenhausen
Angesichts des steilen Beginns seiner Karriere hatte
Hardenberg auf eine Berufung in das Geheime Rats-
kollegium und somit in das höchste Regierungs-
gremium gehofft. Seine fortschrittlichen Ideen, die
sich nicht nur im Bauwesen zeigten, waren den übri-
gen Geheimen Räten jedoch so verdächtig, dass sie
sich seiner Ernennung entschieden widersetzten. Als
der enttäuschte Hardenberg daraufhin im Frühjahr
1741 sein Amt bei der Kammer niederlegte, wurde
auf Anweisung des Königs eigens für ihn das Hof-
bauwesen aus der Zuständigkeit der Kammer heraus-
getrennt und Hardenberg zum Oberhofbau- und Gar-
tendirektor im Ministerrang ernannt.13 So konnte der
König weiterhin auf seine geschätzten Dienste zu-
rückgreifen. Hardenberg war den Geheimen Räten im
Rang gleichgestellt und erhielt einen Tätigkeitsbe-
reich, in dem er seine Interessen ausleben konnte,
ohne für die übrigen Geheimen Räte eine Bedrohung
darzustellen.
Den Freiraum, der sich ihm durch seine neue Stellung,
die besonderen Verhältnisse der Personalunion sowie
sein gutes persönliches Verhältnis zum König bot, ver-
stand Hardenberg dazu zu nutzen, sich inmitten des
höfischen Bereichs sein ganz eigenes Refugium zu
schaffen: Als das alte Gärtnerwohnhaus in Hannover-
Herrenhausen, in dem Hardenberg zuvor ein Büro
nutzte, Zeichen von Baufälligkeit zeigte,14 schlug er
dem König vor, an der Nordwestecke des Großen Gar-
tens ein Gartenhaus mit Fruchtkammer und Ge-
wächskeller errichten zu lassen,15 das ihm fortan als
Dienstwohnung zur Verfügung stehen sollte (Abb. 4).
Den Entwurf hierzu, in dem sich Erinnerungen an das
Herrenhaus seines Onkels in Heinsen mit Anregungen
von einer 1741 in geheimer diplomatischer Mission
durchgeführten Reise nach Paris verbinden, ließ Har-
denberg von Heumann anfertigen.16
Ziel des Neubaus war offiziell vorrangig die Schaffung
einer zusätzlichen Überwinterungsmöglichkeit für
empfindliche Gartengewächse, für deren Unterbrin-
gung ein Teil des Erdgeschosses sowie ein gut belich-
teter Gewölbekeller vorgesehen waren. Der sparsame
König wollte zwar anfänglich die Notwendigkeit zum
Bau des eleganten Palais auf Staatskosten nicht recht
einsehen,17 aber beim nächsten Besuch Georgs II. in
Herrenhausen gelang es Hardenberg 1748, den
Monarchen in einem persönlichen Gespräch von sei-
nen Bauabsichten zu überzeugen und zur Bewilligung
von 3 500 Reichstalern Rohbaukosten zu bewegen.
1 000 Taler für die aufwändige Innenausstattung sei-
ner neuen Dienstwohnung steuerte der Hofbaudirek-
tor aus eigener Tasche bei. Die Errichtung des Ge-
bäudes erfolgte dann in den Jahren 1749-1751,18 Die
von Hardenberg selbst finanzierte Ausstattung der
Dienstwohnung war erlesen: Das von Bronzeleuch-
tern erhellte Vestibül zierten Büsten und Kirschholz-
tische.19 Der Gartensaal wies eine geschnitzte Wand-
vertäfelung in Rokokoformen auf, in die sechs Jagd-
szenen, Nymphen und Faune darstellende Ölgemälde
sowie Supraporten mit Schäferszenen integriert
waren.20 Das Raumprogramm des Erdgeschosses wur-
de vervollständigt durch ein Visitenzimmer und zwei
Wohnstuben, weitere Stuben und Kammern fanden
sich im Mansardengeschoss. Die Küche lag im ge-
wölbten Keller.21
Wie in Heinsen schaffen auch beim Hardenbergschen
Haus mehrere Freitreppen eine enge Verbindung von
4 Hannover-Herrenhausen, Hardenbergsches Haus (Oberhof-
bau- und Gartendirektorenwohnung). Bestandsplan, um
1780.
213
borgen geblieben, weshalb er sich darum kümmerte,
dass der hannoversche Hoftischler Johann Paul Heu-
mann auf Staatskosten zu Ausbildungsreisen nach
Holland, Frankreich und Norditalien geschickt wur-
de.10 Als sich dann 1736 herausstellte, dass Reetz es
weiterhin im Kopfe habe, und nicht allemahl arbeiten
könne," wurde der Hofarchitekt in Pension geschickt
und Heumann zu seinem Nachfolger bestellt.12 Damit
hatte Hardenberg einen verlässlichen, aus dem Hand-
werk stammenden Architekten an seiner Seite, mit
dem zusammen er nahezu alle wichtigen Hofbau-
projekte der kommenden 23 Jahre realisieren konnte.
Das Oberhofbau- und Gartendirektorenhaus
in Herrenhausen
Angesichts des steilen Beginns seiner Karriere hatte
Hardenberg auf eine Berufung in das Geheime Rats-
kollegium und somit in das höchste Regierungs-
gremium gehofft. Seine fortschrittlichen Ideen, die
sich nicht nur im Bauwesen zeigten, waren den übri-
gen Geheimen Räten jedoch so verdächtig, dass sie
sich seiner Ernennung entschieden widersetzten. Als
der enttäuschte Hardenberg daraufhin im Frühjahr
1741 sein Amt bei der Kammer niederlegte, wurde
auf Anweisung des Königs eigens für ihn das Hof-
bauwesen aus der Zuständigkeit der Kammer heraus-
getrennt und Hardenberg zum Oberhofbau- und Gar-
tendirektor im Ministerrang ernannt.13 So konnte der
König weiterhin auf seine geschätzten Dienste zu-
rückgreifen. Hardenberg war den Geheimen Räten im
Rang gleichgestellt und erhielt einen Tätigkeitsbe-
reich, in dem er seine Interessen ausleben konnte,
ohne für die übrigen Geheimen Räte eine Bedrohung
darzustellen.
Den Freiraum, der sich ihm durch seine neue Stellung,
die besonderen Verhältnisse der Personalunion sowie
sein gutes persönliches Verhältnis zum König bot, ver-
stand Hardenberg dazu zu nutzen, sich inmitten des
höfischen Bereichs sein ganz eigenes Refugium zu
schaffen: Als das alte Gärtnerwohnhaus in Hannover-
Herrenhausen, in dem Hardenberg zuvor ein Büro
nutzte, Zeichen von Baufälligkeit zeigte,14 schlug er
dem König vor, an der Nordwestecke des Großen Gar-
tens ein Gartenhaus mit Fruchtkammer und Ge-
wächskeller errichten zu lassen,15 das ihm fortan als
Dienstwohnung zur Verfügung stehen sollte (Abb. 4).
Den Entwurf hierzu, in dem sich Erinnerungen an das
Herrenhaus seines Onkels in Heinsen mit Anregungen
von einer 1741 in geheimer diplomatischer Mission
durchgeführten Reise nach Paris verbinden, ließ Har-
denberg von Heumann anfertigen.16
Ziel des Neubaus war offiziell vorrangig die Schaffung
einer zusätzlichen Überwinterungsmöglichkeit für
empfindliche Gartengewächse, für deren Unterbrin-
gung ein Teil des Erdgeschosses sowie ein gut belich-
teter Gewölbekeller vorgesehen waren. Der sparsame
König wollte zwar anfänglich die Notwendigkeit zum
Bau des eleganten Palais auf Staatskosten nicht recht
einsehen,17 aber beim nächsten Besuch Georgs II. in
Herrenhausen gelang es Hardenberg 1748, den
Monarchen in einem persönlichen Gespräch von sei-
nen Bauabsichten zu überzeugen und zur Bewilligung
von 3 500 Reichstalern Rohbaukosten zu bewegen.
1 000 Taler für die aufwändige Innenausstattung sei-
ner neuen Dienstwohnung steuerte der Hofbaudirek-
tor aus eigener Tasche bei. Die Errichtung des Ge-
bäudes erfolgte dann in den Jahren 1749-1751,18 Die
von Hardenberg selbst finanzierte Ausstattung der
Dienstwohnung war erlesen: Das von Bronzeleuch-
tern erhellte Vestibül zierten Büsten und Kirschholz-
tische.19 Der Gartensaal wies eine geschnitzte Wand-
vertäfelung in Rokokoformen auf, in die sechs Jagd-
szenen, Nymphen und Faune darstellende Ölgemälde
sowie Supraporten mit Schäferszenen integriert
waren.20 Das Raumprogramm des Erdgeschosses wur-
de vervollständigt durch ein Visitenzimmer und zwei
Wohnstuben, weitere Stuben und Kammern fanden
sich im Mansardengeschoss. Die Küche lag im ge-
wölbten Keller.21
Wie in Heinsen schaffen auch beim Hardenbergschen
Haus mehrere Freitreppen eine enge Verbindung von
4 Hannover-Herrenhausen, Hardenbergsches Haus (Oberhof-
bau- und Gartendirektorenwohnung). Bestandsplan, um
1780.