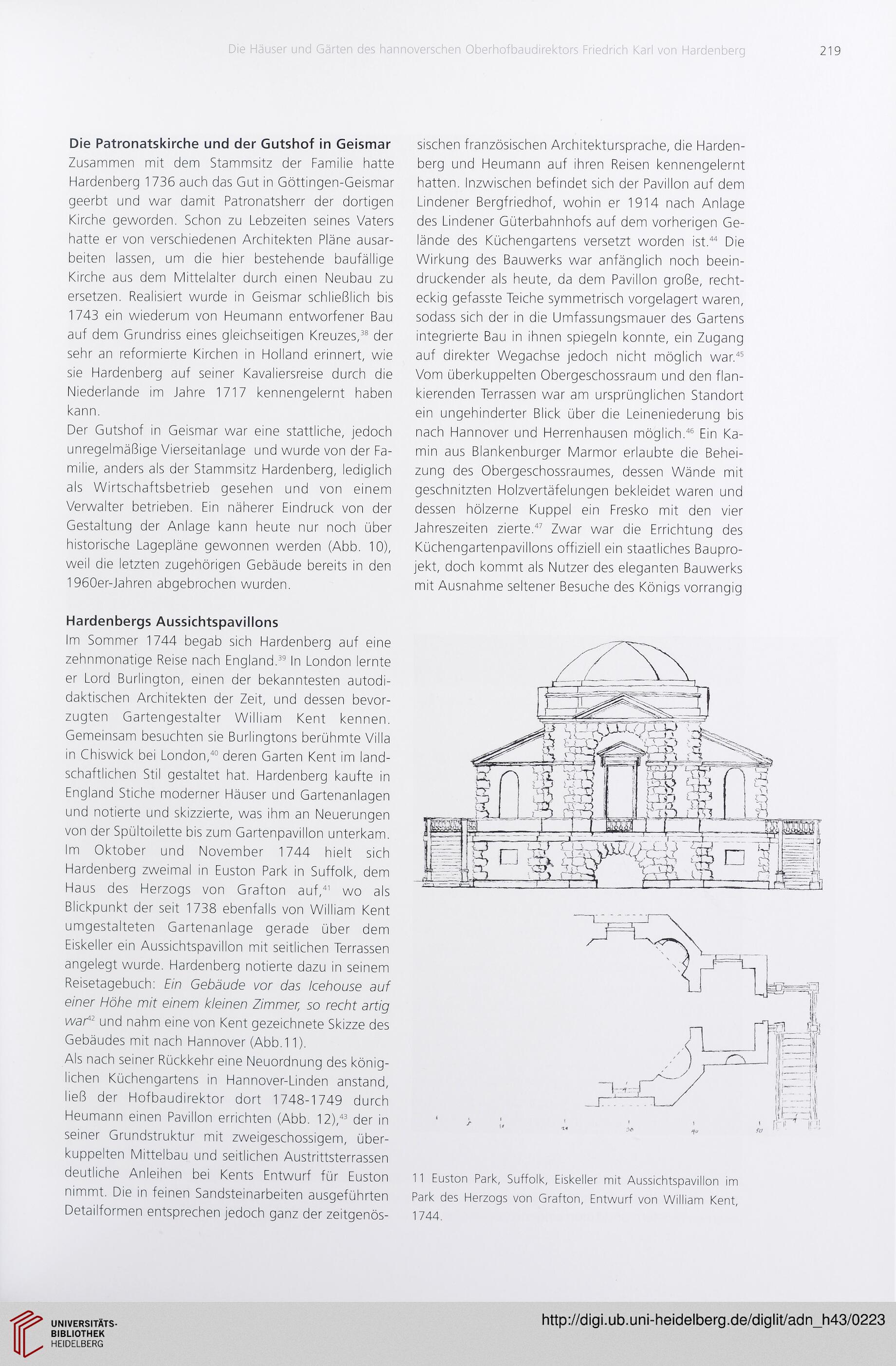Die Häuser und Gärten des hannoverschen Oberhofbaudirektors Friedrich Karl von Hardenberg
219
Die Patronatskirche und der Gutshof in Geismar
Zusammen mit dem Stammsitz der Familie hatte
Hardenberg 1736 auch das Gut in Göttingen-Geismar
geerbt und war damit Patronatsherr der dortigen
Kirche geworden. Schon zu Lebzeiten seines Vaters
hatte er von verschiedenen Architekten Pläne ausar-
beiten lassen, um die hier bestehende baufällige
Kirche aus dem Mittelalter durch einen Neubau zu
ersetzen. Realisiert wurde in Geismar schließlich bis
1743 ein wiederum von Heumann entworfener Bau
auf dem Grundriss eines gleichseitigen Kreuzes,38 der
sehr an reformierte Kirchen in Holland erinnert, wie
sie Hardenberg auf seiner Kavaliersreise durch die
Niederlande im Jahre 1717 kennengelernt haben
kann.
Der Gutshof in Geismar war eine stattliche, jedoch
unregelmäßige Vierseitanlage und wurde von der Fa-
milie, anders als der Stammsitz Hardenberg, lediglich
als Wirtschaftsbetrieb gesehen und von einem
Verwalter betrieben. Ein näherer Eindruck von der
Gestaltung der Anlage kann heute nur noch über
historische Lagepläne gewonnen werden (Abb. 10),
weil die letzten zugehörigen Gebäude bereits in den
1960er-Jahren abgebrochen wurden.
sischen französischen Architektursprache, die Harden-
berg und Heumann auf ihren Reisen kennengelernt
hatten. Inzwischen befindet sich der Pavillon auf dem
Lindener Bergfriedhof, wohin er 1914 nach Anlage
des Lindener Güterbahnhofs auf dem vorherigen Ge-
lände des Küchengartens versetzt worden ist.44 Die
Wirkung des Bauwerks war anfänglich noch beein-
druckender als heute, da dem Pavillon große, recht-
eckig gefasste Teiche symmetrisch vorgelagert waren,
sodass sich der in die Umfassungsmauer des Gartens
integrierte Bau in ihnen spiegeln konnte, ein Zugang
auf direkter Wegachse jedoch nicht möglich war.45
Vom überkuppelten Obergeschossraum und den flan-
kierenden Terrassen war am ursprünglichen Standort
ein ungehinderter Blick über die Leineniederung bis
nach Hannover und Herrenhausen möglich.46 Ein Ka-
min aus Blankenburger Marmor erlaubte die Behei-
zung des Obergeschossraumes, dessen Wände mit
geschnitzten Holzvertäfelungen bekleidet waren und
dessen hölzerne Kuppel ein Fresko mit den vier
Jahreszeiten zierte.47 Zwar war die Errichtung des
Küchengartenpavillons offiziell ein staatliches Baupro-
jekt, doch kommt als Nutzer des eleganten Bauwerks
mit Ausnahme seltener Besuche des Königs vorrangig
Hardenbergs Aussichtspavillons
Im Sommer 1744 begab sich Hardenberg auf eine
zehnmonatige Reise nach England.39 In London lernte
er Lord Burlington, einen der bekanntesten autodi-
daktischen Architekten der Zeit, und dessen bevor-
zugten Gartengestalter William Kent kennen.
Gemeinsam besuchten sie Burlingtons berühmte Villa
in Chiswick bei London,40 deren Garten Kent im land-
schaftlichen Stil gestaltet hat. Hardenberg kaufte in
England Stiche moderner Häuser und Gartenanlagen
und notierte und skizzierte, was ihm an Neuerungen
von der Spültoilette bis zum Gartenpavillon unterkam.
Im Oktober und November 1744 hielt sich
Hardenberg zweimal in Euston Park in Suffolk, dem
Haus des Herzogs von Grafton auf,41 wo als
Blickpunkt der seit 1738 ebenfalls von William Kent
umgestalteten Gartenanlage gerade über dem
Eiskeller ein Aussichtspavillon mit seitlichen Terrassen
angelegt wurde. Hardenberg notierte dazu in seinem
Reisetagebuch: Ein Gebäude vor das Icehouse auf
einer Höhe mit einem kleinen Zimmer, so recht artig
war42 und nahm eine von Kent gezeichnete Skizze des
Gebäudes mit nach Hannover (Abb.11).
Als nach seiner Rückkehr eine Neuordnung des könig-
lichen Küchengartens in Hannover-Linden anstand,
ließ der Hofbaudirektor dort 1748-1749 durch
Heumann einen Pavillon errichten (Abb. 12),43 der in
seiner Grundstruktur mit zweigeschossigem, über-
kuppelten Mittelbau und seitlichen Austrittsterrassen
deutliche Anleihen bei Kents Entwurf für Euston
nimmt. Die in feinen Sandsteinarbeiten ausgeführten
Detailformen entsprechen jedoch ganz der zeitgenös-
11 Euston Park, Suffolk, Eiskeller mit Aussichtspavillon im
Park des Herzogs von Grafton, Entwurf von William Kent,
1744.
219
Die Patronatskirche und der Gutshof in Geismar
Zusammen mit dem Stammsitz der Familie hatte
Hardenberg 1736 auch das Gut in Göttingen-Geismar
geerbt und war damit Patronatsherr der dortigen
Kirche geworden. Schon zu Lebzeiten seines Vaters
hatte er von verschiedenen Architekten Pläne ausar-
beiten lassen, um die hier bestehende baufällige
Kirche aus dem Mittelalter durch einen Neubau zu
ersetzen. Realisiert wurde in Geismar schließlich bis
1743 ein wiederum von Heumann entworfener Bau
auf dem Grundriss eines gleichseitigen Kreuzes,38 der
sehr an reformierte Kirchen in Holland erinnert, wie
sie Hardenberg auf seiner Kavaliersreise durch die
Niederlande im Jahre 1717 kennengelernt haben
kann.
Der Gutshof in Geismar war eine stattliche, jedoch
unregelmäßige Vierseitanlage und wurde von der Fa-
milie, anders als der Stammsitz Hardenberg, lediglich
als Wirtschaftsbetrieb gesehen und von einem
Verwalter betrieben. Ein näherer Eindruck von der
Gestaltung der Anlage kann heute nur noch über
historische Lagepläne gewonnen werden (Abb. 10),
weil die letzten zugehörigen Gebäude bereits in den
1960er-Jahren abgebrochen wurden.
sischen französischen Architektursprache, die Harden-
berg und Heumann auf ihren Reisen kennengelernt
hatten. Inzwischen befindet sich der Pavillon auf dem
Lindener Bergfriedhof, wohin er 1914 nach Anlage
des Lindener Güterbahnhofs auf dem vorherigen Ge-
lände des Küchengartens versetzt worden ist.44 Die
Wirkung des Bauwerks war anfänglich noch beein-
druckender als heute, da dem Pavillon große, recht-
eckig gefasste Teiche symmetrisch vorgelagert waren,
sodass sich der in die Umfassungsmauer des Gartens
integrierte Bau in ihnen spiegeln konnte, ein Zugang
auf direkter Wegachse jedoch nicht möglich war.45
Vom überkuppelten Obergeschossraum und den flan-
kierenden Terrassen war am ursprünglichen Standort
ein ungehinderter Blick über die Leineniederung bis
nach Hannover und Herrenhausen möglich.46 Ein Ka-
min aus Blankenburger Marmor erlaubte die Behei-
zung des Obergeschossraumes, dessen Wände mit
geschnitzten Holzvertäfelungen bekleidet waren und
dessen hölzerne Kuppel ein Fresko mit den vier
Jahreszeiten zierte.47 Zwar war die Errichtung des
Küchengartenpavillons offiziell ein staatliches Baupro-
jekt, doch kommt als Nutzer des eleganten Bauwerks
mit Ausnahme seltener Besuche des Königs vorrangig
Hardenbergs Aussichtspavillons
Im Sommer 1744 begab sich Hardenberg auf eine
zehnmonatige Reise nach England.39 In London lernte
er Lord Burlington, einen der bekanntesten autodi-
daktischen Architekten der Zeit, und dessen bevor-
zugten Gartengestalter William Kent kennen.
Gemeinsam besuchten sie Burlingtons berühmte Villa
in Chiswick bei London,40 deren Garten Kent im land-
schaftlichen Stil gestaltet hat. Hardenberg kaufte in
England Stiche moderner Häuser und Gartenanlagen
und notierte und skizzierte, was ihm an Neuerungen
von der Spültoilette bis zum Gartenpavillon unterkam.
Im Oktober und November 1744 hielt sich
Hardenberg zweimal in Euston Park in Suffolk, dem
Haus des Herzogs von Grafton auf,41 wo als
Blickpunkt der seit 1738 ebenfalls von William Kent
umgestalteten Gartenanlage gerade über dem
Eiskeller ein Aussichtspavillon mit seitlichen Terrassen
angelegt wurde. Hardenberg notierte dazu in seinem
Reisetagebuch: Ein Gebäude vor das Icehouse auf
einer Höhe mit einem kleinen Zimmer, so recht artig
war42 und nahm eine von Kent gezeichnete Skizze des
Gebäudes mit nach Hannover (Abb.11).
Als nach seiner Rückkehr eine Neuordnung des könig-
lichen Küchengartens in Hannover-Linden anstand,
ließ der Hofbaudirektor dort 1748-1749 durch
Heumann einen Pavillon errichten (Abb. 12),43 der in
seiner Grundstruktur mit zweigeschossigem, über-
kuppelten Mittelbau und seitlichen Austrittsterrassen
deutliche Anleihen bei Kents Entwurf für Euston
nimmt. Die in feinen Sandsteinarbeiten ausgeführten
Detailformen entsprechen jedoch ganz der zeitgenös-
11 Euston Park, Suffolk, Eiskeller mit Aussichtspavillon im
Park des Herzogs von Grafton, Entwurf von William Kent,
1744.