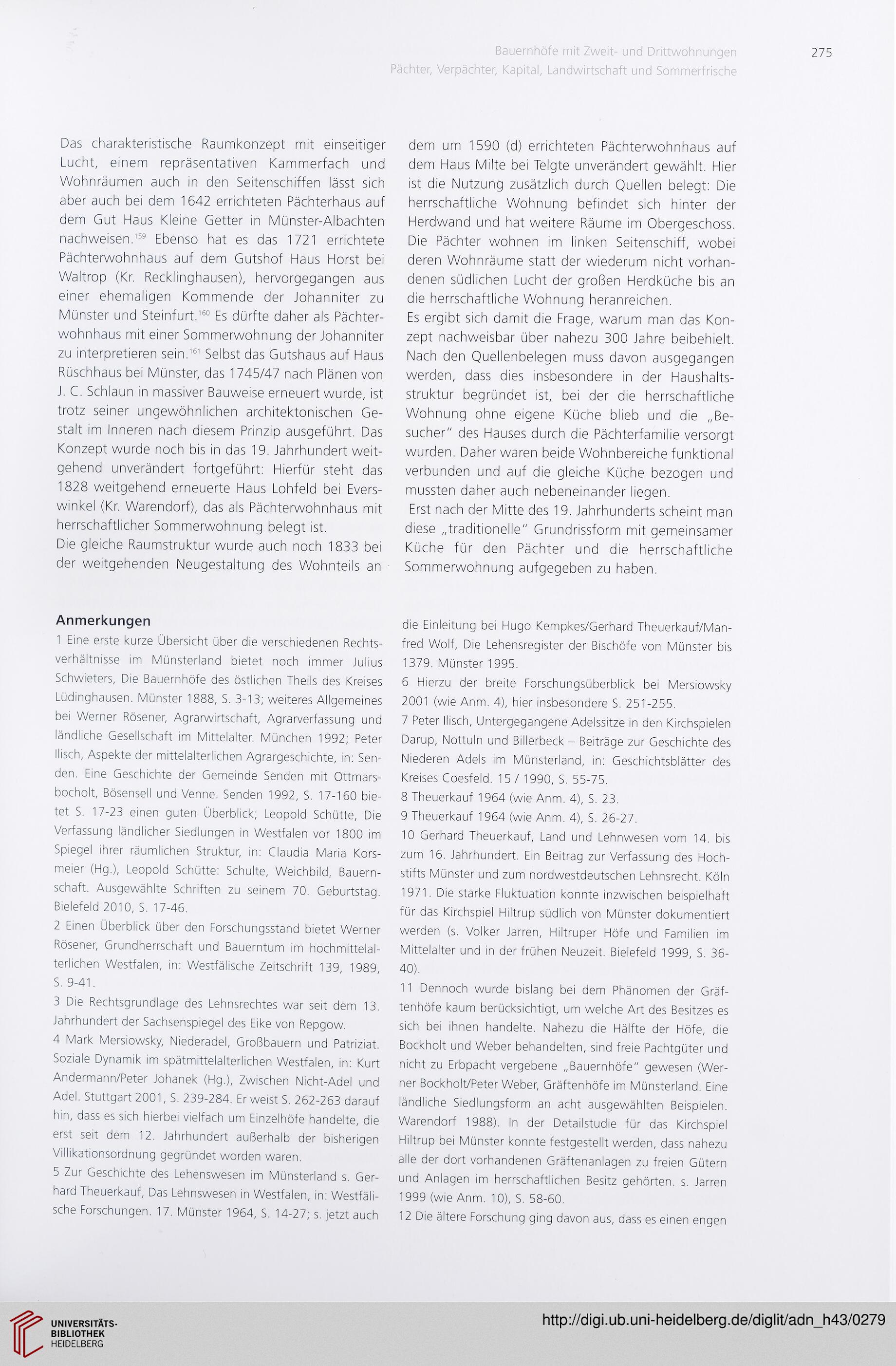Bauernhöfe mit Zweit- und Drittwohnungen
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
Das charakteristische Raumkonzept mit einseitiger
Lucht, einem repräsentativen Kammerfach und
Wohnräumen auch in den Seitenschiffen lässt sich
aber auch bei dem 1642 errichteten Pächterhaus auf
dem Gut Haus Kleine Getter in Münster-Albachten
nachweisen.159 Ebenso hat es das 1721 errichtete
Pächterwohnhaus auf dem Gutshof Haus Horst bei
Waltrop (Kr. Recklinghausen), hervorgegangen aus
einer ehemaligen Kommende der Johanniter zu
Münster und Steinfurt.160 Es dürfte daher als Pächter-
wohnhaus mit einer Sommerwohnung der Johanniter
zu interpretieren sein.161 Selbst das Gutshaus auf Haus
Rüschhaus bei Münster, das 1745/47 nach Plänen von
J. C. Schlaun in massiver Bauweise erneuert wurde, ist
trotz seiner ungewöhnlichen architektonischen Ge-
stalt im Inneren nach diesem Prinzip ausgeführt. Das
Konzept wurde noch bis in das 19. Jahrhundert weit-
gehend unverändert fortgeführt: Hierfür steht das
1828 weitgehend erneuerte Haus Lohfeld bei Evers-
winkel (Kr. Warendorf), das als Pächterwohnhaus mit
herrschaftlicher Sommerwohnung belegt ist.
Die gleiche Raumstruktur wurde auch noch 1833 bei
der weitgehenden Neugestaltung des Wohnteils an
dem um 1590 (d) errichteten Pächterwohnhaus auf
dem Haus Milte bei Telgte unverändert gewählt. Hier
ist die Nutzung zusätzlich durch Quellen belegt: Die
herrschaftliche Wohnung befindet sich hinter der
Herdwand und hat weitere Räume im Obergeschoss.
Die Pächter wohnen im linken Seitenschiff, wobei
deren Wohnräume statt der wiederum nicht vorhan-
denen südlichen Lucht der großen Herdküche bis an
die herrschaftliche Wohnung heranreichen.
Es ergibt sich damit die Frage, warum man das Kon-
zept nachweisbar über nahezu 300 Jahre beibehielt.
Nach den Quellenbelegen muss davon ausgegangen
werden, dass dies insbesondere in der Haushalts-
struktur begründet ist, bei der die herrschaftliche
Wohnung ohne eigene Küche blieb und die „Be-
sucher" des Hauses durch die Pächterfamilie versorgt
wurden. Daher waren beide Wohnbereiche funktional
verbunden und auf die gleiche Küche bezogen und
mussten daher auch nebeneinander liegen.
Erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts scheint man
diese „traditionelle" Grundrissform mit gemeinsamer
Küche für den Pächter und die herrschaftliche
Sommerwohnung aufgegeben zu haben.
Anmerkungen
1 Eine erste kurze Übersicht über die verschiedenen Rechts-
verhältnisse im Münsterland bietet noch immer Julius
Schwieters, Die Bauernhöfe des östlichen Theils des Kreises
Lüdinghausen. Münster 1888, S. 3-13; weiteres Allgemeines
bei Werner Rösener, Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und
ländliche Gesellschaft im Mittelalter. München 1992; Peter
llisch, Aspekte der mittelalterlichen Agrargeschichte, in: Sen-
den. Eine Geschichte der Gemeinde Senden mit Ottmars-
bocholt, Bösensell und Venne. Senden 1992, S. 17-160 bie-
tet S. 17-23 einen guten Überblick; Leopold Schütte, Die
Verfassung ländlicher Siedlungen in Westfalen vor 1800 im
Spiegel ihrer räumlichen Struktur, in: Claudia Maria Kors-
meier (Hg.), Leopold Schütte: Schulte, Weichbild. Bauern-
schaft. Ausgewählte Schriften zu seinem 70. Geburtstag.
Bielefeld 2010, S. 17-46.
2 Einen Überblick über den Forschungsstand bietet Werner
Rösener, Grundherrschaft und Bauerntum im hochmittelal-
terlichen Westfalen, in: Westfälische Zeitschrift 139, 1989,
S. 9-41.
3 Die Rechtsgrundlage des Lehnsrechtes war seit dem 13.
Jahrhundert der Sachsenspiegel des Eike von Repgow.
4 Mark Mersiowsky, Niederadel, Großbauern und Patriziat.
Soziale Dynamik im spätmittelalterlichen Westfalen, in: Kurt
Andermann/Peter Johanek (Hg.), Zwischen Nicht-Adel und
Adel. Stuttgart 2001, S. 239-284. Er weist S. 262-263 darauf
hin, dass es sich hierbei vielfach um Einzelhöfe handelte, die
erst seit dem 12. Jahrhundert außerhalb der bisherigen
Villikationsordnung gegründet worden waren.
5 Zur Geschichte des Lehenswesen im Münsterland s. Ger-
hard Theuerkauf, Das Lehnswesen in Westfalen, in: Westfäli-
sche Forschungen. 17. Münster 1964, S. 14-27; s. jetzt auch
die Einleitung bei Hugo Kempkes/Gerhard Theuerkauf/Man-
fred Wolf, Die Lehensregister der Bischöfe von Münster bis
1379. Münster 1995.
6 Hierzu der breite Forschungsüberblick bei Mersiowsky
2001 (wie Anm. 4), hier insbesondere S. 251-255.
7 Peter llisch, Untergegangene Adelssitze in den Kirchspielen
Darup, Nottuln und Billerbeck - Beiträge zur Geschichte des
Niederen Adels im Münsterland, in: Geschichtsblätter des
Kreises Coesfeld. 15/ 1990, S. 55-75.
8 Theuerkauf 1964 (wie Anm. 4), S. 23.
9 Theuerkauf 1964 (wie Anm. 4), S. 26-27.
10 Gerhard Theuerkauf, Land und Lehnwesen vom 14. bis
zum 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Verfassung des Hoch-
stifts Münster und zum nordwestdeutschen Lehnsrecht. Köln
1971. Die starke Fluktuation konnte inzwischen beispielhaft
für das Kirchspiel Hiltrup südlich von Münster dokumentiert
werden (s. Volker Jarren, Hiltruper Höfe und Familien im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Bielefeld 1999, S. 36-
40).
11 Dennoch wurde bislang bei dem Phänomen der Gräf-
tenhöfe kaum berücksichtigt, um welche Art des Besitzes es
sich bei ihnen handelte. Nahezu die Hälfte der Höfe, die
Bockholt und Weber behandelten, sind freie Pachtgüter und
nicht zu Erbpacht vergebene „Bauernhöfe" gewesen (Wer-
ner Bockholt/Peter Weber, Gräftenhöfe im Münsterland. Eine
ländliche Siedlungsform an acht ausgewählten Beispielen.
Warendorf 1988). In der Detailstudie für das Kirchspiel
Hiltrup bei Münster konnte festgestellt werden, dass nahezu
alle der dort vorhandenen Gräftenanlagen zu freien Gütern
und Anlagen im herrschaftlichen Besitz gehörten, s. Jarren
1999 (wie Anm. 10), S. 58-60.
12 Die ältere Forschung ging davon aus, dass es einen engen
275
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
Das charakteristische Raumkonzept mit einseitiger
Lucht, einem repräsentativen Kammerfach und
Wohnräumen auch in den Seitenschiffen lässt sich
aber auch bei dem 1642 errichteten Pächterhaus auf
dem Gut Haus Kleine Getter in Münster-Albachten
nachweisen.159 Ebenso hat es das 1721 errichtete
Pächterwohnhaus auf dem Gutshof Haus Horst bei
Waltrop (Kr. Recklinghausen), hervorgegangen aus
einer ehemaligen Kommende der Johanniter zu
Münster und Steinfurt.160 Es dürfte daher als Pächter-
wohnhaus mit einer Sommerwohnung der Johanniter
zu interpretieren sein.161 Selbst das Gutshaus auf Haus
Rüschhaus bei Münster, das 1745/47 nach Plänen von
J. C. Schlaun in massiver Bauweise erneuert wurde, ist
trotz seiner ungewöhnlichen architektonischen Ge-
stalt im Inneren nach diesem Prinzip ausgeführt. Das
Konzept wurde noch bis in das 19. Jahrhundert weit-
gehend unverändert fortgeführt: Hierfür steht das
1828 weitgehend erneuerte Haus Lohfeld bei Evers-
winkel (Kr. Warendorf), das als Pächterwohnhaus mit
herrschaftlicher Sommerwohnung belegt ist.
Die gleiche Raumstruktur wurde auch noch 1833 bei
der weitgehenden Neugestaltung des Wohnteils an
dem um 1590 (d) errichteten Pächterwohnhaus auf
dem Haus Milte bei Telgte unverändert gewählt. Hier
ist die Nutzung zusätzlich durch Quellen belegt: Die
herrschaftliche Wohnung befindet sich hinter der
Herdwand und hat weitere Räume im Obergeschoss.
Die Pächter wohnen im linken Seitenschiff, wobei
deren Wohnräume statt der wiederum nicht vorhan-
denen südlichen Lucht der großen Herdküche bis an
die herrschaftliche Wohnung heranreichen.
Es ergibt sich damit die Frage, warum man das Kon-
zept nachweisbar über nahezu 300 Jahre beibehielt.
Nach den Quellenbelegen muss davon ausgegangen
werden, dass dies insbesondere in der Haushalts-
struktur begründet ist, bei der die herrschaftliche
Wohnung ohne eigene Küche blieb und die „Be-
sucher" des Hauses durch die Pächterfamilie versorgt
wurden. Daher waren beide Wohnbereiche funktional
verbunden und auf die gleiche Küche bezogen und
mussten daher auch nebeneinander liegen.
Erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts scheint man
diese „traditionelle" Grundrissform mit gemeinsamer
Küche für den Pächter und die herrschaftliche
Sommerwohnung aufgegeben zu haben.
Anmerkungen
1 Eine erste kurze Übersicht über die verschiedenen Rechts-
verhältnisse im Münsterland bietet noch immer Julius
Schwieters, Die Bauernhöfe des östlichen Theils des Kreises
Lüdinghausen. Münster 1888, S. 3-13; weiteres Allgemeines
bei Werner Rösener, Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und
ländliche Gesellschaft im Mittelalter. München 1992; Peter
llisch, Aspekte der mittelalterlichen Agrargeschichte, in: Sen-
den. Eine Geschichte der Gemeinde Senden mit Ottmars-
bocholt, Bösensell und Venne. Senden 1992, S. 17-160 bie-
tet S. 17-23 einen guten Überblick; Leopold Schütte, Die
Verfassung ländlicher Siedlungen in Westfalen vor 1800 im
Spiegel ihrer räumlichen Struktur, in: Claudia Maria Kors-
meier (Hg.), Leopold Schütte: Schulte, Weichbild. Bauern-
schaft. Ausgewählte Schriften zu seinem 70. Geburtstag.
Bielefeld 2010, S. 17-46.
2 Einen Überblick über den Forschungsstand bietet Werner
Rösener, Grundherrschaft und Bauerntum im hochmittelal-
terlichen Westfalen, in: Westfälische Zeitschrift 139, 1989,
S. 9-41.
3 Die Rechtsgrundlage des Lehnsrechtes war seit dem 13.
Jahrhundert der Sachsenspiegel des Eike von Repgow.
4 Mark Mersiowsky, Niederadel, Großbauern und Patriziat.
Soziale Dynamik im spätmittelalterlichen Westfalen, in: Kurt
Andermann/Peter Johanek (Hg.), Zwischen Nicht-Adel und
Adel. Stuttgart 2001, S. 239-284. Er weist S. 262-263 darauf
hin, dass es sich hierbei vielfach um Einzelhöfe handelte, die
erst seit dem 12. Jahrhundert außerhalb der bisherigen
Villikationsordnung gegründet worden waren.
5 Zur Geschichte des Lehenswesen im Münsterland s. Ger-
hard Theuerkauf, Das Lehnswesen in Westfalen, in: Westfäli-
sche Forschungen. 17. Münster 1964, S. 14-27; s. jetzt auch
die Einleitung bei Hugo Kempkes/Gerhard Theuerkauf/Man-
fred Wolf, Die Lehensregister der Bischöfe von Münster bis
1379. Münster 1995.
6 Hierzu der breite Forschungsüberblick bei Mersiowsky
2001 (wie Anm. 4), hier insbesondere S. 251-255.
7 Peter llisch, Untergegangene Adelssitze in den Kirchspielen
Darup, Nottuln und Billerbeck - Beiträge zur Geschichte des
Niederen Adels im Münsterland, in: Geschichtsblätter des
Kreises Coesfeld. 15/ 1990, S. 55-75.
8 Theuerkauf 1964 (wie Anm. 4), S. 23.
9 Theuerkauf 1964 (wie Anm. 4), S. 26-27.
10 Gerhard Theuerkauf, Land und Lehnwesen vom 14. bis
zum 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Verfassung des Hoch-
stifts Münster und zum nordwestdeutschen Lehnsrecht. Köln
1971. Die starke Fluktuation konnte inzwischen beispielhaft
für das Kirchspiel Hiltrup südlich von Münster dokumentiert
werden (s. Volker Jarren, Hiltruper Höfe und Familien im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Bielefeld 1999, S. 36-
40).
11 Dennoch wurde bislang bei dem Phänomen der Gräf-
tenhöfe kaum berücksichtigt, um welche Art des Besitzes es
sich bei ihnen handelte. Nahezu die Hälfte der Höfe, die
Bockholt und Weber behandelten, sind freie Pachtgüter und
nicht zu Erbpacht vergebene „Bauernhöfe" gewesen (Wer-
ner Bockholt/Peter Weber, Gräftenhöfe im Münsterland. Eine
ländliche Siedlungsform an acht ausgewählten Beispielen.
Warendorf 1988). In der Detailstudie für das Kirchspiel
Hiltrup bei Münster konnte festgestellt werden, dass nahezu
alle der dort vorhandenen Gräftenanlagen zu freien Gütern
und Anlagen im herrschaftlichen Besitz gehörten, s. Jarren
1999 (wie Anm. 10), S. 58-60.
12 Die ältere Forschung ging davon aus, dass es einen engen
275