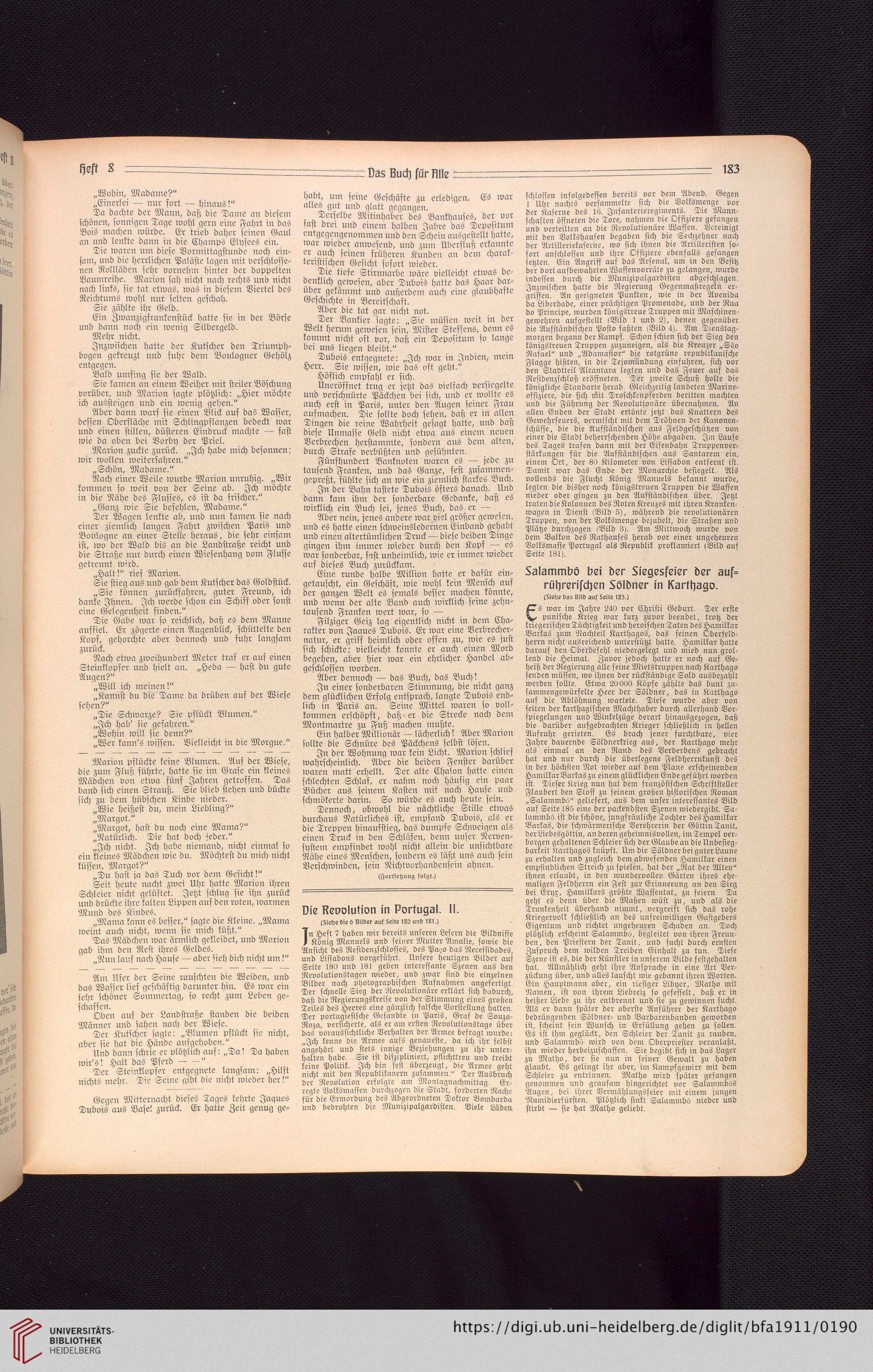8 — — vazRuchfüi-M? v.-___- "n—
„Wohin, Madame?"
„Einerlei — nur fort — hinaus!"
Da dachte der Mann, daß die Dame an diesem
schönen, sonnigen Tage wohl gern eine Fahrt in das
Bois machen würde. Er trieb daher seinen Gaul
an und lenkte dann in die Champs Elysees ein.
Die waren um diese Vormittagstunde noch ein-
sam, und die herrlichen Paläste lagen mit verschlosse-
nen Rollläden sehr vornehm hinter der doppelten
Baumreihe. Marion sah nicht nach rechts und nicht
nach links, sie tat etwas, was in diesem Viertel des
Reichtums wohl nur selten geschah.
Sie zählte ihr Geld.
Ein Zwanzigfrankenstück hatte sie in der Börse
und dann noch ein wenig Silbergeld.
Mehr nicht.
Inzwischen hatte der Kutscher den Triumph-
bogen gekreuzt und fuhr dem Boulogner Gehölz
entgegen.
Bald umfing sie der Wald.
Sie kamen an einem Weiher mit steiler Böschung
vorüber, und Marion sagte plötzlich: „Hier möchte
ich aussteigen und ein wenig gehen."
Aber dann warf sie einen Blick auf das Wasser,
dessen Oberfläche mit Schlingpflanzen bedeckt war
und einen stillen, düsteren Eindruck machte — fast
wie da oben bei Vorby der Priel.
Marion zuckte zurück. „Ich habe mich besonnen;
wir wollen weiterfahren."
„Schön, Madame."
Nach einer Weile wurde Marion unruhig. „Wir
kommen so weit von der Seine ab. Ich möchte
in die Nähe des Flusses, es ist da frischer."
„Ganz wie Sie befehlen, Madame."
Der Wagen lenkte ab, und nun kamen sie nach
einer ziemlich langen Fahrt zwischen Paris und
Boulogne an einer Stelle heraus, die sehr einsam
ist, wo der Wald bis an die Landstraße reicht und
die Straße nur durch einen Wiesenhang vom Flusse
getrennt w>rd.
„Halt!" rief Marion.
Sie stieg aus und gab dem Kutscher das Goldstück.
„Sie können zurückfahren, guter Freund, ich
danke Ihnen. Ich werde schon ein Schiff oder sonst
eine Gelegenheit finden."
Die Gabe war so reichlich, daß es dem Manne
auffiel. Er zögerte einen Augenblick, schüttelte den
Kopf, gehorchte aber dennoch und fuhr langsam
zurück.
Nach etwa zweihundert Meter traf er auf einen
Steinklopfer und hielt an. „Heda — hast du gute
Augen?"
„Will ich meinen!"
„Kannst du die Dame da drüben auf der Wiese
sehen?"
„Die Schwarze? Sie pflückt Blumen."
„Ich hab' sie gefahren."
„Wohin will sie denn?"
„Wer kann's wissen. Vielleicht in die Morgue."
Marion pflückte keine Blumen. Auf der Wiese,
die zum Fluß führte, hatte sie im Grase ein kleines
Mädchen von etwa fünf Jahren getroffen. Das
band sich einen Strauß. Sie blieb stehen und bückte
sich zu dem hübschen Kinde nieder.
„Wie heißest du, mein Liebling?"
„Margot."
„Margot, hast du noch eine Mama?"
„Natürlich. Die hat doch feder."
„Ich nicht. Ich habe niemand, nicht einmal so
ein kleines Mädchen wie du. Möchtest du mich nicht
küssen, Margot?"
„Du hast ja das Tuch vor dem Gesicht!"
Seit heute nacht zwei Uhr hatte Marion ihren
Schleier nicht gelüftet. Jetzt schlug sie ihn zurück
und drückte ihre kalten Lippen auf den roten, warmen
Mund des Kindes.
„Mama kann es besser," sagte die Kleine. „Mama
weint auch nicht, wenn sie mick küßt."
Das Mädchen war ärmlich gekleidet, und Marion
gab ihm den Rest ihres Geldes.
„Nun lauf nach Hause — aber sieh dich nicht um!"
Am Ufer der Seine rauschten die Weiden, und
das Wasser lief geschäftig darunter hin. Es war ein
sehr schöner Sommertag, so recht zum Leben ge-
sckaffen.
Oben auf der Landstraße standen die beiden
Männer und sahen nach der Wiese.
Der Kutscher sagte: „Blumen pflückt sie nicht,
aber sie hat die Hände aufgehoben."
Und dann schrie er vlötzlicb auf: „Da! Da haben
wir's! Halt das Pferd-"
Der Steinklopfer entgegnete langsam: „Hilft
nichts mehr. Die Seine gibt die nicht wieder her!"
Gegen Mitternacht dieses Tages kehrte Jaques
Dubois aus Basel zurück. Er hatte Zeit genug ge-
habt, um seine Geschäfte zu erledigen. Es war
alles gut und glatt gegangen.
Derselbe Mitinhaber des Bankhauses, der vor
fast drei und einem halben Jahre das Depositum
entgegengenommen und den Schein ausgestellt hatte,
war wieder anwesend, und zum Überfluß erkannte
er auch seinen früheren Kunden an dem charak-
teristischen Gesicht sofort wieder.
Die tiefe Stirnnarbe wäre vielleicht etwas be-
denklich gewesen, aber Dubois hatte das Haar dar-
über gekämmt und außerdem auch eine glaubhafte
Geschichte in Bereitschaft.
Aber die tat gar nicht not.
Der Bankier sagte: „Sie müssen weit in der
Welt herum gewesen sein, Mister Steffens, denn es
kommt nicht oft vor, daß ein Depositum so lange
bei uns liegen bleibt."
Dubois entgegnete: „Ich war in Indien, mein
Herr. Sie wissen, wie das oft geht."
Höflich empfahl er sich.
Üneröffnet trug er fetzt das vielfach versiegelte
und verschnürte Päckchen bei sich, und er wollte es
auch erst in Paris, unter den Augen feiner Frau
aufmachen. Die sollte doch sehen, daß er in allen
Dingen die reine Wahrheit gesagt hatte, und daß
diese Unmasse Geld nicht etwa aus einem neuen
Verbrechen herstammte, sondern aus dem alten,
durch Strafe verbüßten und gesühnten.
Fünfhundert Banknoten waren es — jede zu
tausend Franken, und das Ganze, fest zusammen-
gepreßt, fühlte sich an wie ein ziemlich starkes Buch.
In der Bahn tastete Dubois öfters danach. Und
dann kam ihm der sonderbare Gedanke, daß es
wirklich ein Buch sei, jenes Buch, das er —
Aber nein, jenes andere war viel größer gewesen,
und es hatte einen schweinsledernen Einband gehabt
und einen altertümlichen Druck — diese beiden Dinge
gingen ihm immer wieder durch den Kopf — es
war sonderbar, fast unheimlich, wie er immer wieder
auf dieses Buch zurückkam.
Eine runde halbe Million hatte er dafür ein-
getauscht, ein Geschäft, wie wohl kein Mensch auf
der ganzen Welt es jemals besser machen könnte,
und wenn der alte Band auch wirklich seine zehn-
tausend Franken wert war, so —
Filziger Geiz lag eigentlich nicht in dem Cha-
rakter von Jaques Dubois. Er war eine Verbrecher-
natur, er griff heimlich oder offen zu, wie es just
sich schickte; vielleicht konnte er auch einen Mord
begehen, aber hier war ein ehrlicher Handel ab-
geschlossen worden.
Aber dennoch — das Buch, das Buch!
In einer sonderbaren Stimmung, die nicht ganz
dem glücklichen Erfolg entsprach, langte Dubois end-
lich in Paris an. Seine Mittel waren so voll-
kommen erschöpft, daß er die Strecke nach dem
Montmartre zu Fuß machen mußte.
Ein halber Millionär — lächerlich! Aber Marion
sollte die Schnüre des Päckchens selbst lösen.
In der Wohnung war kein Licht. Marion schlief
wahrscheinlich. Aber die beiden Fenster darüber
waren matt erhellt. Der alte Chalon hatte einen
schlechten Schlaf, er nahm noch häufig ein paar
Bücher aus seinem Kasten mit nach Hause und
schmökerte darin. So würde es auch heute fein.
Dennoch, obwohl die nächtliche Stille etwas
durchaus Natürliches ist, empfand Dubois, als er
die Treppen hinaufstieg, das dumpfe Schweigen als
einen Druck in den Schläfen, denn unser Nerven-
system empfindet wohl nicht allein die unsichtbare
Nähe eines Menschen, sondern es läßt uns auch sein
Verschwinden, sein Nichtvorhandenfein ahnen.
«Fortsetzung folgt.)
Vie Revolution in Portugal. II.
«Zietze die ö vilder au« Teils IM und 181.)
Heft 7 haben wir bereits unseren Lesern die Bildnisse
I König Manuels und seiner Mutter Amalie, sowie die
Ansicht des Residenzschlosses, des Pa?o das Necessidades,
und Lissabons vorgeführt. Unsere heutigen Bilder auf
Seite ISO und 181 geben interessante Szenen aus den
Revolutionstagen wieder, und zwar sind die einzelnen
Bilder nach photographischen Aufnahmen angefertigt.
Der schnelle Sieg der Revolutionäre erklärt sich dadurch,
daß die Regierungskreise von der Stimmung eines großen
Teiles des Heeres eine gänzlich falsche Vorstellung hatten.
Der portugiesische Gesandte in Paris, Graf de Souza-
Roza, versicherte, als er am ersten Revolutionstage über
das voraussichtliche Verhalten der Armee befragt wurde:
„Ich kenne die Armee aufs genaueste, da ich ihr selbst
angehört und stets innige Beziehungen zu ihr unter-
halten habe. Sie ist diszipliniert, pflichttreu und treibt
keine Politik. Ich bin fest überzeugt, die Armee geht
nicht mit den Republikanern zusammen." Der Ausbruch
der Revolution erfolgte am Montagnachmittag. Er-
regte Volksmassen durchzogen die Stadt, forderten Rache
für die Ermordung des Abgeordneten Doktor Bombarda
und bedrohten dje Mynizipalgardisten. Viele Läden
schlossen infolgedessen bereits vor dem Abend. Gegen
I Uhr nachts versammelte sich die Volksmenge vor-
der Kaserne des 16. Infanterieregiments. Die Mann-
schaften öffneten die Tore, nahmen die Offiziere gefangen
und verteilten an die Revolutionäre Waffen. Vereinigt
mit den Volkshaufen begaben sich die Sechzehner nach
der Artilleriekaserne, wo sich ihnen die Artilleristen so-
fort anschlossen und ihre Offiziere ebenfalls gefangen
setzten. Ein Angriff auf das Arsenal, um in den Besitz
der dortaufbewahrlenWaffenvorräte zu gelangen, wurde
indessen durch die Munizipalgardisten abgeschlagen.
Inzwischen hatte die Regierung Gegenmaßregeln er-
griffen. An geeigneten Punkten, wie in der Avenida
da Liberdade, einer prächtigen Promenade, und der Rua
do Principe, wurden königstreue Truppen mit Maschinen-
gewehren aufgestellt (Bild 1 und 2), denen gegenüber
die Aufständischen Posto faßten (Bild 4). Am Dienstag-
morgen begann der Kampf. Schon schien sich der Sieg den
königstreuen Truppen zuzuneigen, als die Kreuzer „Sao
Rafael" und „Adamastor" die rotgrüne republikanische
Flagge hißten, in die Tejomündung einfuhren, sich vor
den Stadtteil Alcantara legten und das Feuer auf das
Nesidenzschloß eröffneten. Der zweite Schuß holte die
königliche Standarte herab. Gleichzeitig landeten Marine-
offiziere, die sich rüit Droschkenpferüen beritten machten
und die Führung der Revolutionäre übernahmen. An
allen Enden der Stadt ertönte jetzt das Knattern des
Gewehrfeuers, vermischt mit dem Dröhnen der Kanonen-
schüsse, die die Aufständischen aus Feldgeschützen von
einer die Stadt beherrschenden Höhe abgaben. Im Lause
des Tages trafen dann mit der Eisenbahn Truppenver-
stärkungen für die Aufständischen aus Santarem ein,
einem Ort, der 80 Kilometer von Lissabon entfernt ist.
Damit war das Ende der Monarchie besiegelt. Als
vollends die Flucht König Manuels bekannt wurde,
legten die bisher noch königstreuen Truppen die Waffen
nieder oder gingen zu den Aufständischen über. Jetzt
traten die Kolonnen des Roten Kreuzes mit ihren Kranken-
wagen in Dienst (Bild S), während die revolutionären
Truppen, von der Volksmenge bejubelt, die Straßen und
Plätze durchzogen (Bild 3). Am Mittwoch wurde von
dem Balkon des Rathauses herab vor einer ungeheuren
Volksmaffe Portugal als Republik proklamiert (Bild auf
Seite 181).
5aiammbö bei del- Ziegesfeiei- bei- aus-
rühl-el-ischen Zöldnei- in Rai-chago.
«Tietze das Mid au« Teile 185.)
^s war im Jahre 240 vor Christi Geburt. Der erste
punische Krieg war kurz zuvor beendet, trotz der
kriegerischen Tüchtigkeit und heroischen Taten des Hamilkar
Bartas zum Nachteil Karthagos, das seinen Oberfeld-
herrn nicht ausreichend unterstützt hatte. Hamilkar halte
darauf den Oberbefehl niedergelegt und mied nun grol-
lend die Heimat. Zuvor jedoch hatte er noch auf Ge-
heiß der Regierung alle seine Mietstruppen nach Karthago
senden müssen, wo ihnen der rückständige Sold ausbezahlt
werden sollte. Etwa 20000 Köpfe zählte das bunt zu-
sammengewürfelte Heer der Söldner, das in Karthago
auf die Ablöhnung wartete. Diese wurde aber von
feiten der karthagischen Machthaber durch allerhand Vor-
spiegelungen und Winkelzüge derart hinausgezogen, daß
die darüber aufgebrachten Krieger schließlich in Hellen
Aufruhr gerieten. Es brach jener furchtbare, vier
Jahre dauernde Söldnerkrieg aus, der Karthago mehr
als einmal an den Rand des Verderbens gebracht
hat und nur durch die überlegene Feldherrnkunst des
in der höchsten Not wieder auf dem Plane erscheinenden
Hamilkar Bartas zu einem glücklichen Ende geführt morden
ist. Dieser Krieg nun hat dem französischen Schriftsteller
Flaubert den Stoff zu seinem großen historischen Roman
„SalammbS" geliefert, aus dem unser interessantes Bild
auf Seite 185 eine der packendsten Szenen wiedergibt. Sa-
lammbü ist die schöne, jungfräuliche Tochter des Hamilkar
Barkas, die schwärmerische Verehrerin der Göttin Tanit,
derLiebesgöttin, an deren geheimnisvollen, im Tempel ver-
borgen gehaltenen Schleier sich der Glaube an die Unbesieg-
barkeit Karthagos knüpft. Um die Söldner bei guter Laune
zu erhalten und zugleich dem abwesenden Hamilkar einen
empfindlichen Streich zu spielen, hat der „Rat der Alten"
ihnen erlaubt, in den wundervollen Gärten ihres ehe-
maligen Feldherrn ein Fest zur Erinnerung an den Sieg
bei Eryx, Hamilkars größte Waffentat, zu feiern Da
geht es denn über die Maßen wüst zu, und als die
Trunkenheit überhand nimmt, vergreift sich das rohe
Kriegervolk schließlich an des unfreiwilligen Gastgebers
Eigentum und richtet ungeheuren Schaden an. Doch
plötzlich erscheint Salammbö, begleitet von ihren Freun-
den, den Priestern der Tanit, und sucht durch ernsten
Zuspruch dem wilden Treiben Einhalt zu tun. Diese
Szene ist es, die der Künstler in unserem Bilde sestgehalten
hat. Allmählich geht ihre Ansprache in eine Art Ver-
zückung über, und alles lauscht wie gebannt ihren Worten.
Ein Hauptmann aber, ein riesiger Libyer, Matho mit
Namen, ist von ihrem Liebreiz so gefesselt, daß er in
heißer Liebs zu ihr entbrennt und sie zu gewinnen sucht.
Als er dann später der oberste Anführer der Karthago
bedrängenden Söldner- und Barbarenbanden geworden
ist, scheint sein Wunsch in Erfüllung gehen zu sollen.
Es ist ihm geglückt, den Schleier der Tanit zu rauben,
und Salammbö wird von dem Oberpriester veranlaßt,
ihn wieder herbeizuschaffen. Sie begibt sich in das Lager
zu Matho, der sie nun in seiner Gewalt zu haben
glaubt. Es gelingt ihr aber, im Kampfgewirr mit dem
Schleier zu entrinnen. Matho wird später gefangen
genommen und grausam hingerichtet vor Salammbös
Augen, bei ihrer Vermählungsfeier mit einem jungen
Numidierfürsten. Plötzlich finkt Salammbö nieder und
stirbt — sie hat Matho geliebt.
„Wohin, Madame?"
„Einerlei — nur fort — hinaus!"
Da dachte der Mann, daß die Dame an diesem
schönen, sonnigen Tage wohl gern eine Fahrt in das
Bois machen würde. Er trieb daher seinen Gaul
an und lenkte dann in die Champs Elysees ein.
Die waren um diese Vormittagstunde noch ein-
sam, und die herrlichen Paläste lagen mit verschlosse-
nen Rollläden sehr vornehm hinter der doppelten
Baumreihe. Marion sah nicht nach rechts und nicht
nach links, sie tat etwas, was in diesem Viertel des
Reichtums wohl nur selten geschah.
Sie zählte ihr Geld.
Ein Zwanzigfrankenstück hatte sie in der Börse
und dann noch ein wenig Silbergeld.
Mehr nicht.
Inzwischen hatte der Kutscher den Triumph-
bogen gekreuzt und fuhr dem Boulogner Gehölz
entgegen.
Bald umfing sie der Wald.
Sie kamen an einem Weiher mit steiler Böschung
vorüber, und Marion sagte plötzlich: „Hier möchte
ich aussteigen und ein wenig gehen."
Aber dann warf sie einen Blick auf das Wasser,
dessen Oberfläche mit Schlingpflanzen bedeckt war
und einen stillen, düsteren Eindruck machte — fast
wie da oben bei Vorby der Priel.
Marion zuckte zurück. „Ich habe mich besonnen;
wir wollen weiterfahren."
„Schön, Madame."
Nach einer Weile wurde Marion unruhig. „Wir
kommen so weit von der Seine ab. Ich möchte
in die Nähe des Flusses, es ist da frischer."
„Ganz wie Sie befehlen, Madame."
Der Wagen lenkte ab, und nun kamen sie nach
einer ziemlich langen Fahrt zwischen Paris und
Boulogne an einer Stelle heraus, die sehr einsam
ist, wo der Wald bis an die Landstraße reicht und
die Straße nur durch einen Wiesenhang vom Flusse
getrennt w>rd.
„Halt!" rief Marion.
Sie stieg aus und gab dem Kutscher das Goldstück.
„Sie können zurückfahren, guter Freund, ich
danke Ihnen. Ich werde schon ein Schiff oder sonst
eine Gelegenheit finden."
Die Gabe war so reichlich, daß es dem Manne
auffiel. Er zögerte einen Augenblick, schüttelte den
Kopf, gehorchte aber dennoch und fuhr langsam
zurück.
Nach etwa zweihundert Meter traf er auf einen
Steinklopfer und hielt an. „Heda — hast du gute
Augen?"
„Will ich meinen!"
„Kannst du die Dame da drüben auf der Wiese
sehen?"
„Die Schwarze? Sie pflückt Blumen."
„Ich hab' sie gefahren."
„Wohin will sie denn?"
„Wer kann's wissen. Vielleicht in die Morgue."
Marion pflückte keine Blumen. Auf der Wiese,
die zum Fluß führte, hatte sie im Grase ein kleines
Mädchen von etwa fünf Jahren getroffen. Das
band sich einen Strauß. Sie blieb stehen und bückte
sich zu dem hübschen Kinde nieder.
„Wie heißest du, mein Liebling?"
„Margot."
„Margot, hast du noch eine Mama?"
„Natürlich. Die hat doch feder."
„Ich nicht. Ich habe niemand, nicht einmal so
ein kleines Mädchen wie du. Möchtest du mich nicht
küssen, Margot?"
„Du hast ja das Tuch vor dem Gesicht!"
Seit heute nacht zwei Uhr hatte Marion ihren
Schleier nicht gelüftet. Jetzt schlug sie ihn zurück
und drückte ihre kalten Lippen auf den roten, warmen
Mund des Kindes.
„Mama kann es besser," sagte die Kleine. „Mama
weint auch nicht, wenn sie mick küßt."
Das Mädchen war ärmlich gekleidet, und Marion
gab ihm den Rest ihres Geldes.
„Nun lauf nach Hause — aber sieh dich nicht um!"
Am Ufer der Seine rauschten die Weiden, und
das Wasser lief geschäftig darunter hin. Es war ein
sehr schöner Sommertag, so recht zum Leben ge-
sckaffen.
Oben auf der Landstraße standen die beiden
Männer und sahen nach der Wiese.
Der Kutscher sagte: „Blumen pflückt sie nicht,
aber sie hat die Hände aufgehoben."
Und dann schrie er vlötzlicb auf: „Da! Da haben
wir's! Halt das Pferd-"
Der Steinklopfer entgegnete langsam: „Hilft
nichts mehr. Die Seine gibt die nicht wieder her!"
Gegen Mitternacht dieses Tages kehrte Jaques
Dubois aus Basel zurück. Er hatte Zeit genug ge-
habt, um seine Geschäfte zu erledigen. Es war
alles gut und glatt gegangen.
Derselbe Mitinhaber des Bankhauses, der vor
fast drei und einem halben Jahre das Depositum
entgegengenommen und den Schein ausgestellt hatte,
war wieder anwesend, und zum Überfluß erkannte
er auch seinen früheren Kunden an dem charak-
teristischen Gesicht sofort wieder.
Die tiefe Stirnnarbe wäre vielleicht etwas be-
denklich gewesen, aber Dubois hatte das Haar dar-
über gekämmt und außerdem auch eine glaubhafte
Geschichte in Bereitschaft.
Aber die tat gar nicht not.
Der Bankier sagte: „Sie müssen weit in der
Welt herum gewesen sein, Mister Steffens, denn es
kommt nicht oft vor, daß ein Depositum so lange
bei uns liegen bleibt."
Dubois entgegnete: „Ich war in Indien, mein
Herr. Sie wissen, wie das oft geht."
Höflich empfahl er sich.
Üneröffnet trug er fetzt das vielfach versiegelte
und verschnürte Päckchen bei sich, und er wollte es
auch erst in Paris, unter den Augen feiner Frau
aufmachen. Die sollte doch sehen, daß er in allen
Dingen die reine Wahrheit gesagt hatte, und daß
diese Unmasse Geld nicht etwa aus einem neuen
Verbrechen herstammte, sondern aus dem alten,
durch Strafe verbüßten und gesühnten.
Fünfhundert Banknoten waren es — jede zu
tausend Franken, und das Ganze, fest zusammen-
gepreßt, fühlte sich an wie ein ziemlich starkes Buch.
In der Bahn tastete Dubois öfters danach. Und
dann kam ihm der sonderbare Gedanke, daß es
wirklich ein Buch sei, jenes Buch, das er —
Aber nein, jenes andere war viel größer gewesen,
und es hatte einen schweinsledernen Einband gehabt
und einen altertümlichen Druck — diese beiden Dinge
gingen ihm immer wieder durch den Kopf — es
war sonderbar, fast unheimlich, wie er immer wieder
auf dieses Buch zurückkam.
Eine runde halbe Million hatte er dafür ein-
getauscht, ein Geschäft, wie wohl kein Mensch auf
der ganzen Welt es jemals besser machen könnte,
und wenn der alte Band auch wirklich seine zehn-
tausend Franken wert war, so —
Filziger Geiz lag eigentlich nicht in dem Cha-
rakter von Jaques Dubois. Er war eine Verbrecher-
natur, er griff heimlich oder offen zu, wie es just
sich schickte; vielleicht konnte er auch einen Mord
begehen, aber hier war ein ehrlicher Handel ab-
geschlossen worden.
Aber dennoch — das Buch, das Buch!
In einer sonderbaren Stimmung, die nicht ganz
dem glücklichen Erfolg entsprach, langte Dubois end-
lich in Paris an. Seine Mittel waren so voll-
kommen erschöpft, daß er die Strecke nach dem
Montmartre zu Fuß machen mußte.
Ein halber Millionär — lächerlich! Aber Marion
sollte die Schnüre des Päckchens selbst lösen.
In der Wohnung war kein Licht. Marion schlief
wahrscheinlich. Aber die beiden Fenster darüber
waren matt erhellt. Der alte Chalon hatte einen
schlechten Schlaf, er nahm noch häufig ein paar
Bücher aus seinem Kasten mit nach Hause und
schmökerte darin. So würde es auch heute fein.
Dennoch, obwohl die nächtliche Stille etwas
durchaus Natürliches ist, empfand Dubois, als er
die Treppen hinaufstieg, das dumpfe Schweigen als
einen Druck in den Schläfen, denn unser Nerven-
system empfindet wohl nicht allein die unsichtbare
Nähe eines Menschen, sondern es läßt uns auch sein
Verschwinden, sein Nichtvorhandenfein ahnen.
«Fortsetzung folgt.)
Vie Revolution in Portugal. II.
«Zietze die ö vilder au« Teils IM und 181.)
Heft 7 haben wir bereits unseren Lesern die Bildnisse
I König Manuels und seiner Mutter Amalie, sowie die
Ansicht des Residenzschlosses, des Pa?o das Necessidades,
und Lissabons vorgeführt. Unsere heutigen Bilder auf
Seite ISO und 181 geben interessante Szenen aus den
Revolutionstagen wieder, und zwar sind die einzelnen
Bilder nach photographischen Aufnahmen angefertigt.
Der schnelle Sieg der Revolutionäre erklärt sich dadurch,
daß die Regierungskreise von der Stimmung eines großen
Teiles des Heeres eine gänzlich falsche Vorstellung hatten.
Der portugiesische Gesandte in Paris, Graf de Souza-
Roza, versicherte, als er am ersten Revolutionstage über
das voraussichtliche Verhalten der Armee befragt wurde:
„Ich kenne die Armee aufs genaueste, da ich ihr selbst
angehört und stets innige Beziehungen zu ihr unter-
halten habe. Sie ist diszipliniert, pflichttreu und treibt
keine Politik. Ich bin fest überzeugt, die Armee geht
nicht mit den Republikanern zusammen." Der Ausbruch
der Revolution erfolgte am Montagnachmittag. Er-
regte Volksmassen durchzogen die Stadt, forderten Rache
für die Ermordung des Abgeordneten Doktor Bombarda
und bedrohten dje Mynizipalgardisten. Viele Läden
schlossen infolgedessen bereits vor dem Abend. Gegen
I Uhr nachts versammelte sich die Volksmenge vor-
der Kaserne des 16. Infanterieregiments. Die Mann-
schaften öffneten die Tore, nahmen die Offiziere gefangen
und verteilten an die Revolutionäre Waffen. Vereinigt
mit den Volkshaufen begaben sich die Sechzehner nach
der Artilleriekaserne, wo sich ihnen die Artilleristen so-
fort anschlossen und ihre Offiziere ebenfalls gefangen
setzten. Ein Angriff auf das Arsenal, um in den Besitz
der dortaufbewahrlenWaffenvorräte zu gelangen, wurde
indessen durch die Munizipalgardisten abgeschlagen.
Inzwischen hatte die Regierung Gegenmaßregeln er-
griffen. An geeigneten Punkten, wie in der Avenida
da Liberdade, einer prächtigen Promenade, und der Rua
do Principe, wurden königstreue Truppen mit Maschinen-
gewehren aufgestellt (Bild 1 und 2), denen gegenüber
die Aufständischen Posto faßten (Bild 4). Am Dienstag-
morgen begann der Kampf. Schon schien sich der Sieg den
königstreuen Truppen zuzuneigen, als die Kreuzer „Sao
Rafael" und „Adamastor" die rotgrüne republikanische
Flagge hißten, in die Tejomündung einfuhren, sich vor
den Stadtteil Alcantara legten und das Feuer auf das
Nesidenzschloß eröffneten. Der zweite Schuß holte die
königliche Standarte herab. Gleichzeitig landeten Marine-
offiziere, die sich rüit Droschkenpferüen beritten machten
und die Führung der Revolutionäre übernahmen. An
allen Enden der Stadt ertönte jetzt das Knattern des
Gewehrfeuers, vermischt mit dem Dröhnen der Kanonen-
schüsse, die die Aufständischen aus Feldgeschützen von
einer die Stadt beherrschenden Höhe abgaben. Im Lause
des Tages trafen dann mit der Eisenbahn Truppenver-
stärkungen für die Aufständischen aus Santarem ein,
einem Ort, der 80 Kilometer von Lissabon entfernt ist.
Damit war das Ende der Monarchie besiegelt. Als
vollends die Flucht König Manuels bekannt wurde,
legten die bisher noch königstreuen Truppen die Waffen
nieder oder gingen zu den Aufständischen über. Jetzt
traten die Kolonnen des Roten Kreuzes mit ihren Kranken-
wagen in Dienst (Bild S), während die revolutionären
Truppen, von der Volksmenge bejubelt, die Straßen und
Plätze durchzogen (Bild 3). Am Mittwoch wurde von
dem Balkon des Rathauses herab vor einer ungeheuren
Volksmaffe Portugal als Republik proklamiert (Bild auf
Seite 181).
5aiammbö bei del- Ziegesfeiei- bei- aus-
rühl-el-ischen Zöldnei- in Rai-chago.
«Tietze das Mid au« Teile 185.)
^s war im Jahre 240 vor Christi Geburt. Der erste
punische Krieg war kurz zuvor beendet, trotz der
kriegerischen Tüchtigkeit und heroischen Taten des Hamilkar
Bartas zum Nachteil Karthagos, das seinen Oberfeld-
herrn nicht ausreichend unterstützt hatte. Hamilkar halte
darauf den Oberbefehl niedergelegt und mied nun grol-
lend die Heimat. Zuvor jedoch hatte er noch auf Ge-
heiß der Regierung alle seine Mietstruppen nach Karthago
senden müssen, wo ihnen der rückständige Sold ausbezahlt
werden sollte. Etwa 20000 Köpfe zählte das bunt zu-
sammengewürfelte Heer der Söldner, das in Karthago
auf die Ablöhnung wartete. Diese wurde aber von
feiten der karthagischen Machthaber durch allerhand Vor-
spiegelungen und Winkelzüge derart hinausgezogen, daß
die darüber aufgebrachten Krieger schließlich in Hellen
Aufruhr gerieten. Es brach jener furchtbare, vier
Jahre dauernde Söldnerkrieg aus, der Karthago mehr
als einmal an den Rand des Verderbens gebracht
hat und nur durch die überlegene Feldherrnkunst des
in der höchsten Not wieder auf dem Plane erscheinenden
Hamilkar Bartas zu einem glücklichen Ende geführt morden
ist. Dieser Krieg nun hat dem französischen Schriftsteller
Flaubert den Stoff zu seinem großen historischen Roman
„SalammbS" geliefert, aus dem unser interessantes Bild
auf Seite 185 eine der packendsten Szenen wiedergibt. Sa-
lammbü ist die schöne, jungfräuliche Tochter des Hamilkar
Barkas, die schwärmerische Verehrerin der Göttin Tanit,
derLiebesgöttin, an deren geheimnisvollen, im Tempel ver-
borgen gehaltenen Schleier sich der Glaube an die Unbesieg-
barkeit Karthagos knüpft. Um die Söldner bei guter Laune
zu erhalten und zugleich dem abwesenden Hamilkar einen
empfindlichen Streich zu spielen, hat der „Rat der Alten"
ihnen erlaubt, in den wundervollen Gärten ihres ehe-
maligen Feldherrn ein Fest zur Erinnerung an den Sieg
bei Eryx, Hamilkars größte Waffentat, zu feiern Da
geht es denn über die Maßen wüst zu, und als die
Trunkenheit überhand nimmt, vergreift sich das rohe
Kriegervolk schließlich an des unfreiwilligen Gastgebers
Eigentum und richtet ungeheuren Schaden an. Doch
plötzlich erscheint Salammbö, begleitet von ihren Freun-
den, den Priestern der Tanit, und sucht durch ernsten
Zuspruch dem wilden Treiben Einhalt zu tun. Diese
Szene ist es, die der Künstler in unserem Bilde sestgehalten
hat. Allmählich geht ihre Ansprache in eine Art Ver-
zückung über, und alles lauscht wie gebannt ihren Worten.
Ein Hauptmann aber, ein riesiger Libyer, Matho mit
Namen, ist von ihrem Liebreiz so gefesselt, daß er in
heißer Liebs zu ihr entbrennt und sie zu gewinnen sucht.
Als er dann später der oberste Anführer der Karthago
bedrängenden Söldner- und Barbarenbanden geworden
ist, scheint sein Wunsch in Erfüllung gehen zu sollen.
Es ist ihm geglückt, den Schleier der Tanit zu rauben,
und Salammbö wird von dem Oberpriester veranlaßt,
ihn wieder herbeizuschaffen. Sie begibt sich in das Lager
zu Matho, der sie nun in seiner Gewalt zu haben
glaubt. Es gelingt ihr aber, im Kampfgewirr mit dem
Schleier zu entrinnen. Matho wird später gefangen
genommen und grausam hingerichtet vor Salammbös
Augen, bei ihrer Vermählungsfeier mit einem jungen
Numidierfürsten. Plötzlich finkt Salammbö nieder und
stirbt — sie hat Matho geliebt.