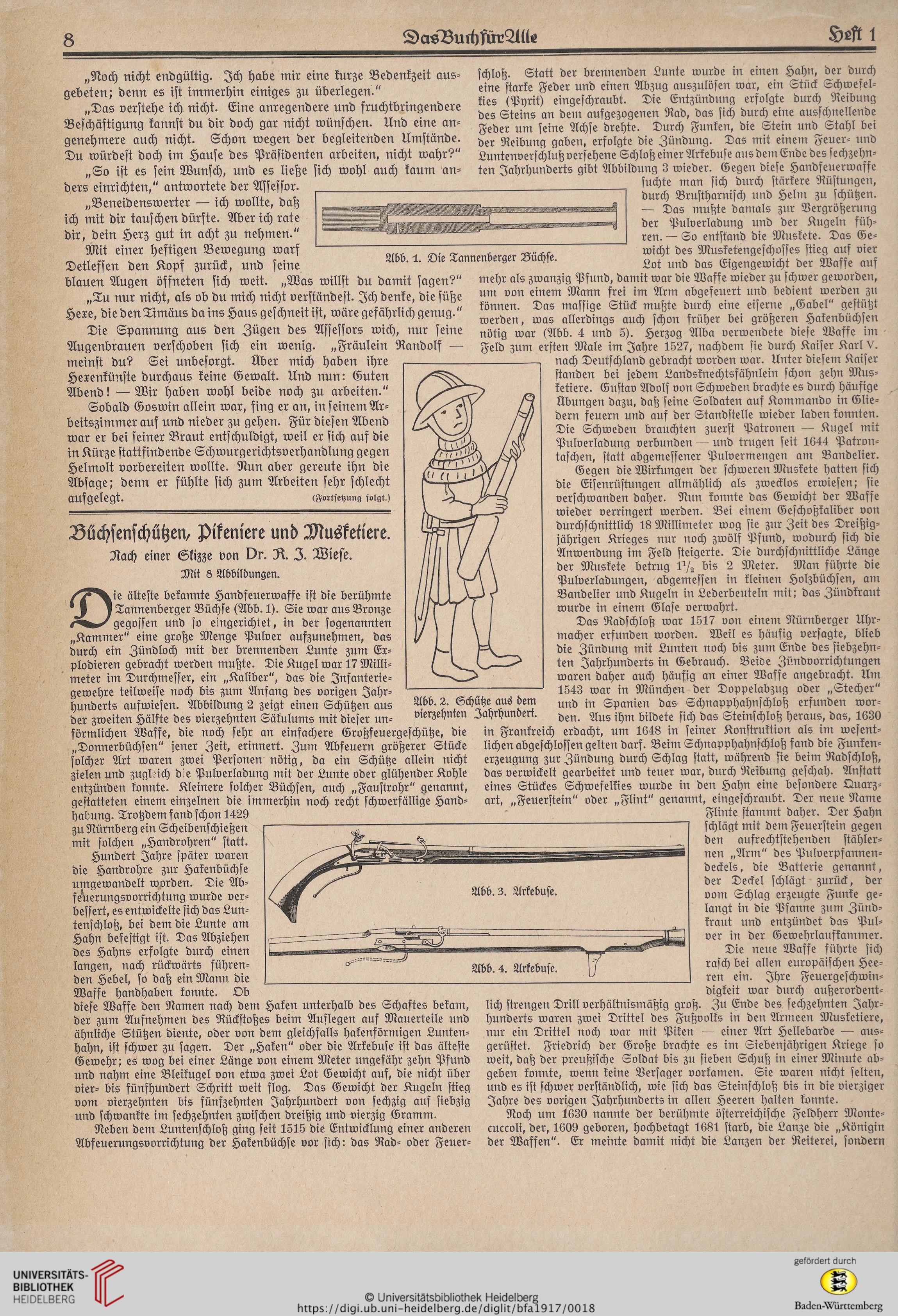8
DasBuchsürAlle
Heft 1
„Noch nicht endgültig. Ich habe mir eine kurze Bedenkzeit aus-
gebeten; denn es ist immerhin einiges zu überlegen."
„Das verstehe ich nicht. Eine anregendere und fruchtbringendere
Beschäftigung kannst du dir doch gar nicht wünschen. Und eine an-
genehmere auch nicht. Schon wegen der begleitenden Umstände.
Du würdest doch im Hause des Präsidenten arbeiten, nicht wahr?"
„So ist es sein Wunsch, und es liehe sich wohl auch kaum an-
ders einrichten," antwortete der Assessor.
„Beneidenswerter — ich wollte, daß
ich mit dir tauschen dürfte. Aber ich rate
dir, dein Herz gut in acht zu Nehmen."
Mit einer heftigen Bewegung warf
Detlefsen den Kopf zurück, und seine
blauen Augen öffneten sich weit. „Mas willst du damit sagen?"
„Tu nur nicht, als ob du mich nicht verständest. Ich denke, die süsze
Here, die den Timäus da ins Haus geschneit ist, wäre gefährlich genug."
Die Spannung aus den Zügen des Assessors wich, nur seine
Augenbrauen verschoben sich ein wenig. „Fräulein Randolf —
meinst du? Sei unbesorgt. Aber mich haben ihre
Hexenkünste durchaus keine Gewalt. Und nun: Guten
Abend! — Wir haben wohl beide noch zu arbeiten."
Sobald Goswin allein war, fing er an, in seinem Ar-
beitszimmer auf und nieder zu gehen. Für diesen Abend
war er bei seiner Braut entschuldigt, weil er sich auf die
in Kürze stattfindende Schwurgerichtsverhandlung gegen
Helmolt vorbereiten wollte. Nun aber gereute ihn die
Absage; denn er fühlte sich zum Arbeiten sehr schlecht
aufgelegt. (Fortsetzung folgt.,
Büchsenschützen, Pikeniere und Musketiere.
Nach einer Skizze von Ov. R. I. Wiese.
Mit 8 Abbildungen.
ie älteste bekannte Handfeuerwaffe ist die berühmte
Tannenberger Büchse (Abb. 1). Sie war aus Bronze
gegossen und so eingerichtet, in der sogenannten
„Kammer" eine große Menge Pulver aufzunehmen, das
durch ein Zündloch mit der brennenden Lunte zum Ex-
plodieren gebracht werden mußte. Die Kugel war 17 Milli-
meter im Durchmesser, ein „Kaliber", das die Infanterie-
gewehre teilweise noch bis zum Anfang des vorigen Jahr-
hunderts aufwiesen. Abbildung 2 zeigt einen Schützen aus
der zweiten Hälfte des vierzehnten Säkulums mit dieser un-
förmlichen Waffe, die noch sehr an einfachere Großfeuergeschütze, die
„Donnerbüchsen" jener Zeit, erinnert. Zum Abfeuern größerer Stücke
solcher Art waren zwei Personen nötig, da ein Schütze allein nicht
zielen und zugleich d e Pulverladung mit der Lunte oder glühender Kohle
entzünden konnte. Kleinere solcher Büchsen, auch „Faustrohr" genannt,
gestatteten einem einzelnen die immerhin noch recht schwerfällige Hand-
habung. Trotzdem fand schon 1429
zu Nürnberg ein Scheibenschießen
mit solchen „Handrohren" statt.
Hundert Jahre später waren
die Handrohre zur Hakenbüchse
umgewandelt worden. Die Ab¬
feuerungsvorrichtung wurde ver¬
bessert, es entwickelte sich das Lun¬
tenschloß, bei dem die Lunte am
Hahn befestigt ist. Das Abziehen
des Hahns erfolgte durch einen
langen, nach rückwärts führen¬
den Hebel, so daß ein Mann die
Waffe handhaben konnte. Ob
diese Waffe den Namen nach dem Haken unterhalb des Schaftes bekam,
der zum Aufnehmen des Rückstoßes beim Auflegen auf Mauerteile und
ähnliche Stützen diente, oder von dem gleichfalls hakenförmigen Lunten-
hahn, ist schwer zu sagen. Der „Haken" oder die Arkebuse ist das älteste
Gewehr; es wog bei einer Länge von einem Meter ungefähr zehn Pfund
und nahm eine Bleikugel von etwa zwei Lot Gewicht auf, die nicht über
vier- bis fünfhundert Schritt weit flog. Das Gewicht der Kugeln stieg
vom vierzehnten bis fünfzehnten Jahrhundert von sechzig auf siebzig
und schwankte im sechzehnten zwischen dreißig und vierzig Gramm.
Neben dem Luntenschloß ging seit 1515 die Entwicklung einer anderen
Abfeuerungsvorrichtung der Hakenbüchse vor sich: das Rad- oder Feuer-
schloß. Statt der brennenden Lunte wurde in einen Hahn, der durch
eine starke Feder und einen Abzug auszulösen war, ein Strick Schwefel-
kies (Pyrit) eingeschraubt. Die Entzündung erfolgte durch Reibung
des Steins an dem aufgezogenen Rad, das sich durch eine ausschnellende
Feder um seine Achse drehte. Durch Funken, die Stein und Stahl bei
der Reibung gaben, erfolgte die Zündung. Das mit einem Feuer- und
Luntenverschluß versehene Schloß einer Arkebuse aus dem Ende des sechzehn-
ten Jahrhunderts gibt Abbildung 3 wieder. Gegen diese Handfeuerwaffe
suchte man sich durch stärkere Rüstungen,
durch Brustharnisch und Helm zu schützen.
— Das mußte damals zur Vergrößerung
der Pulverladung und der Kugeln füh-
ren. — So entstand die Muskete. Das Ge-
wicht des Musketengeschosses stieg auf vier
Lot und das Eigengewicht der Waffe auf
mehr als zwanzig Pfund, damit war die Waffe wieder zu schwer geworden,
um von einem Mann frei im Arm abgefeuert und bedient werden zu
können. Das massige Stück mußte durch eine eiserne „Gabel" gestützt
werden, was allerdings auch schon früher bei größeren Hakenbüchsen
nötig war (Abb. 4 und 5). Herzog Alba verwendete diese Waffe im
Feld zum ersten Male im Jahre 1527, nachdem sie durch Kaiser Karl V.
nach Deutschland gebracht worden war. Unter diesem Kaiser
standen bei jedem Landsknechtsfähnlein schon zehn Mus-
ketiere. Gustav Adolf von Schweden brachte es durch häufige
Übungen dazu, daß seine Soldaten auf Kommando in Glie-
dern feuern und auf der Standstelle wieder laden konnten.
Die Schweden brauchten zuerst Patronen — Kugel mit
Pulverladung verbunden — und trugen seit 1644 Patron-
taschen, statt abgemessener Pulvermengen am Bandelier.
Gegen die Wirkungen der schweren Muskete hatten sich
die Eisenrüstungen allmählich als zwecklos erwiesen; sie
verschwanden daher. Nun konnte das Gewicht der Waffe
wieder verringert werden. Bei einem Eeschoßkaliber von
durchschnittlich 18 Millimeter wog sie zur Zeit des Dreißig-
jährigen Krieges nur noch zwölf Pfund, wodurch sich die
Anwendung im Feld steigerte. Die durchschnittliche Länge
der Muskete betrug 1^ bis 2 Meter. Man führte die
Pulverladungen, abgemessen in kleinen Holzbüchsen, am
Bandelier und Kugeln in Lederbeuteln mit; das Zündkraut
wurde in einem Glase verwahrt.
Das Radschloß war 1517 von einem Nürnberger Uhr-
macher erfunden worden. Weil es häufig versagte, blieb
die Zündung mit Lunten noch bis zum Ende des siebzehn-
ten Jahrhunderts in Gebrauch. Beide Zündvorrichtungen
waren daher auch häufig an einer Waffe angebracht. Um
1543 war in München der Doppelabzug oder „Stecher"
und in Spanien das Schnapphahnschloß erfunden wor-
den. Aus ihm bildete sich das Steinschloß heraus, das, 1630
in Frankreich erdacht, um 1648 in seiner Konstruktion als im wesent-
lichenabgeschlossengelten darf. Beim Schnapphahnschloß fand die Funken-
erzeugung zur Zündung durch Schlag statt, während sie beim Radschloß,
das verwickelt gearbeitet und teuer war, durch Reibung geschah. Anstatt
eines Stückes Schwefelkies wurde in den Hahn eine besondere Quarz-
art, „Feuerstein" oder „Flint" genannt, eingeschraubt. Der neue Name
Flinte stammt daher. Der Hahn
schlägt mit dem Feuerstein gegen
den aufrechtstehenden stähler-
nen „Arm" des Pulverpfannen-
deckels, die Batterie genannt,
der Deckel schlägt zurück, der
von: Schlag erzeugte Funke ge-
langt in die Pfanne zum Zünd-
kraut und entzündet das Pul-
ver in der Gewehrlanfkammer.
Die neue Waffe führte sich
rasch bei allen europäischen Hee-
ren ein. Ihre Feuergeschwin-
digkeit war durch außerordent-
lich strengen Drill verhältnismäßig groß. Zu Ende des sechzehnten Jahr-
hunderts waren zwei Drittel des Fußvolks in den Armeen Musketiere,
nur ein Drittel noch war mit Piken — einer Art Hellebarde — aus-
gerüstet. Friedrich der Große brachte es im Siebenjährigen Kriege so
weit, daß der preußische Soldat bis zu sieben Schuß in einer Minute ab-
geben konnte, wenn keine Versager vorkamen. Sie waren nicht selten,
und es ist schwer verständlich, wie sich das Steinschloß bis in die vierziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts in allen Heeren halten konnte.
Noch um 1630 nannte der berühmte österreichische Feldherr Monte-
cuccoli, der, 1609 geboren, hochbetagt 1681 starb, die Lanze die „Königin
der Waffen". Er meinte damit nicht die Lanzen der Reiterei, sondern
Abb. 1. Oie Tannenberger Büchse.
Abb. 2. Schütze aus dem
vierzehnten Jahrhundert.
DasBuchsürAlle
Heft 1
„Noch nicht endgültig. Ich habe mir eine kurze Bedenkzeit aus-
gebeten; denn es ist immerhin einiges zu überlegen."
„Das verstehe ich nicht. Eine anregendere und fruchtbringendere
Beschäftigung kannst du dir doch gar nicht wünschen. Und eine an-
genehmere auch nicht. Schon wegen der begleitenden Umstände.
Du würdest doch im Hause des Präsidenten arbeiten, nicht wahr?"
„So ist es sein Wunsch, und es liehe sich wohl auch kaum an-
ders einrichten," antwortete der Assessor.
„Beneidenswerter — ich wollte, daß
ich mit dir tauschen dürfte. Aber ich rate
dir, dein Herz gut in acht zu Nehmen."
Mit einer heftigen Bewegung warf
Detlefsen den Kopf zurück, und seine
blauen Augen öffneten sich weit. „Mas willst du damit sagen?"
„Tu nur nicht, als ob du mich nicht verständest. Ich denke, die süsze
Here, die den Timäus da ins Haus geschneit ist, wäre gefährlich genug."
Die Spannung aus den Zügen des Assessors wich, nur seine
Augenbrauen verschoben sich ein wenig. „Fräulein Randolf —
meinst du? Sei unbesorgt. Aber mich haben ihre
Hexenkünste durchaus keine Gewalt. Und nun: Guten
Abend! — Wir haben wohl beide noch zu arbeiten."
Sobald Goswin allein war, fing er an, in seinem Ar-
beitszimmer auf und nieder zu gehen. Für diesen Abend
war er bei seiner Braut entschuldigt, weil er sich auf die
in Kürze stattfindende Schwurgerichtsverhandlung gegen
Helmolt vorbereiten wollte. Nun aber gereute ihn die
Absage; denn er fühlte sich zum Arbeiten sehr schlecht
aufgelegt. (Fortsetzung folgt.,
Büchsenschützen, Pikeniere und Musketiere.
Nach einer Skizze von Ov. R. I. Wiese.
Mit 8 Abbildungen.
ie älteste bekannte Handfeuerwaffe ist die berühmte
Tannenberger Büchse (Abb. 1). Sie war aus Bronze
gegossen und so eingerichtet, in der sogenannten
„Kammer" eine große Menge Pulver aufzunehmen, das
durch ein Zündloch mit der brennenden Lunte zum Ex-
plodieren gebracht werden mußte. Die Kugel war 17 Milli-
meter im Durchmesser, ein „Kaliber", das die Infanterie-
gewehre teilweise noch bis zum Anfang des vorigen Jahr-
hunderts aufwiesen. Abbildung 2 zeigt einen Schützen aus
der zweiten Hälfte des vierzehnten Säkulums mit dieser un-
förmlichen Waffe, die noch sehr an einfachere Großfeuergeschütze, die
„Donnerbüchsen" jener Zeit, erinnert. Zum Abfeuern größerer Stücke
solcher Art waren zwei Personen nötig, da ein Schütze allein nicht
zielen und zugleich d e Pulverladung mit der Lunte oder glühender Kohle
entzünden konnte. Kleinere solcher Büchsen, auch „Faustrohr" genannt,
gestatteten einem einzelnen die immerhin noch recht schwerfällige Hand-
habung. Trotzdem fand schon 1429
zu Nürnberg ein Scheibenschießen
mit solchen „Handrohren" statt.
Hundert Jahre später waren
die Handrohre zur Hakenbüchse
umgewandelt worden. Die Ab¬
feuerungsvorrichtung wurde ver¬
bessert, es entwickelte sich das Lun¬
tenschloß, bei dem die Lunte am
Hahn befestigt ist. Das Abziehen
des Hahns erfolgte durch einen
langen, nach rückwärts führen¬
den Hebel, so daß ein Mann die
Waffe handhaben konnte. Ob
diese Waffe den Namen nach dem Haken unterhalb des Schaftes bekam,
der zum Aufnehmen des Rückstoßes beim Auflegen auf Mauerteile und
ähnliche Stützen diente, oder von dem gleichfalls hakenförmigen Lunten-
hahn, ist schwer zu sagen. Der „Haken" oder die Arkebuse ist das älteste
Gewehr; es wog bei einer Länge von einem Meter ungefähr zehn Pfund
und nahm eine Bleikugel von etwa zwei Lot Gewicht auf, die nicht über
vier- bis fünfhundert Schritt weit flog. Das Gewicht der Kugeln stieg
vom vierzehnten bis fünfzehnten Jahrhundert von sechzig auf siebzig
und schwankte im sechzehnten zwischen dreißig und vierzig Gramm.
Neben dem Luntenschloß ging seit 1515 die Entwicklung einer anderen
Abfeuerungsvorrichtung der Hakenbüchse vor sich: das Rad- oder Feuer-
schloß. Statt der brennenden Lunte wurde in einen Hahn, der durch
eine starke Feder und einen Abzug auszulösen war, ein Strick Schwefel-
kies (Pyrit) eingeschraubt. Die Entzündung erfolgte durch Reibung
des Steins an dem aufgezogenen Rad, das sich durch eine ausschnellende
Feder um seine Achse drehte. Durch Funken, die Stein und Stahl bei
der Reibung gaben, erfolgte die Zündung. Das mit einem Feuer- und
Luntenverschluß versehene Schloß einer Arkebuse aus dem Ende des sechzehn-
ten Jahrhunderts gibt Abbildung 3 wieder. Gegen diese Handfeuerwaffe
suchte man sich durch stärkere Rüstungen,
durch Brustharnisch und Helm zu schützen.
— Das mußte damals zur Vergrößerung
der Pulverladung und der Kugeln füh-
ren. — So entstand die Muskete. Das Ge-
wicht des Musketengeschosses stieg auf vier
Lot und das Eigengewicht der Waffe auf
mehr als zwanzig Pfund, damit war die Waffe wieder zu schwer geworden,
um von einem Mann frei im Arm abgefeuert und bedient werden zu
können. Das massige Stück mußte durch eine eiserne „Gabel" gestützt
werden, was allerdings auch schon früher bei größeren Hakenbüchsen
nötig war (Abb. 4 und 5). Herzog Alba verwendete diese Waffe im
Feld zum ersten Male im Jahre 1527, nachdem sie durch Kaiser Karl V.
nach Deutschland gebracht worden war. Unter diesem Kaiser
standen bei jedem Landsknechtsfähnlein schon zehn Mus-
ketiere. Gustav Adolf von Schweden brachte es durch häufige
Übungen dazu, daß seine Soldaten auf Kommando in Glie-
dern feuern und auf der Standstelle wieder laden konnten.
Die Schweden brauchten zuerst Patronen — Kugel mit
Pulverladung verbunden — und trugen seit 1644 Patron-
taschen, statt abgemessener Pulvermengen am Bandelier.
Gegen die Wirkungen der schweren Muskete hatten sich
die Eisenrüstungen allmählich als zwecklos erwiesen; sie
verschwanden daher. Nun konnte das Gewicht der Waffe
wieder verringert werden. Bei einem Eeschoßkaliber von
durchschnittlich 18 Millimeter wog sie zur Zeit des Dreißig-
jährigen Krieges nur noch zwölf Pfund, wodurch sich die
Anwendung im Feld steigerte. Die durchschnittliche Länge
der Muskete betrug 1^ bis 2 Meter. Man führte die
Pulverladungen, abgemessen in kleinen Holzbüchsen, am
Bandelier und Kugeln in Lederbeuteln mit; das Zündkraut
wurde in einem Glase verwahrt.
Das Radschloß war 1517 von einem Nürnberger Uhr-
macher erfunden worden. Weil es häufig versagte, blieb
die Zündung mit Lunten noch bis zum Ende des siebzehn-
ten Jahrhunderts in Gebrauch. Beide Zündvorrichtungen
waren daher auch häufig an einer Waffe angebracht. Um
1543 war in München der Doppelabzug oder „Stecher"
und in Spanien das Schnapphahnschloß erfunden wor-
den. Aus ihm bildete sich das Steinschloß heraus, das, 1630
in Frankreich erdacht, um 1648 in seiner Konstruktion als im wesent-
lichenabgeschlossengelten darf. Beim Schnapphahnschloß fand die Funken-
erzeugung zur Zündung durch Schlag statt, während sie beim Radschloß,
das verwickelt gearbeitet und teuer war, durch Reibung geschah. Anstatt
eines Stückes Schwefelkies wurde in den Hahn eine besondere Quarz-
art, „Feuerstein" oder „Flint" genannt, eingeschraubt. Der neue Name
Flinte stammt daher. Der Hahn
schlägt mit dem Feuerstein gegen
den aufrechtstehenden stähler-
nen „Arm" des Pulverpfannen-
deckels, die Batterie genannt,
der Deckel schlägt zurück, der
von: Schlag erzeugte Funke ge-
langt in die Pfanne zum Zünd-
kraut und entzündet das Pul-
ver in der Gewehrlanfkammer.
Die neue Waffe führte sich
rasch bei allen europäischen Hee-
ren ein. Ihre Feuergeschwin-
digkeit war durch außerordent-
lich strengen Drill verhältnismäßig groß. Zu Ende des sechzehnten Jahr-
hunderts waren zwei Drittel des Fußvolks in den Armeen Musketiere,
nur ein Drittel noch war mit Piken — einer Art Hellebarde — aus-
gerüstet. Friedrich der Große brachte es im Siebenjährigen Kriege so
weit, daß der preußische Soldat bis zu sieben Schuß in einer Minute ab-
geben konnte, wenn keine Versager vorkamen. Sie waren nicht selten,
und es ist schwer verständlich, wie sich das Steinschloß bis in die vierziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts in allen Heeren halten konnte.
Noch um 1630 nannte der berühmte österreichische Feldherr Monte-
cuccoli, der, 1609 geboren, hochbetagt 1681 starb, die Lanze die „Königin
der Waffen". Er meinte damit nicht die Lanzen der Reiterei, sondern
Abb. 1. Oie Tannenberger Büchse.
Abb. 2. Schütze aus dem
vierzehnten Jahrhundert.