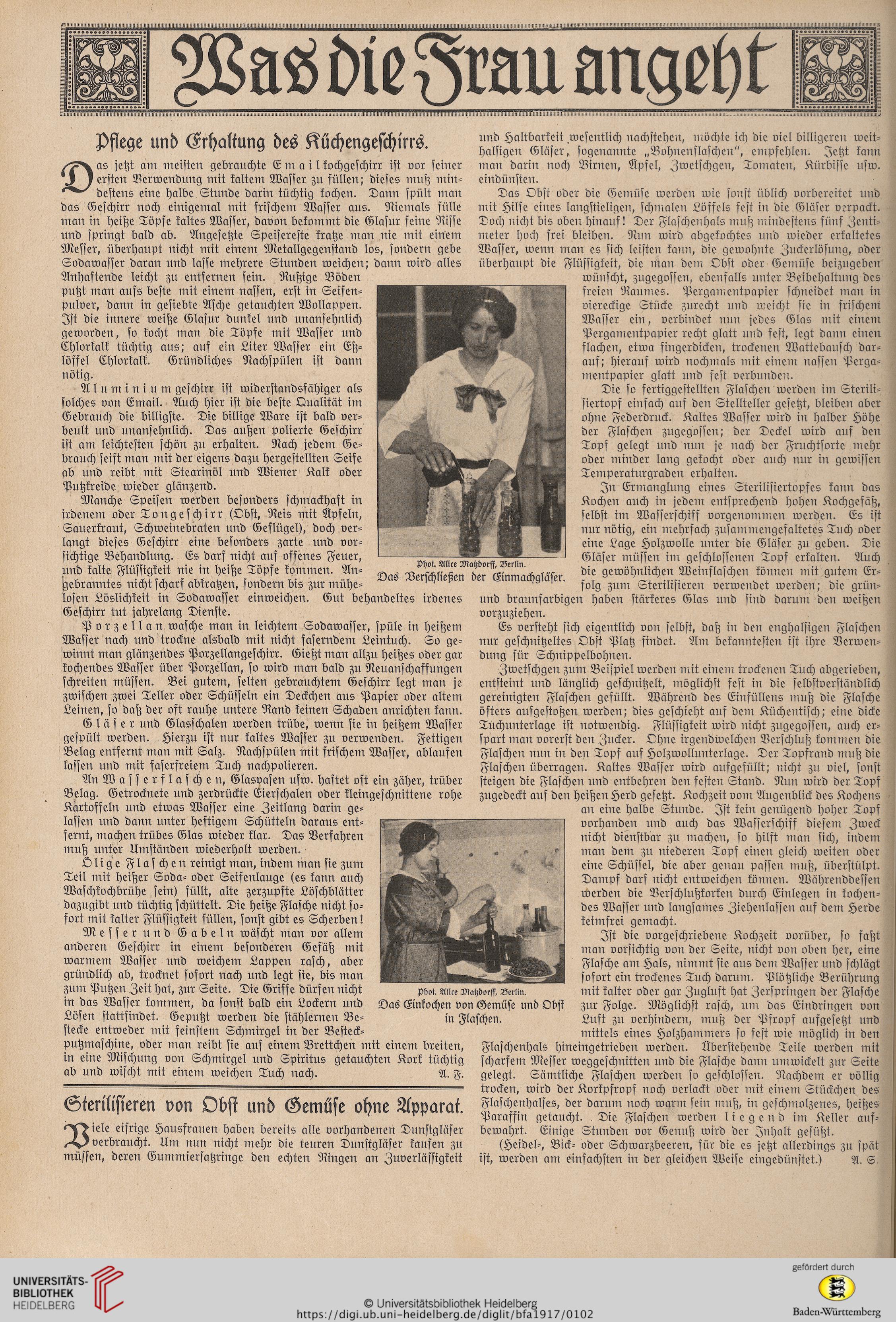pflege und Erhaltung des Küchengeschirrs.
as jetzt am meisten gebrauchte Email kochgeschirr ist vor seiner
ersten Verwendung mit kaltem Wasser zu füllen; dieses must min-
destens eine halbe Stunde darin tüchtig kochen. Dann spült man
das Geschirr noch einigemal mit frischem Wasser aus. Niemals fülle
man in heiste Töpfe kaltes Wasser, davon bekommt die Glasur feine Nisse
und springt bald ab. Angesetzte Speisereste kratze man nie mit einem
Messer, überhaupt nicht mit einem Metallgegenstand los, sondern gebe
Sodawasser daran und lasse mehrere Stunden weichen; dann wird alles
Anhaftende leicht zu entfernen sein. Rüstige Böden
putzt man aufs beste mit einem nassen, erst in Seifen-
pulver, dann in gesiebte Asche getauchten Wollappen.
Ist die innere weitze Glasur dunkel und unansehnlich
geworden, so kocht man die Töpfe mit Wasser und
Chlorkalk tüchtig aus; auf ein Liter Wasser ein Eß-
löffel Chlorkalk. Gründliches Nachspülen ist dann
nötig.
A l u m i n i u m geschirr ist widerstandsfähiger als
solches von Email. Auch hier ist die beste Qualität im
Gebrauch die billigste. Die billige Ware ist bald ver-
beult und unansehnlich. Das außen polierte Geschirr
ist am leichtesten schön zu erhalten. Nach jedem Ge-
brauch seift man mit der eigens dazu hergestellten Seife
ab und reibt mit Stearinöl und Wiener Kalk oder
Putzkreide wieder glänzend.
Manche Speisen werden besonders schmackhaft in
irdenem oder Tongeschirr (Obst, Reis mit Äpfeln,
Sauerkraut, Schweinebraten und Geflügel), doch ver-
langt dieses Geschirr eine besonders zarte und vor-
sichtige Behandlung. Es darf nicht auf offenes Feuer,
und kalte Flüssigkeit nie in heiße Töpfe kommen. Un-
gebranntes nicht scharf abkratzen, sondern bis zur mühe-
losen Löslichkeit in Sodawasser einweichen. Gut behandeltes irdenes
Geschirr tut jahrelang Dienste.
Porzellan wasche man in leichtem Sodawasser, spüle in heißem
Wasser nach und trockne alsbald mit nicht faserndem Leintuch. So ge-
winnt man glänzendes Porzellangeschirr. Gießt man allzu heißes oder gar
kochendes Wasser über Porzellan, so wird man bald zu Neuanschaffungen
schreiten müssen. Bei gutem, selten gebrauchtem Geschirr legt man je
zwischen zwei Teller oder Schüsseln ein Deckchen aus Papier oder altem
Leinen, so daß der oft rauhe untere Rand keinen Schaden anrichten kann.
Gläser und Glasschalen werden trübe, wenn sie in heißem Wasser
gespült werden. Hierzu ist nur kaltes Wasser zu verwenden. Fettigen
Belag entfernt man mit Salz. Nachspülen mit frischem Wasser, ablaufen
lassen und mit faserfreiem Tuch nachpolieren.
An Wasserflaschen, Glasvasen usw. haftet oft ein zäher, trüber
Belag. Getrocknete und zerdrückte Eierschalen oder kleingeschnittene rohe
Kartoffeln und etwas Wasser eine Zeitlang darin ge-
lassen und dann unter heftigem Schütteln daraus ent-
fernt, machen trübes Glas wieder klar. Das Verfahren
muß unter Umständen wiederholt werden.
Ölige Flaschen reinigt man, indem man sie zum
Teil mit heißer Soda- oder Seifenlauge (es kann auch
Waschkochbrühe sein) füllt, alte zerzupfte Löschblätter
dazugibt und tüchtig schüttelt. Die heiße Flasche nicht so-
fort mit kalter Flüssigkeit füllen, sonst gibt es Scherben!
Messer und Gabeln wäscht man vor allem
anderen Geschirr in einem besonderen Gefäß mit
warmem Wasser und weichem Lappen rasch, aber
gründlich ab, trocknet sofort nach und legt sie, bis man
zum Putzen Zeit hat, zur Seite. Die Griffe dürfen nicht
in das Wasser kommen, da sonst bald ein Lockern und
Lösen stattfindet. Geputzt werden die stählernen Be¬
stecke entweder mit feinstem Schmirgel in der Besteck¬
putzmaschine, oder man reibt sie auf einem Brettchen mit einein breiten,
in eine Mischung von Schmirgel und Spiritus getauchten Kork tüchtig
ab und wischt mit einem weichen Tuch nach. A. F.
Sterilisieren von Obst und Gemüse ohne Apparat,
iele eifrige Hausfrauen haben bereits alle vorhandenen Dunstgläser
verbraucht. Um nun nicht mehr die teuren Dunstgläser kaufen zu
müssen, deren Eummiersatzringe den echten Ringen an Zuverlässigkeit
und Haltbarkeit wesentlich nachstehen, möchte ich die viel billigeren weit-
halsigen Gläser, sogenannte „Bohnenflaschen", empfehlen. Jetzt kann
man darin noch Birnen, Apfel, Zwetschgen, Tomaten, Kürbisse usw.
eindünsten.
Das Obst oder die Gemüse werden wie sonst üblich vorbereitet und
mit Hilfe eines langstieligen, schmalen Löffels fest in die Gläser verpackt.
Doch nicht bis oben hinauf! Der Flaschenhals muß mindestens fünf Zenti-
meter hoch frei bleiben. Nun wird abgekochtes und wieder erkaltetes
Wasser, wenn man es sich leisten kann, die gewohnte Znckerlösung, oder
überhaupt die Flüssigkeit, die man dem Obst oder Gemüse beizugeben
wünscht, zugegossen, ebenfalls unter Beibehaltung des
freien Raumes. Pergamentpapier schneidet man in
viereckige Stücke zurecht und weicht sie in frischem
Wasser ein, verbindet nun jedes Glas mit einem
Pergamentpapier recht glatt und fest, legt dann einen
flachen, etwa fingerdicken, trockenen Wattebausch dar-
auf; hierauf wird nochmals mit einem nassen Perga-
mentpapier glatt und fest verbunden.
Die so fertiggestellten Flaschen werden im Sterili-
siertopf einfach auf den Stellteller gesetzt, bleiben aber
ohne Federdruck. Kaltes Wasser wird in halber Höhe
der Flaschen zugegossen; der Deckel wird auf den
Topf gelegt und nun je nach der Fruchtsorte mehr
oder minder lang gekocht oder auch nur in gewissen
Temperaturgraden erhalten.
In Ermanglung eines Sterilisiertopfes kann das
Kochen auch in jedem entsprechend hohen Kochgefäß,
selbst im Wasserschiff vorgenommen werden. Es ist
nur nötig, ein mehrfach zusammengefaltetes Tuch oder
eine Lage Holzwolle unter die Gläser zu geben. Die
Gläser müssen im geschlossenen Topf erkalten. Auch
die gewöhnlichen Weinflaschen können mit gutem Er-
folg zum Sterilisieren verwendet werden; die grün-
und braunfarbigen haben stärkeres Glas und sind darum den weißen
vorzuziehen.
Es versteht sich eigentlich von selbst, daß in den enghalsigen Flaschen
nur geschnitzeltes Obst Platz findet. Am bekanntesten ist ihre Verwen-
dung für Schnippelbohnen.
Zwetschgen zum Beispiel werden mit einem trockenen Tuch abgerieben,
entsteint und länglich geschnitzelt, möglichst fest in die selbstverständlich
gereinigten Flaschen gefüllt. Während des Einfüllens muß die Flasche
öfters aufgestoßen werden; dies geschieht auf dem Küchentisch; eine dicke
Tuchunterlage ist notwendig. Flüssigkeit wird nicht zugegossen, auch er-
spart man vorerst den Zucker. Ohne irgendwelchen Verschluß kommen die
Flaschen nun in den Topf auf Holzwollunterlage. Der Topfrand muß die
Flaschen überragen. Kaltes Wasser wird aufgesüllt; nicht zu viel, sonst
steigen die Flaschen und entbehren den festen Stand. Nun wird der Topf
zugedeckt auf den heißen Herd gesetzt. Kochzeit vom Augenblick des Kochens
an eine halbe Stunde. Ist kein genügend hoher Topf
vorhanden und auch das Wasserschiff diesem Zweck
nicht dienstbar zu machen, so hilft man sich, indem
man dem zu niederen Topf einen gleich weiten oder
eine Schüssel, die aber genau passen muß, überstülpt.
Dampf darf nicht entweichen können. Währenddessen
werden die Verschlußkorken durch Einlegen in kochen-
des Wasser und langsames Ziehenlassen auf dem Herde
keimfrei gemacht.
Ist die vorgeschriebene Kochzeit vorüber, so faßt
man vorsichtig von der Seite, nicht von oben her, eine
Flasche am Hals, nimmt sie aus dem Wasser und schlägt
sofort ein trockenes Tuch darum. Plötzliche Berührung
mit kalter oder gar Zugluft hat Zerspringen der Flasche
zur Folge. Möglichst rasch, um das Eindringen von
Luft zu verhindern, muß der Pfropf aufgesetzt und
mittels eines Holzhammers so fest wie möglich in den
Flaschenhals hineingetrieben werden, lkberstehende Teile werden mit
scharfem Messer weggeschnitten und die Flasche dann umwickelt zur Seite
gelegt. Sämtliche Flaschen werden so geschlossen. Nachdem er völlig
trocken, wird der Korkpfropf noch verlackt oder mit einem Stückchen des
Flaschenhalses, der darum noch warm sein muß, in geschmolzenes, heißes
Paraffin getaucht. . Die Flaschen werden liegend im Keller auf-
bewahrt. Einige Stunden vor Genuß wird der Inhalt gesüßt.
(Heidel-, Bick- oder Schwarzbeeren, für die es jetzt allerdings zu spät
ist, werden am einfachsten in der gleichen Weise eingedünstet.) A. S.
Phot. Alice Mahdorff, Berlin.
Das Verschließen der Einmachgläser.
Phot. Alice Matzdorff, Berlin.
Das Einkochen von Gemüse und Obst
in Flaschen.