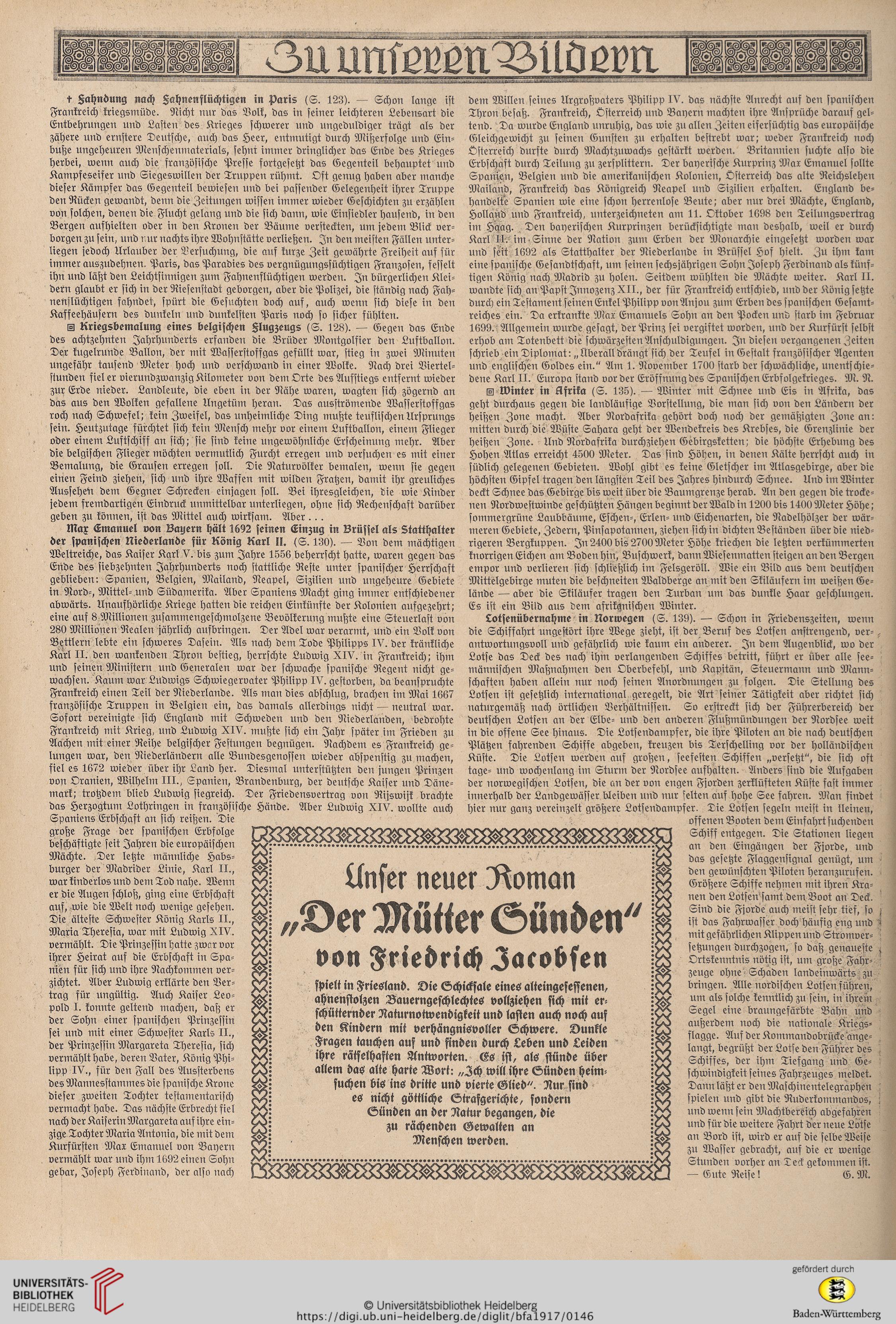.SMS
MW
SÜ. WsvenMlüevrr
WWWWW
1- Fahndung nach Fahnenflüchtigen in Paris (S. 123). — Schon lange ist
Frankreich kriegsmüde. Nicht nur das Volk, das in seiner leichteren Lebensart die
Entbehrungen und Lasten des Krieges schwerer und ungeduldiger trägt als der
zähere uud ernstere Deutsche, auch das Heer, entmutigt durch Misterfolge und Ein-
buße ungeheuren Menschenmaterials, sehnt immer dringlicher das Ende des Krieges
herbei, wenn auch die französische Presse fortgesetzt das Gegenteil behauptet uud
Kampfeseifer und Siegeswillen der Truppen rühmt. Oft genug haben aber manche
dieser Kämpfer das Gegenteil bewiesen und bei passender Gelegenheit ihrer Truppe
den Rücken gewandt, denn die Zeitungen wissen immer wieder Geschichten zu erzählen
von solchen, denen die Flucht gelang und die sich dann, wie Einsiedler hausend, in den
Bergen aufhielten oder in den Kronen der Bäume versteckten, um jedem Blick ver-
borgen zu sein, und nur uachts ihre Wohnstätte verließen. In den meisten Fällen unter-
liegen jedoch Urlauber der Versuchung, die auf kurze Zeit gewährte Freiheit auf für
immer auszudehnen. Paris, das Paradies des vergnügungssüchtigen Franzosen, fesselt
ihn und läßt den Leichtsinnigen zum Fahnenflüchtigen werden. In bürgerlichen Klei-
dern glaubt er sich in der Riesenstadt geborgen, aber die Polizei, die ständig nach Fah-
nenslüchtigen fahndet, spürt die Gesuchten doch auf, auch wenn sich diese in den
Kaffeehäusern des dunkeln und dunkelsten Paris noch so sicher fühlten.
IZ Kriegsbemalung eines belgischen Flugzeugs (S. 128). — Gegen das Ende
des achtzehnten Jahrhunderts erfanden die Brüder Montgolfier den Luftballon.
Der kugelrunde Ballon, der mit Wasserstoffgas gefüllt war, stieg in zwei Minuten
ungefähr tausend Meter hoch und verschwand in einer Wolke. Nach drei Viertel-
stunden fiel er vierundzwanzig Kilometer von dem Orte des Aufstiegs eutfernt wieder
zur Erde nieder. Landleute, die eben in der Nähe waren, wagten sich zögernd an
das aus den Wolken gefallene Ungetüm heran. Das ausströmende Wasserstoffgas
roch nach Schwefel; kein Zweifel, das unheimliche Ding mußte teuflischen Ursprungs
sein. Heutzutage fürchtet sich kein Mensch mehr vor einem Luftballon, einem Flieger
oder einem Luftschiff an sich; sie sind keine ungewöhnliche Erscheinung mehr. Aber
die belgischen Flieger möchten vermutlich Furcht erregen und versuchen es mit einer
Bemalung, die Grausen erregen soll. Die Naturvölker bemalen, wenn sie gegen
einen Feind Ziehen, sich und ihre Waffen mit wilden Fratzen, damit ihr greuliches
AusseheK dem Gegner Schrecken einjagen soll. Bei ihresgleichen, die wie Kinder
jedem fremdartigen Eindruck unmittelbar unterliegen, ohne sich Rechenschaft darüber
geben zu können, ist das Mittel auch wirksam. Aber...
Max Emanuel von Vatern hält 1692 seinen Einzug in Brüssel als Statthalter
der spanischen Niederlande für König Karl II. (S. 130). — Von dem mächtigen
Weltreiche, das Kaiser Karl V. bis zum Jahre 1556 beherrscht hatte, waren gegen das
Ende des siebzehnten Jahrhunderts noch stattliche Reste unter spanischer Herrschaft
geblieben: Spanien, Belgien, Mailand, Neapel, Sizilien und ungeheure Gebiete
in Nord-, Mittel- und Südamerika. Aber Spaniens Macht ging immer entschiedener
abwärts. Unaufhörliche Kriege hatten die reichen Einkünfte der Kolonien aufgezehrt;
eine auf 8 Millionen zusammengeschmolzene Bevölkerung mußte eine Steuerlast von
280 Millionen Realen jährlich aufbringen. Der Adel war verarmt, und ein Volk von
Bettlern lebte ein schweres Dasein. Als nach dem Tode Philipps IV. der kränkliche
Karl II. den wankenden Thron bestieg, herrschte Ludwig XIV. in Frankreich; ihm
und seinen Ministern und Generalen war der schwache spanische Regent nicht ge-
wachsen. Kaum war Ludwigs Schwiegervater Philipp IV. gestorben, da beanspruchte
Frankreich einen Teil der Niederlande. Als man dies abschlug, brachen im Mai 1667
französische Truppen in Belgien ein, das damals allerdings nicht — neutral war.
Sofort vereinigte sich England mit Schweden und den Niederlanden, bedrohte
Frankreich nut Krieg, und Ludwig XIV. mußte sich ein Jahr später im Frieden zu
Aachen mit einer Reihe belgischer Festungen begnügen. Nachdem es Frankreich ge-
lungen war, den Niederländern alle Bundesgenossen wieder abspenstig zu machen,
fiel es 1672 wieder über ihr Land her. Diesmal unterstützten den jungen Prinzen
von Oranien, Wilhelm III., Spanien, Brandenburg, der deutsche Kaiser uud Däne-
mark; trotzdem blieb Ludwig siegreich. Der Friedensvertrag von Rijswijk brachte
das Herzogtuni Lothringen in französische Hände. Aber Ludwig XIV. wollte auch
Spaniens Erbschaft an sich reißen. Die
große Frage der spanischen Erbfolge
beschäftigte seit Jahren die europäischen
Mächte. Der letzte männliche Habs¬
burger der Madrider Linie, Karl II.,
war kinderlos und den: Tod nahe. Wenn
er die Augen schloß, ging eine Erbschaft
auf, wie die Welt noch wenige gesehen.
Die älteste Schwester König Karls II.,
Maria Theresia, war mit Ludwig XIV.
vermählt. Die Prinzessin hatte zwar vor
ihrer Heirat auf die Erbschaft in Spa¬
nien für sich und ihre Nachkommen ver¬
zichtet. Aber Ludwig erklärte den Ver¬
trag für ungültig. Auch Kaiser Leo¬
pold I. konnte geltend machen, daß er
der Sohn einer spanischen Prinzessin
sei und mit einer Schwester Karls II.,
der Prinzessin Margareta Theresia, sich
vermählt habe, deren Vater, König Phi¬
lipp IV., für den Fall des Aussterbens
des Mannesstammes die spanische Krone
dieser zweiten Tochter testamentarisch
vermacht habe. Das nächste Erbrecht fiel
nach der Kaiserin Margareta auf ihre ein¬
zige Tochter Maria Antonia, die mit dem
Kurfürsten Mar Emanuel von Bayern
vermählt war und ihm 1692 einen Sohn
gebar, Joseph Ferdinand, der also nach
dem Willen seines Urgroßvaters Philipp IV. das nächste Anrecht auf den spanischen
Thron besaß. Frankreich, Österreich und Bayern machten ihre Ansprüche darauf gel-
tend. Da wurde England unruhig, das wie zu allen Zeiten eifersüchtig das europäische
Gleichgewicht zu seinen Gunsten zu erhalten bestrebt war; weder Frankreich noch
Österreich durfte durch Machtzuwachs gestärkt werden. Britannien suchte also die
Erbschaft durch Teilung zu zersplittern. Der bayerische Kurprinz Mar Emanuel sollte
Spanien, Belgien und die amerikanischen Kolonien, Österreich das alte Reichslehen
Mailand, Frankreich das Königreich Neapel und Sizilien erhalten. England be-
handelte Spanien wie eine schon herrenlose Beute; aber nur drei Mächte, England,
Holland und Frankreich, unterzeichneten am 11. Oktober 1698 den Teilungsvertrag
im Haag. Den bayerischen Kurprinzen berücksichtigte man deshalb, weil er durch
Karl II. im Sinne der Nation zum Erben der Monarchie eingesetzt worden war
und seit 1692 als Statthalter der Niederlande in Brüssel Hof hielt. Zu ihm kam
eiue spanische Gesandtschaft, um seinen sechsjährigen Sohn Joseph Ferdinand als künf-
tigen König nach Madrid zu holeu. Seitdem wühlten die Mächte weiter. Karl II.
wandte sich an Papst Innozenz XII., der für Frankreich entschied, und der König setzte
durch ein Testament seinen Enkel Philipp von Anjou zum Erben des spanischen Gesamt-
reiches ein. Da erkrankte Mar Emanuels Sohn an den Pocken und starb im Februar
1699. Allgemein wurde gesagt, der Prinz sei vergiftet worden, und der Kurfürst selbst
erhob am Totenbett die schwärzesten Anschuldigungen. In diesen vergangenen Zeiten
schrieb ein Diplomat: „ Überall drängt sich der Teufel in Gestalt französischer Agenten
und englischen Goldes ein." Am 1. November 1700 starb der schwächliche, unentschie-
dene Karl II. Europa stand vorder Eröffnung des Spanischen Erbfolgekrieges. M. N.
lvinter in Afrika (S. 135). — Minter mit Schnee und Eis in Afrika, das
geht durchaus gegen die landläufige Vorstellung, die man sich von den Ländern der
heißen Zone macht. Aber Nordafrika gehört doch noch der gemäßigten Zone an:
mitten durch die Wüste Sahara geht der Wendekreis des Krebses, die Grenzlinie der
heißen Zone. Und Nordafrika durchziehen Gebirgsketten; die höchste Erhebung des
Hohen Atlas erreicht 4500 Meter. Das sind Höhen, in denen Kälte herrscht auch in
südlich gelegenen Gebieten. Wohl gibt es keine Gletscher im Atlasgebirge, aber die
höchsten Gipfel tragen den längsten Teil des Jahres hindurch Schnee. Und im Winter
deckt Schnee das Gebirge bis weit über die Baumgrenze herab. An den gegen die trocke-
nen Nordwestwinde geschützten Hängen beginnt der Wald in 1200 bis 1400 Meter Höhe;
sommergrüne Laubbäume, Eschen-, Erlen- und Eichenarten, die Nadelhölzer der wär-
meren Gebiete, Zedern, Pinsapotannen, ziehen sich in dichten Beständen über die nied-
rigerer: Bergkuppen. In 2400 bis 2700 Meter Höhe kriechen die letzten verkümmerten
knorrigen Eichen am Boden hin, Buschwerk, dann Wiesenmatten steigen an den Bergen
empor und verlieren sich schließlich im Felsgeröll. Wie ein Bild aus dem deutschen
Mittelgebirge muten die beschneiten Waldberge an mit den Skiläufern im weißen Ge-
lände — aber die Skiläufer tragen den Turban um das dunkle Haar geschlungen.
Es ist ein Bild aus dem afrikanischen Winter.
Lotsenübernahme in Norwegen (S. 139). — Schon in Friedenszeiten, wenn
die Schiffahrt ungestört ihre Wege zieht, ist der Beruf des Lotsen anstrengend, ver- -
antwortungsvoll und gefährlich wie kaum ein anderer. In dem Augenblick, wo der
Lotse das Deck des nach ihm verlangenden Schiffes betritt, führt er über alle see-
männischen Maßnahmen den Oberbefehl, und Kapitän, Steuermann und Mann-
schaften haben allein nur uoch seinen Anordnungen zu folgen. Die Stellung des
Lotsen ist gesetzlich international geregelt, die Art seiner Tätigkeit aber richtet sich
naturgemäß nach örtlichen Verhältnissen. So erstreckt sich der Führerbereich der
deutschen Lotsen an der Elbe- und den anderen Flußmündungen der Nordsee weit
in die offene See hinaus. Die Lotsendampfer, die ihre Piloten an die nach deutschen
Plätzen fahrenden Schiffe abgeben, kreuzen bis Terschelling vor der holländischen
Küste. Die Lotsen werden auf große::, seefesten Schiffen „versetzt", die sich oft
tage- und wochenlang in: Sturm der Nordsee aufhalten. Anders sind die Aufgaben
der norwegischen Lotsen, die an der von engen Fjorden zerklüfteten Küste fast immer
innerhalb der Landgewässer bleiben und nur selten auf hohe See fahren. Man findet
hier nur ganz vereinzelt größere Lotsendampfer. Tie Lotsen segeln meist in kleinen,
offenen Booten dem Einfahrt suchenden
Schiff entgegen. Die Stationen liegen
an den Eingängen der Fjorde, und
das gesetzte Flaggensignal genügt, um
den gewünschten Piloten heranzurufen.
Größere Schiffe nehmen mit ihren Kra-
nen den Lotsen samt dem Boot an Deck.
Sind die Fjorde auch meist sehr tief, so :
ist das Fahrwasser doch häufig eng und '
mit gefährlichen Klippen und Stromver-
setzungen durchzogen, so daß genaueste ,
Ortskeuntuis nötig ist, um große Fahr-
zeuge ohne Schaden landeinwärts zu
briugen. Alle nordischen Lotsen führen,
um als solche kenntlich zu sein, in ihren:
Segel eine braungefärbte Bahn und
außerdem uoch die nationale Kriegs-
flagge. Auf der Kommandobrücke 'ange-
langt, begrüßt der Lotse den Führer des
Schiffes, der ihn: Tiefgang und Ge-
schwindigkeit seines Fahrzeuges meldet.
Daun läßt er den Maschinentelegraphen
spielen und gibt die Ruderkommandos, >
und wenn sein Machtbereich abgefahren
und für die weitere Fahrt der neue Lotse
an Bord ist, wird er auf die selbe Weise
zu Wasser gebracht, auf die er wenige
Stunden vorher an Deck gekommen ist.
— Gute Reise! ' G. M.
Unser neuer Mman
„Der Mütter Sünden
von Friedrich Jacobsen
spielt in Friesland. Die Schicksale eines alteingesessenen,
ahnenstolzen Bauerngeschlechtes vollziehen sich mit er-
schütternder Naturnotwendigkeit und lasten auch noch auf
den Kindern mit verhängnisvoller Schwere. Dunkle
Fragen tauchen auf und finden durch Leben und Leiden
ihre rätselhaften Antworten. Es ist, als stünde über
allem das alte harte Wort: „Ich will ihre Sünden Heim-
suchen bis ins dritte und vierte Glied". Nur sind
es nicht göttliche Strafgerichte, sondern
Sünden an der Natur begangen, die
zu rächenden Gewalten an
Menschen werden.
MW
SÜ. WsvenMlüevrr
WWWWW
1- Fahndung nach Fahnenflüchtigen in Paris (S. 123). — Schon lange ist
Frankreich kriegsmüde. Nicht nur das Volk, das in seiner leichteren Lebensart die
Entbehrungen und Lasten des Krieges schwerer und ungeduldiger trägt als der
zähere uud ernstere Deutsche, auch das Heer, entmutigt durch Misterfolge und Ein-
buße ungeheuren Menschenmaterials, sehnt immer dringlicher das Ende des Krieges
herbei, wenn auch die französische Presse fortgesetzt das Gegenteil behauptet uud
Kampfeseifer und Siegeswillen der Truppen rühmt. Oft genug haben aber manche
dieser Kämpfer das Gegenteil bewiesen und bei passender Gelegenheit ihrer Truppe
den Rücken gewandt, denn die Zeitungen wissen immer wieder Geschichten zu erzählen
von solchen, denen die Flucht gelang und die sich dann, wie Einsiedler hausend, in den
Bergen aufhielten oder in den Kronen der Bäume versteckten, um jedem Blick ver-
borgen zu sein, und nur uachts ihre Wohnstätte verließen. In den meisten Fällen unter-
liegen jedoch Urlauber der Versuchung, die auf kurze Zeit gewährte Freiheit auf für
immer auszudehnen. Paris, das Paradies des vergnügungssüchtigen Franzosen, fesselt
ihn und läßt den Leichtsinnigen zum Fahnenflüchtigen werden. In bürgerlichen Klei-
dern glaubt er sich in der Riesenstadt geborgen, aber die Polizei, die ständig nach Fah-
nenslüchtigen fahndet, spürt die Gesuchten doch auf, auch wenn sich diese in den
Kaffeehäusern des dunkeln und dunkelsten Paris noch so sicher fühlten.
IZ Kriegsbemalung eines belgischen Flugzeugs (S. 128). — Gegen das Ende
des achtzehnten Jahrhunderts erfanden die Brüder Montgolfier den Luftballon.
Der kugelrunde Ballon, der mit Wasserstoffgas gefüllt war, stieg in zwei Minuten
ungefähr tausend Meter hoch und verschwand in einer Wolke. Nach drei Viertel-
stunden fiel er vierundzwanzig Kilometer von dem Orte des Aufstiegs eutfernt wieder
zur Erde nieder. Landleute, die eben in der Nähe waren, wagten sich zögernd an
das aus den Wolken gefallene Ungetüm heran. Das ausströmende Wasserstoffgas
roch nach Schwefel; kein Zweifel, das unheimliche Ding mußte teuflischen Ursprungs
sein. Heutzutage fürchtet sich kein Mensch mehr vor einem Luftballon, einem Flieger
oder einem Luftschiff an sich; sie sind keine ungewöhnliche Erscheinung mehr. Aber
die belgischen Flieger möchten vermutlich Furcht erregen und versuchen es mit einer
Bemalung, die Grausen erregen soll. Die Naturvölker bemalen, wenn sie gegen
einen Feind Ziehen, sich und ihre Waffen mit wilden Fratzen, damit ihr greuliches
AusseheK dem Gegner Schrecken einjagen soll. Bei ihresgleichen, die wie Kinder
jedem fremdartigen Eindruck unmittelbar unterliegen, ohne sich Rechenschaft darüber
geben zu können, ist das Mittel auch wirksam. Aber...
Max Emanuel von Vatern hält 1692 seinen Einzug in Brüssel als Statthalter
der spanischen Niederlande für König Karl II. (S. 130). — Von dem mächtigen
Weltreiche, das Kaiser Karl V. bis zum Jahre 1556 beherrscht hatte, waren gegen das
Ende des siebzehnten Jahrhunderts noch stattliche Reste unter spanischer Herrschaft
geblieben: Spanien, Belgien, Mailand, Neapel, Sizilien und ungeheure Gebiete
in Nord-, Mittel- und Südamerika. Aber Spaniens Macht ging immer entschiedener
abwärts. Unaufhörliche Kriege hatten die reichen Einkünfte der Kolonien aufgezehrt;
eine auf 8 Millionen zusammengeschmolzene Bevölkerung mußte eine Steuerlast von
280 Millionen Realen jährlich aufbringen. Der Adel war verarmt, und ein Volk von
Bettlern lebte ein schweres Dasein. Als nach dem Tode Philipps IV. der kränkliche
Karl II. den wankenden Thron bestieg, herrschte Ludwig XIV. in Frankreich; ihm
und seinen Ministern und Generalen war der schwache spanische Regent nicht ge-
wachsen. Kaum war Ludwigs Schwiegervater Philipp IV. gestorben, da beanspruchte
Frankreich einen Teil der Niederlande. Als man dies abschlug, brachen im Mai 1667
französische Truppen in Belgien ein, das damals allerdings nicht — neutral war.
Sofort vereinigte sich England mit Schweden und den Niederlanden, bedrohte
Frankreich nut Krieg, und Ludwig XIV. mußte sich ein Jahr später im Frieden zu
Aachen mit einer Reihe belgischer Festungen begnügen. Nachdem es Frankreich ge-
lungen war, den Niederländern alle Bundesgenossen wieder abspenstig zu machen,
fiel es 1672 wieder über ihr Land her. Diesmal unterstützten den jungen Prinzen
von Oranien, Wilhelm III., Spanien, Brandenburg, der deutsche Kaiser uud Däne-
mark; trotzdem blieb Ludwig siegreich. Der Friedensvertrag von Rijswijk brachte
das Herzogtuni Lothringen in französische Hände. Aber Ludwig XIV. wollte auch
Spaniens Erbschaft an sich reißen. Die
große Frage der spanischen Erbfolge
beschäftigte seit Jahren die europäischen
Mächte. Der letzte männliche Habs¬
burger der Madrider Linie, Karl II.,
war kinderlos und den: Tod nahe. Wenn
er die Augen schloß, ging eine Erbschaft
auf, wie die Welt noch wenige gesehen.
Die älteste Schwester König Karls II.,
Maria Theresia, war mit Ludwig XIV.
vermählt. Die Prinzessin hatte zwar vor
ihrer Heirat auf die Erbschaft in Spa¬
nien für sich und ihre Nachkommen ver¬
zichtet. Aber Ludwig erklärte den Ver¬
trag für ungültig. Auch Kaiser Leo¬
pold I. konnte geltend machen, daß er
der Sohn einer spanischen Prinzessin
sei und mit einer Schwester Karls II.,
der Prinzessin Margareta Theresia, sich
vermählt habe, deren Vater, König Phi¬
lipp IV., für den Fall des Aussterbens
des Mannesstammes die spanische Krone
dieser zweiten Tochter testamentarisch
vermacht habe. Das nächste Erbrecht fiel
nach der Kaiserin Margareta auf ihre ein¬
zige Tochter Maria Antonia, die mit dem
Kurfürsten Mar Emanuel von Bayern
vermählt war und ihm 1692 einen Sohn
gebar, Joseph Ferdinand, der also nach
dem Willen seines Urgroßvaters Philipp IV. das nächste Anrecht auf den spanischen
Thron besaß. Frankreich, Österreich und Bayern machten ihre Ansprüche darauf gel-
tend. Da wurde England unruhig, das wie zu allen Zeiten eifersüchtig das europäische
Gleichgewicht zu seinen Gunsten zu erhalten bestrebt war; weder Frankreich noch
Österreich durfte durch Machtzuwachs gestärkt werden. Britannien suchte also die
Erbschaft durch Teilung zu zersplittern. Der bayerische Kurprinz Mar Emanuel sollte
Spanien, Belgien und die amerikanischen Kolonien, Österreich das alte Reichslehen
Mailand, Frankreich das Königreich Neapel und Sizilien erhalten. England be-
handelte Spanien wie eine schon herrenlose Beute; aber nur drei Mächte, England,
Holland und Frankreich, unterzeichneten am 11. Oktober 1698 den Teilungsvertrag
im Haag. Den bayerischen Kurprinzen berücksichtigte man deshalb, weil er durch
Karl II. im Sinne der Nation zum Erben der Monarchie eingesetzt worden war
und seit 1692 als Statthalter der Niederlande in Brüssel Hof hielt. Zu ihm kam
eiue spanische Gesandtschaft, um seinen sechsjährigen Sohn Joseph Ferdinand als künf-
tigen König nach Madrid zu holeu. Seitdem wühlten die Mächte weiter. Karl II.
wandte sich an Papst Innozenz XII., der für Frankreich entschied, und der König setzte
durch ein Testament seinen Enkel Philipp von Anjou zum Erben des spanischen Gesamt-
reiches ein. Da erkrankte Mar Emanuels Sohn an den Pocken und starb im Februar
1699. Allgemein wurde gesagt, der Prinz sei vergiftet worden, und der Kurfürst selbst
erhob am Totenbett die schwärzesten Anschuldigungen. In diesen vergangenen Zeiten
schrieb ein Diplomat: „ Überall drängt sich der Teufel in Gestalt französischer Agenten
und englischen Goldes ein." Am 1. November 1700 starb der schwächliche, unentschie-
dene Karl II. Europa stand vorder Eröffnung des Spanischen Erbfolgekrieges. M. N.
lvinter in Afrika (S. 135). — Minter mit Schnee und Eis in Afrika, das
geht durchaus gegen die landläufige Vorstellung, die man sich von den Ländern der
heißen Zone macht. Aber Nordafrika gehört doch noch der gemäßigten Zone an:
mitten durch die Wüste Sahara geht der Wendekreis des Krebses, die Grenzlinie der
heißen Zone. Und Nordafrika durchziehen Gebirgsketten; die höchste Erhebung des
Hohen Atlas erreicht 4500 Meter. Das sind Höhen, in denen Kälte herrscht auch in
südlich gelegenen Gebieten. Wohl gibt es keine Gletscher im Atlasgebirge, aber die
höchsten Gipfel tragen den längsten Teil des Jahres hindurch Schnee. Und im Winter
deckt Schnee das Gebirge bis weit über die Baumgrenze herab. An den gegen die trocke-
nen Nordwestwinde geschützten Hängen beginnt der Wald in 1200 bis 1400 Meter Höhe;
sommergrüne Laubbäume, Eschen-, Erlen- und Eichenarten, die Nadelhölzer der wär-
meren Gebiete, Zedern, Pinsapotannen, ziehen sich in dichten Beständen über die nied-
rigerer: Bergkuppen. In 2400 bis 2700 Meter Höhe kriechen die letzten verkümmerten
knorrigen Eichen am Boden hin, Buschwerk, dann Wiesenmatten steigen an den Bergen
empor und verlieren sich schließlich im Felsgeröll. Wie ein Bild aus dem deutschen
Mittelgebirge muten die beschneiten Waldberge an mit den Skiläufern im weißen Ge-
lände — aber die Skiläufer tragen den Turban um das dunkle Haar geschlungen.
Es ist ein Bild aus dem afrikanischen Winter.
Lotsenübernahme in Norwegen (S. 139). — Schon in Friedenszeiten, wenn
die Schiffahrt ungestört ihre Wege zieht, ist der Beruf des Lotsen anstrengend, ver- -
antwortungsvoll und gefährlich wie kaum ein anderer. In dem Augenblick, wo der
Lotse das Deck des nach ihm verlangenden Schiffes betritt, führt er über alle see-
männischen Maßnahmen den Oberbefehl, und Kapitän, Steuermann und Mann-
schaften haben allein nur uoch seinen Anordnungen zu folgen. Die Stellung des
Lotsen ist gesetzlich international geregelt, die Art seiner Tätigkeit aber richtet sich
naturgemäß nach örtlichen Verhältnissen. So erstreckt sich der Führerbereich der
deutschen Lotsen an der Elbe- und den anderen Flußmündungen der Nordsee weit
in die offene See hinaus. Die Lotsendampfer, die ihre Piloten an die nach deutschen
Plätzen fahrenden Schiffe abgeben, kreuzen bis Terschelling vor der holländischen
Küste. Die Lotsen werden auf große::, seefesten Schiffen „versetzt", die sich oft
tage- und wochenlang in: Sturm der Nordsee aufhalten. Anders sind die Aufgaben
der norwegischen Lotsen, die an der von engen Fjorden zerklüfteten Küste fast immer
innerhalb der Landgewässer bleiben und nur selten auf hohe See fahren. Man findet
hier nur ganz vereinzelt größere Lotsendampfer. Tie Lotsen segeln meist in kleinen,
offenen Booten dem Einfahrt suchenden
Schiff entgegen. Die Stationen liegen
an den Eingängen der Fjorde, und
das gesetzte Flaggensignal genügt, um
den gewünschten Piloten heranzurufen.
Größere Schiffe nehmen mit ihren Kra-
nen den Lotsen samt dem Boot an Deck.
Sind die Fjorde auch meist sehr tief, so :
ist das Fahrwasser doch häufig eng und '
mit gefährlichen Klippen und Stromver-
setzungen durchzogen, so daß genaueste ,
Ortskeuntuis nötig ist, um große Fahr-
zeuge ohne Schaden landeinwärts zu
briugen. Alle nordischen Lotsen führen,
um als solche kenntlich zu sein, in ihren:
Segel eine braungefärbte Bahn und
außerdem uoch die nationale Kriegs-
flagge. Auf der Kommandobrücke 'ange-
langt, begrüßt der Lotse den Führer des
Schiffes, der ihn: Tiefgang und Ge-
schwindigkeit seines Fahrzeuges meldet.
Daun läßt er den Maschinentelegraphen
spielen und gibt die Ruderkommandos, >
und wenn sein Machtbereich abgefahren
und für die weitere Fahrt der neue Lotse
an Bord ist, wird er auf die selbe Weise
zu Wasser gebracht, auf die er wenige
Stunden vorher an Deck gekommen ist.
— Gute Reise! ' G. M.
Unser neuer Mman
„Der Mütter Sünden
von Friedrich Jacobsen
spielt in Friesland. Die Schicksale eines alteingesessenen,
ahnenstolzen Bauerngeschlechtes vollziehen sich mit er-
schütternder Naturnotwendigkeit und lasten auch noch auf
den Kindern mit verhängnisvoller Schwere. Dunkle
Fragen tauchen auf und finden durch Leben und Leiden
ihre rätselhaften Antworten. Es ist, als stünde über
allem das alte harte Wort: „Ich will ihre Sünden Heim-
suchen bis ins dritte und vierte Glied". Nur sind
es nicht göttliche Strafgerichte, sondern
Sünden an der Natur begangen, die
zu rächenden Gewalten an
Menschen werden.