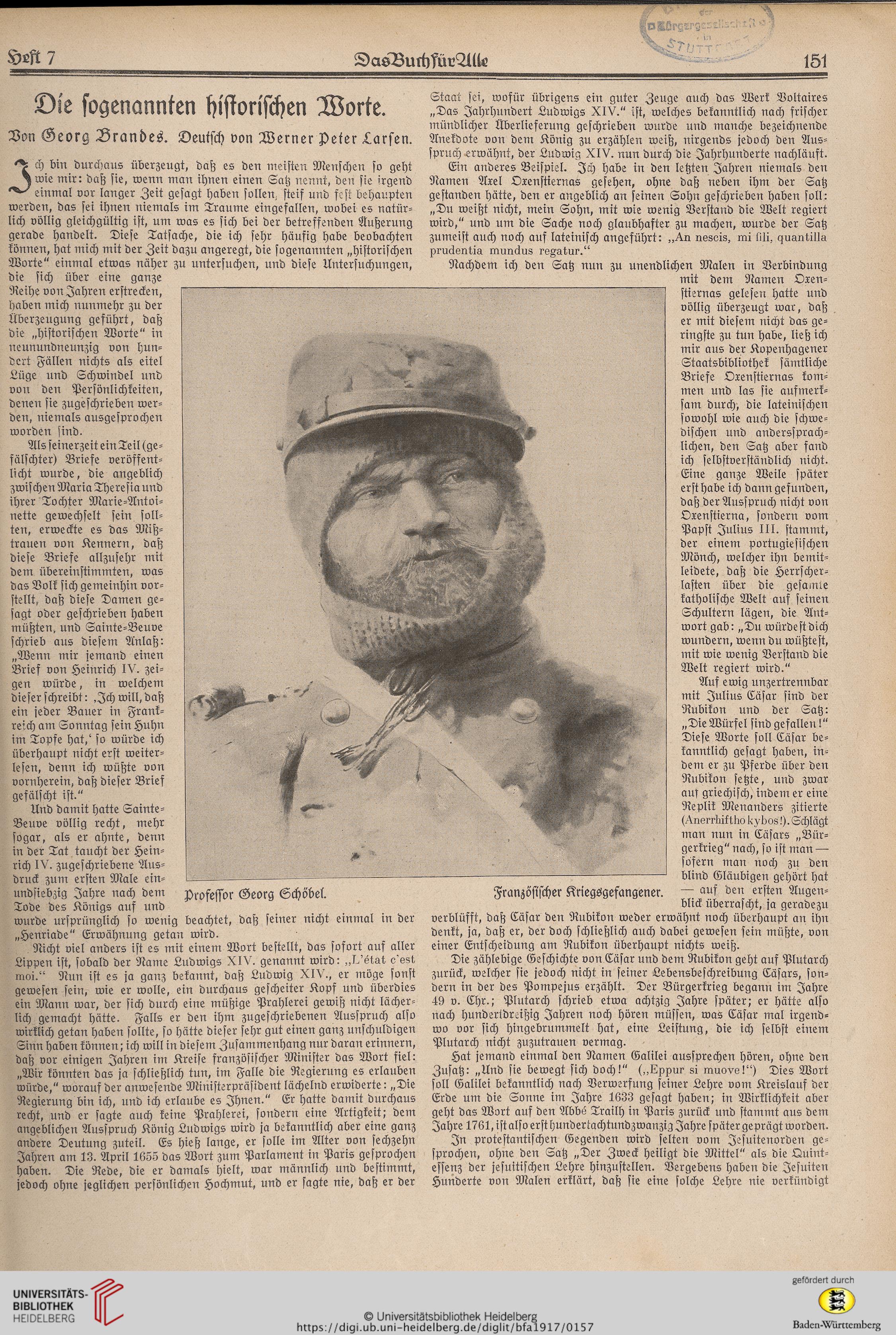Heft 7
NasBuchsürAtte
151
Die sogenannten historischen Worte.
Von Georg Brandes. Deutsch von Werner Peter Marsen.
ch bin durchaus überzeugt, daß es den meisten Menschen so geht
Wie mir: daß sie, wenn man ihnen einen Satz nennt, den sie irgend
einmal vor langer Zeit gesagt haben sollen, steif und fest behaupten
werden, das sei ihnen niemals im Traume eingefallen, wobei es natür-
lich völlig gleichgültig ist, um was es sich bei der betreffenden Äußerung
gerade handelt. Diese Tatsache, die ich sehr häufig habe beobachten
tonnen, hat mich mit der Zeit dazu angeregt, die sogenannten „historischen
Worte" einmal etwas näher zu untersuchen, und diese Untersuchungen,
die sich über eine ganze
Reihe von Jahren erstrecken,
haben mich nunmehr zu der
Überzeugung geführt, daß
die „historischen Worte" in
neunundneunzig von hun¬
dert Fällen nichts als eitel
Lüge und Schwindel und
von den Persönlichkeiten,
denen sie zugeschrieben wer¬
den, niemals ausgesprochen
worden sind.
Als seinerzeit ein Teil (ge¬
fälschter) Briefe veröffent¬
licht wurde, die angeblich
zwischen Maria Theresia und
ihrer Tochter Marie-Antoi-
nette gewechselt sein soll¬
ten, erweckte es das Mi߬
trauen von Kennern, daß
diese Briefe allzusehr mit
dem übereinstimmten, was
das Volk sich gemeinhin vor¬
stellt, daß diese Damen ge¬
sagt oder geschrieben haben
müßten, und Sainte-Beuve
schrieb aus diesem Anlaß:
„Wenn mir jemand einen
Brief von Heinrich IV. zei¬
gen würde, in welchem
dieser schreibt: ,Jch will, daß
ein jeder Bauer in Frank¬
reich am Sonntag sein Huhn
im Topfe hat/ so würde ich
überhaupt nicht erst weiter¬
lesen, denn ich wüßte von
vornherein, daß dieser Brief
gefälscht ist."
Und damit hatte Sainte-
Beuve völlig recht, mehr
sogar, als er ahnte, denn
in der Tat taucht der Hein¬
rich IV. zugeschriebene Aus¬
druck zum ersten Male ein¬
undsiebzig Jahre nach dem
Tode des Königs auf und
wurde ursprünglich so wenig beachtet, daß seiner nicht einmal in der
„Henriade" Erwähnung getan wird.
Nicht viel anders ist es mit einem Wort bestellt, das sofort auf aller
Lippen ist, sobald der Name Ludwigs XIV. genannt wird: „ILetat 6 sst
moi." Nun ist es ja ganz bekannt, daß Ludwig XIV., er möge sonst
gewesen sein, wie er wolle, ein durchaus gescheiter Kopf und überdies
ein Mann war, der sich durch eine müßige Prahlerei gewiß nicht lächer-
lich gemacht hätte. Falls er den ihm zugeschriebenen Ausspruch also
wirklich getan haben sollte, so hätte dieser sehr gut einen ganz unschuldigen
Sinn haben können; ich will in diesem Zusammenhang nur daran erinnern,
daß vor einigen Jahren im Kreise französischer Minister das Wort fiel:
„Wir könnten das ja schließlich tun, im Falle die Regierung es erlauben
würde," worauf der anwesende Ministerpräsident lächelnd erwiderte: „Die
Regierung bin ich, und ich erlaube es Ihnen." Er hatte damit durchaus
recht, und er sagte auch keine Prahlerei, sondern eine Artigkeit; dem
angeblichen Ausspruch König Ludwigs wird ja bekanntlich aber eine ganz
andere Deutung zuteil. Es hieß lange, er solle im Alter von sechzehn
Jahren am 13. April 1655 das Wort zum Parlament in Paris gesprochen
haben. Die Rede, die er damals hielt, war männlich und bestimmt,
jedoch ohne jeglichen persönlichen Hochmut, und er sagte nie, daß er der
Staat sei, wofür übrigens ein guter Zeuge auch das Werk Voltaires
„Das Jahrhundert Ludwigs XIV." ist, welches bekanntlich nach frischer
mündlicher Überlieferung geschrieben wurde und manche bezeichnende
Anekdote von dem König zu erzählen weiß, nirgends jedoch den Aus-
spruch erwähnt, der Ludwig XIV. nun durch die Jahrhunderte nachläuft.
Ein arideres Beispiel. Ich habe in den letzten Jahren niemals den
Namen Arel Orenstiernas gesehen, ohne daß neben ihm der Satz
gestanden hätte, den er angeblich an seinen Sohn geschrieben haben soll:
„Du weißt nicht, mein Sohn, mit wie wenig Verstand die Welt regiert
wird," und um die Sache noch glaubhafter zu machen, wurde der Satz
zumeist auch noch auf lateinisch angeführt: „Vn U686i8, mi till, guautilla
pruäsntia muncku8 ro^ainr."
Nachdem ich den Satz nun zu unendlichen Malen in Verbindung
mit dem Namen Oren-
stiernas gelesen hatte und
völlig überzeugt war, daß
er mit diesem nicht das ge-
ringste zu tun habe, ließ ich
mir aus der Kopenhagener
Staatsbibliothek sämtliche
Briefe Orenstiernas kom-
men und las sie aufmerk-
sam durch, die lateinischen
sowohl wie auch die schwe-
dischen und anderssprach-
lichen, den Satz aber fand
ich selbstverständlich nicht.
Eine ganze Weile später
erst habe ich dann gefunden,
daß der Ausspruch nicht von
Orenstierna, sondern vom
Papst Julius III. stammt,
der einem portugiesischen
Mönch, welcher ihn bemit-
leidete, daß die Herrscher-
lasten über die gesamie
katholische Welt auf seinen
Schultern lägen, die Ant-
wort gab: „Du würde st dich
wundern, wenn du wüßtest,
mit wie wenig Verstand die
Welt regiert wird."
Auf ewig unzertrennbar
mit Julius Cäsar sind der
Rubikon und der Satz:
„Die Würfel sind gefallen!"
Diese Worte soll Cäsar be-
kanntlich gesagt haben, in-
dem er zu Pferde über den
Rubikon setzte, und zwar
auf griechisch, indem er eine
Replik Menanders zitierte
(Xrwrrlüktbo kvbos!). Schlägt
man nun in Cäsars „Bür-
gerkrieg" nach, so ist man —
sofern man noch zu den
blind Gläubigen gehört hat
— auf den ersten Augen-
blick überrascht, ja geradezu
verblüfft, daß Cäsar den Rubikon weder erwähnt noch überhaupt an ihn
denkt, ja, daß er, der doch schließlich auch dabei gewesen sein müßte, von
einer Entscheidung am Rubikon überhaupt nichts weiß.
Die zählebige Geschichte von Cäsar und dem Rubikon geht auf Plutarch
zurück, welcher sie jedoch nicht in seiner Lebensbeschreibung Cäsars, son-
dern in der des Pompejus erzählt. Der Bürgerkrieg begann im Jahre
49 v. Chr.; Plutarch schrieb etwa achtzig Jahre später; er hätte also
nach hundertdreißig Jahren noch hören müssen, was Cäsar mal irgend-
wo vor sich hingebrummelt hat, eine Leistung, die ich selbst einem
Plutarch nicht zuzutrauen vermag.
Hat jemand einmal den Namen Galilei aussprechen hören, ohne den
Zusatz: „Und sie bewegt sich doch!" („blppur 8i muovs!") Dies Wort
soll Galilei bekanntlich nach Verwerfung seiner Lehre vom Kreislauf der
Erde um die Sonne im Jahre 1633 gesagt haben; in Wirklichkeit aber
geht das Wort auf den Abbs Trailh in Paris zurück und stammt aus dem
Jahre 1761, ist also erst hundertachtundzwanzig Jahre später geprägt worden.
In protestantischen Gegenden wird selten vom Jesuitenorden ge-
sprochen, ohne den Satz „Der Zweck heiligt die Mittel" als die Quint-
essenz der jesuitischen Lehre hinzustellen. Vergebens haben die Jesuiten
Hunderte von Malen erklärt, daß sie eine solche Lehre nie verkündigt
Professor Georg Schöbel. Französischer Kriegsgefangener.
NasBuchsürAtte
151
Die sogenannten historischen Worte.
Von Georg Brandes. Deutsch von Werner Peter Marsen.
ch bin durchaus überzeugt, daß es den meisten Menschen so geht
Wie mir: daß sie, wenn man ihnen einen Satz nennt, den sie irgend
einmal vor langer Zeit gesagt haben sollen, steif und fest behaupten
werden, das sei ihnen niemals im Traume eingefallen, wobei es natür-
lich völlig gleichgültig ist, um was es sich bei der betreffenden Äußerung
gerade handelt. Diese Tatsache, die ich sehr häufig habe beobachten
tonnen, hat mich mit der Zeit dazu angeregt, die sogenannten „historischen
Worte" einmal etwas näher zu untersuchen, und diese Untersuchungen,
die sich über eine ganze
Reihe von Jahren erstrecken,
haben mich nunmehr zu der
Überzeugung geführt, daß
die „historischen Worte" in
neunundneunzig von hun¬
dert Fällen nichts als eitel
Lüge und Schwindel und
von den Persönlichkeiten,
denen sie zugeschrieben wer¬
den, niemals ausgesprochen
worden sind.
Als seinerzeit ein Teil (ge¬
fälschter) Briefe veröffent¬
licht wurde, die angeblich
zwischen Maria Theresia und
ihrer Tochter Marie-Antoi-
nette gewechselt sein soll¬
ten, erweckte es das Mi߬
trauen von Kennern, daß
diese Briefe allzusehr mit
dem übereinstimmten, was
das Volk sich gemeinhin vor¬
stellt, daß diese Damen ge¬
sagt oder geschrieben haben
müßten, und Sainte-Beuve
schrieb aus diesem Anlaß:
„Wenn mir jemand einen
Brief von Heinrich IV. zei¬
gen würde, in welchem
dieser schreibt: ,Jch will, daß
ein jeder Bauer in Frank¬
reich am Sonntag sein Huhn
im Topfe hat/ so würde ich
überhaupt nicht erst weiter¬
lesen, denn ich wüßte von
vornherein, daß dieser Brief
gefälscht ist."
Und damit hatte Sainte-
Beuve völlig recht, mehr
sogar, als er ahnte, denn
in der Tat taucht der Hein¬
rich IV. zugeschriebene Aus¬
druck zum ersten Male ein¬
undsiebzig Jahre nach dem
Tode des Königs auf und
wurde ursprünglich so wenig beachtet, daß seiner nicht einmal in der
„Henriade" Erwähnung getan wird.
Nicht viel anders ist es mit einem Wort bestellt, das sofort auf aller
Lippen ist, sobald der Name Ludwigs XIV. genannt wird: „ILetat 6 sst
moi." Nun ist es ja ganz bekannt, daß Ludwig XIV., er möge sonst
gewesen sein, wie er wolle, ein durchaus gescheiter Kopf und überdies
ein Mann war, der sich durch eine müßige Prahlerei gewiß nicht lächer-
lich gemacht hätte. Falls er den ihm zugeschriebenen Ausspruch also
wirklich getan haben sollte, so hätte dieser sehr gut einen ganz unschuldigen
Sinn haben können; ich will in diesem Zusammenhang nur daran erinnern,
daß vor einigen Jahren im Kreise französischer Minister das Wort fiel:
„Wir könnten das ja schließlich tun, im Falle die Regierung es erlauben
würde," worauf der anwesende Ministerpräsident lächelnd erwiderte: „Die
Regierung bin ich, und ich erlaube es Ihnen." Er hatte damit durchaus
recht, und er sagte auch keine Prahlerei, sondern eine Artigkeit; dem
angeblichen Ausspruch König Ludwigs wird ja bekanntlich aber eine ganz
andere Deutung zuteil. Es hieß lange, er solle im Alter von sechzehn
Jahren am 13. April 1655 das Wort zum Parlament in Paris gesprochen
haben. Die Rede, die er damals hielt, war männlich und bestimmt,
jedoch ohne jeglichen persönlichen Hochmut, und er sagte nie, daß er der
Staat sei, wofür übrigens ein guter Zeuge auch das Werk Voltaires
„Das Jahrhundert Ludwigs XIV." ist, welches bekanntlich nach frischer
mündlicher Überlieferung geschrieben wurde und manche bezeichnende
Anekdote von dem König zu erzählen weiß, nirgends jedoch den Aus-
spruch erwähnt, der Ludwig XIV. nun durch die Jahrhunderte nachläuft.
Ein arideres Beispiel. Ich habe in den letzten Jahren niemals den
Namen Arel Orenstiernas gesehen, ohne daß neben ihm der Satz
gestanden hätte, den er angeblich an seinen Sohn geschrieben haben soll:
„Du weißt nicht, mein Sohn, mit wie wenig Verstand die Welt regiert
wird," und um die Sache noch glaubhafter zu machen, wurde der Satz
zumeist auch noch auf lateinisch angeführt: „Vn U686i8, mi till, guautilla
pruäsntia muncku8 ro^ainr."
Nachdem ich den Satz nun zu unendlichen Malen in Verbindung
mit dem Namen Oren-
stiernas gelesen hatte und
völlig überzeugt war, daß
er mit diesem nicht das ge-
ringste zu tun habe, ließ ich
mir aus der Kopenhagener
Staatsbibliothek sämtliche
Briefe Orenstiernas kom-
men und las sie aufmerk-
sam durch, die lateinischen
sowohl wie auch die schwe-
dischen und anderssprach-
lichen, den Satz aber fand
ich selbstverständlich nicht.
Eine ganze Weile später
erst habe ich dann gefunden,
daß der Ausspruch nicht von
Orenstierna, sondern vom
Papst Julius III. stammt,
der einem portugiesischen
Mönch, welcher ihn bemit-
leidete, daß die Herrscher-
lasten über die gesamie
katholische Welt auf seinen
Schultern lägen, die Ant-
wort gab: „Du würde st dich
wundern, wenn du wüßtest,
mit wie wenig Verstand die
Welt regiert wird."
Auf ewig unzertrennbar
mit Julius Cäsar sind der
Rubikon und der Satz:
„Die Würfel sind gefallen!"
Diese Worte soll Cäsar be-
kanntlich gesagt haben, in-
dem er zu Pferde über den
Rubikon setzte, und zwar
auf griechisch, indem er eine
Replik Menanders zitierte
(Xrwrrlüktbo kvbos!). Schlägt
man nun in Cäsars „Bür-
gerkrieg" nach, so ist man —
sofern man noch zu den
blind Gläubigen gehört hat
— auf den ersten Augen-
blick überrascht, ja geradezu
verblüfft, daß Cäsar den Rubikon weder erwähnt noch überhaupt an ihn
denkt, ja, daß er, der doch schließlich auch dabei gewesen sein müßte, von
einer Entscheidung am Rubikon überhaupt nichts weiß.
Die zählebige Geschichte von Cäsar und dem Rubikon geht auf Plutarch
zurück, welcher sie jedoch nicht in seiner Lebensbeschreibung Cäsars, son-
dern in der des Pompejus erzählt. Der Bürgerkrieg begann im Jahre
49 v. Chr.; Plutarch schrieb etwa achtzig Jahre später; er hätte also
nach hundertdreißig Jahren noch hören müssen, was Cäsar mal irgend-
wo vor sich hingebrummelt hat, eine Leistung, die ich selbst einem
Plutarch nicht zuzutrauen vermag.
Hat jemand einmal den Namen Galilei aussprechen hören, ohne den
Zusatz: „Und sie bewegt sich doch!" („blppur 8i muovs!") Dies Wort
soll Galilei bekanntlich nach Verwerfung seiner Lehre vom Kreislauf der
Erde um die Sonne im Jahre 1633 gesagt haben; in Wirklichkeit aber
geht das Wort auf den Abbs Trailh in Paris zurück und stammt aus dem
Jahre 1761, ist also erst hundertachtundzwanzig Jahre später geprägt worden.
In protestantischen Gegenden wird selten vom Jesuitenorden ge-
sprochen, ohne den Satz „Der Zweck heiligt die Mittel" als die Quint-
essenz der jesuitischen Lehre hinzustellen. Vergebens haben die Jesuiten
Hunderte von Malen erklärt, daß sie eine solche Lehre nie verkündigt
Professor Georg Schöbel. Französischer Kriegsgefangener.