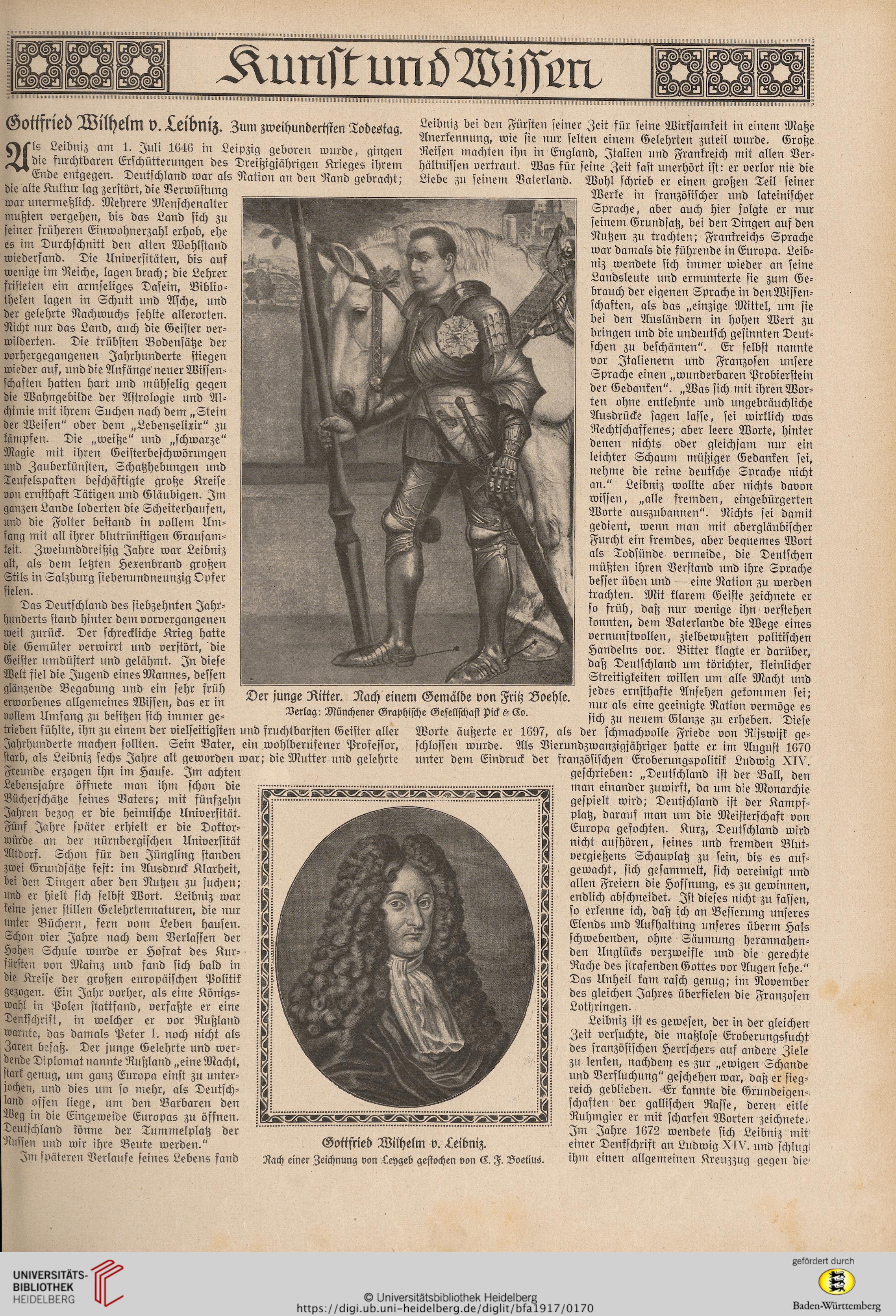8
8
LVmst und Dissen
... ?
Gottfried Wilhelm v. Leibniz. Zum zweihundert«» Todestag.
ls Leibniz am 1. Juli 1646 in Leipzig geboren wurde, gingen
die furchtbaren Erschütterungen des Dreißigjährigen Krieges ihrem
Ende entgegen. Deutschland war als Nation an den Rand gebracht;
die alte Kultur lag zerstört, die Verwüstung
war unermeßlich. Mehrere Menschenalter
mußten vergehen, bis das Land sich zu
seiner früheren Einwohnerzahl erhob, ehe
es im Durchschnitt den alten Wohlstand
wiederfand. Die Universitäten, bis auf
wenige im Reiche, lagen brach; die Lehrer
fristeten ein armseliges Dasein, Biblio¬
theken lagen in Schutt und Asche, und
der gelehrte Nachwuchs fehlte allerorten.
Nicht nur das Land, auch die Geister ver¬
wilderten. Die trübsten Bodensätze der
vorhergegangenen Jahrhunderte stiegen
wieder auf, und die Anfänge neuer Wissen¬
schaften hatten hart und mühselig gegen
die Wahngebilde der Astrologie und Al¬
chimie mit ihrem Suchen nach dem „Stein
der Weisen" oder dem „Lebenselirir" zu
kämpfen. Die „weiße" und „schwarze"
Magie mit ihren Geisterbeschwörungen
und Zauberkünsten, Schatzhebungen und
Teufelspakten beschäftigte große Kreise
von ernsthaft Tätigen und Gläubigen. Im
ganzen Lande loderten die Scheiterhaufen,
und die Folter bestand in vollem Um¬
fang mit all ihrer blutrünstigen Grausam¬
keit. Zweiunddreißig Jahre war Leibniz
alt, als dem letzten Herenbrand großen
Stils in Salzburg siebenundneunzig Opfer
fielen.
Das Deutschland des siebzehnten Jahr¬
hunderts stand hinter dem vorvergangenen
weit zurück. Der schreckliche Krieg hatte
die Gemüter verwirrt und verstört, die
Geister umdüstert und gelähmt. In diese
Welt fiel die Jugend eines Mannes, dessen
glänzende Begabung und ein sehr früh
erworbenes allgemeines Wissen, das er in
vollem Umfang zu besitzen sich immer ge-
trieben fühlte, ihn zu einem der vielseitigsten und fruchtbarsten Geister aller
Jahrhunderte machen sollten. Sein Vater, ein wohlberüfener Professor,
starb, als Leibniz sechs Jahre alt geworden war; die Mutter und gelehrte
Freunde erzogen ihn im Hause. Im achten
Lebensjahre öffnete man ihm schon die
Bücherschätze seines Vaters; mit fünfzehn
Jahren bezog er die heimische Universität.
Fünf Jahre später erhielt er die Doktor¬
würde an der nürnbergischen Universität
Altdorf. Schon für den Jüngling standen
zwei Grundsätze fest: im Ausdruck Klarheit,
bei den Dingen aber den Nutzen zu suchen;
und er hielt sich selbst Wort. Leibniz war
keine jener stillen Gelehrtennaturen, die nur
unter Büchern, fern vom Leben Hausen.
Schon vier Jahre nach dem Verlassen der
Hohen Schule wurde er Hofrat des Kur¬
fürsten von Mainz und fand sich bald in
die Kreise der großen europäischen Politik
gezogen. Ein Jahr vorher, als eine Königs¬
wahl in Polen stattfand, verfaßte er eine
Denkschrift, in welcher er vor Rußland
warnte, das damals Peter I. noch nicht als
Zaren besaß. Der junge Gelehrte und wer¬
dende Diplomat nannte Rußland „eine Macht,
stark genug, um ganz Europa einst zu unter¬
jochen, und dies um so mehr, als Deutsch¬
land offen liege, um den Barbaren den
Weg in die Eingeweide Europas zu öffnen.
Deutschland könne der Tummelplatz der
Nüssen und wir ihre Beute werden."
Im späteren Verlaufe seines Lebens fand
Leibniz bei den Fürsten seiner Zeit für seine Wirksamkeit in einem Maße
Anerkennung, wie sie nur selten einem Gelehrten zuteil wurde. Große
Reisen machten ihn in England, Italien und Frankreich mit allen Ver-
hältnissen vertraut. Was für seine Zeit fast unerhört ist: er verlor nie die
Liebe zu seinem Vaterland. Wohl schrieb er einen großen Teil seiner
Werke in französischer und lateinischer
Sprache, aber auch hier folgte er nur
feinem Grundsatz, bei den Dingen auf den
Nutzen zu trachten; Frankreichs Sprache
war damals die führende in Europa. Leib-
niz wendete sich immer wieder an seine
Landsleute und ermunterte sie zum Ge-
brauch der eigenen Sprache in den Wissen-
schaften, als das „einzige Mittel, um sie
bei den Ausländern in hohen Wert zu
bringen und die undeutsch gesinnten Deut-
schen zu beschämen". Er selbst nannte
vor Italienern und Franzosen unsere
Sprache einen „wunderbaren Probierstein
der Gedanken". „Was sich mit ihren Wor-
ten ohne entlehnte und ungebräuchliche
Ausdrücke sagen lasse, sei wirklich was
Rechtschaffenes; aber leere Worte, hinter
denen nichts oder gleichsam nur ein
leichter Schaum müßiger Gedanken sei,
nehme die reine deutsche Sprache nicht
an." Leibniz wollte aber nichts davon
wissen, „alle fremden, eingebürgerten
Worte auszubannen". Nichts sei damit
gedient, wenn man mit abergläubischer
Furcht ein fremdes, aber bequemes Wort
als Todsünde vermeide, die Deutschen
müßten ihren Verstand und ihre Sprache
besser üben und — eine Nation zu werden
trachten. Mit klarem Geiste zeichnete er
so früh, daß nur wenige ihn verstehen
konnten, dem Vaterlande die Wege eines
vernunftvollen, zielbewußten politischen
Handelns vor. Bitter klagte er darüber,
daß Deutschland um törichter, kleinlicher
Streitigkeiten willen um alle Macht und
jedes ernsthafte Ansehen gekommen sei;
nur als eine geeinigte Nation vermöge es
sich zu neuem Glanze zu erheben. Diese
Worte äußerte er 1697, als der schmachvolle Friede von Rijswijk ge-
schlossen wurde. Als Vierundzwanzigjähriger hatte er im August 1670
unter dem Eindruck der französischen Eroberungspolitik Ludwig XIV.
geschrieben: „Deutschland ist der Ball, den
man einander zuwirft, da um die Monarchie
gespielt wird; Deutschland ist der Kampf-
platz, darauf man um die Meisterschaft von
Europa gefochten. Kurz, Deutschland wird
nicht aufhören, seines und fremden Blut-
vergießens Schauplatz zu sein, bis es auf-
gewacht, sich gesammelt, sich vereinigt und
allen Freiern die Hoffnung, es zu gewinnen,
endlich abschneidet. Ist dieses nicht zu fassen,
so erkenne ich, daß ich an Besserung unseres
Elends und Aufhaltung unseres überm Hals
schwebenden, ohne Säumung herannahen-
den Unglücks verzweifle und die gerechte
Rache des strafenden Gottes vor Augen sehe."
Das Unheil kam rasch genug; im November
des gleichen Jahres überfielen die Franzosen
Lothringen.
Leibniz ist es gewesen, der in der gleichen
Zeit versuchte, die maßlose Eroberungssucht
des französischen Herrschers auf andere Ziele
zu lenken, nachdem es zur „ewigen Schande
und Verfluchung" geschehen war, daß er sieg-
reich geblieben. Er kannte die Grundeigen-
schaften der gallischen Rasse, deren eitle
Ruhmgier er mit scharfen Worten zeichnete.
Im Jahre 1672 wendete sich Leibniz mit
einer Denkschrift an Ludwig XIV. und schlug?
ihm einen allgemeinen Kreuzzug gegen die"
Der junge Ritter. Nach einem Gemälde von Friß Äoehle.
Verlag: Münchener Graphische Gesellschaft Pick s Co.
Gottfried Wilhelm v. Leibniz.
Nach einer Zeichnung von Deygeb gestochen von C. F. Äoetius.
8
LVmst und Dissen
... ?
Gottfried Wilhelm v. Leibniz. Zum zweihundert«» Todestag.
ls Leibniz am 1. Juli 1646 in Leipzig geboren wurde, gingen
die furchtbaren Erschütterungen des Dreißigjährigen Krieges ihrem
Ende entgegen. Deutschland war als Nation an den Rand gebracht;
die alte Kultur lag zerstört, die Verwüstung
war unermeßlich. Mehrere Menschenalter
mußten vergehen, bis das Land sich zu
seiner früheren Einwohnerzahl erhob, ehe
es im Durchschnitt den alten Wohlstand
wiederfand. Die Universitäten, bis auf
wenige im Reiche, lagen brach; die Lehrer
fristeten ein armseliges Dasein, Biblio¬
theken lagen in Schutt und Asche, und
der gelehrte Nachwuchs fehlte allerorten.
Nicht nur das Land, auch die Geister ver¬
wilderten. Die trübsten Bodensätze der
vorhergegangenen Jahrhunderte stiegen
wieder auf, und die Anfänge neuer Wissen¬
schaften hatten hart und mühselig gegen
die Wahngebilde der Astrologie und Al¬
chimie mit ihrem Suchen nach dem „Stein
der Weisen" oder dem „Lebenselirir" zu
kämpfen. Die „weiße" und „schwarze"
Magie mit ihren Geisterbeschwörungen
und Zauberkünsten, Schatzhebungen und
Teufelspakten beschäftigte große Kreise
von ernsthaft Tätigen und Gläubigen. Im
ganzen Lande loderten die Scheiterhaufen,
und die Folter bestand in vollem Um¬
fang mit all ihrer blutrünstigen Grausam¬
keit. Zweiunddreißig Jahre war Leibniz
alt, als dem letzten Herenbrand großen
Stils in Salzburg siebenundneunzig Opfer
fielen.
Das Deutschland des siebzehnten Jahr¬
hunderts stand hinter dem vorvergangenen
weit zurück. Der schreckliche Krieg hatte
die Gemüter verwirrt und verstört, die
Geister umdüstert und gelähmt. In diese
Welt fiel die Jugend eines Mannes, dessen
glänzende Begabung und ein sehr früh
erworbenes allgemeines Wissen, das er in
vollem Umfang zu besitzen sich immer ge-
trieben fühlte, ihn zu einem der vielseitigsten und fruchtbarsten Geister aller
Jahrhunderte machen sollten. Sein Vater, ein wohlberüfener Professor,
starb, als Leibniz sechs Jahre alt geworden war; die Mutter und gelehrte
Freunde erzogen ihn im Hause. Im achten
Lebensjahre öffnete man ihm schon die
Bücherschätze seines Vaters; mit fünfzehn
Jahren bezog er die heimische Universität.
Fünf Jahre später erhielt er die Doktor¬
würde an der nürnbergischen Universität
Altdorf. Schon für den Jüngling standen
zwei Grundsätze fest: im Ausdruck Klarheit,
bei den Dingen aber den Nutzen zu suchen;
und er hielt sich selbst Wort. Leibniz war
keine jener stillen Gelehrtennaturen, die nur
unter Büchern, fern vom Leben Hausen.
Schon vier Jahre nach dem Verlassen der
Hohen Schule wurde er Hofrat des Kur¬
fürsten von Mainz und fand sich bald in
die Kreise der großen europäischen Politik
gezogen. Ein Jahr vorher, als eine Königs¬
wahl in Polen stattfand, verfaßte er eine
Denkschrift, in welcher er vor Rußland
warnte, das damals Peter I. noch nicht als
Zaren besaß. Der junge Gelehrte und wer¬
dende Diplomat nannte Rußland „eine Macht,
stark genug, um ganz Europa einst zu unter¬
jochen, und dies um so mehr, als Deutsch¬
land offen liege, um den Barbaren den
Weg in die Eingeweide Europas zu öffnen.
Deutschland könne der Tummelplatz der
Nüssen und wir ihre Beute werden."
Im späteren Verlaufe seines Lebens fand
Leibniz bei den Fürsten seiner Zeit für seine Wirksamkeit in einem Maße
Anerkennung, wie sie nur selten einem Gelehrten zuteil wurde. Große
Reisen machten ihn in England, Italien und Frankreich mit allen Ver-
hältnissen vertraut. Was für seine Zeit fast unerhört ist: er verlor nie die
Liebe zu seinem Vaterland. Wohl schrieb er einen großen Teil seiner
Werke in französischer und lateinischer
Sprache, aber auch hier folgte er nur
feinem Grundsatz, bei den Dingen auf den
Nutzen zu trachten; Frankreichs Sprache
war damals die führende in Europa. Leib-
niz wendete sich immer wieder an seine
Landsleute und ermunterte sie zum Ge-
brauch der eigenen Sprache in den Wissen-
schaften, als das „einzige Mittel, um sie
bei den Ausländern in hohen Wert zu
bringen und die undeutsch gesinnten Deut-
schen zu beschämen". Er selbst nannte
vor Italienern und Franzosen unsere
Sprache einen „wunderbaren Probierstein
der Gedanken". „Was sich mit ihren Wor-
ten ohne entlehnte und ungebräuchliche
Ausdrücke sagen lasse, sei wirklich was
Rechtschaffenes; aber leere Worte, hinter
denen nichts oder gleichsam nur ein
leichter Schaum müßiger Gedanken sei,
nehme die reine deutsche Sprache nicht
an." Leibniz wollte aber nichts davon
wissen, „alle fremden, eingebürgerten
Worte auszubannen". Nichts sei damit
gedient, wenn man mit abergläubischer
Furcht ein fremdes, aber bequemes Wort
als Todsünde vermeide, die Deutschen
müßten ihren Verstand und ihre Sprache
besser üben und — eine Nation zu werden
trachten. Mit klarem Geiste zeichnete er
so früh, daß nur wenige ihn verstehen
konnten, dem Vaterlande die Wege eines
vernunftvollen, zielbewußten politischen
Handelns vor. Bitter klagte er darüber,
daß Deutschland um törichter, kleinlicher
Streitigkeiten willen um alle Macht und
jedes ernsthafte Ansehen gekommen sei;
nur als eine geeinigte Nation vermöge es
sich zu neuem Glanze zu erheben. Diese
Worte äußerte er 1697, als der schmachvolle Friede von Rijswijk ge-
schlossen wurde. Als Vierundzwanzigjähriger hatte er im August 1670
unter dem Eindruck der französischen Eroberungspolitik Ludwig XIV.
geschrieben: „Deutschland ist der Ball, den
man einander zuwirft, da um die Monarchie
gespielt wird; Deutschland ist der Kampf-
platz, darauf man um die Meisterschaft von
Europa gefochten. Kurz, Deutschland wird
nicht aufhören, seines und fremden Blut-
vergießens Schauplatz zu sein, bis es auf-
gewacht, sich gesammelt, sich vereinigt und
allen Freiern die Hoffnung, es zu gewinnen,
endlich abschneidet. Ist dieses nicht zu fassen,
so erkenne ich, daß ich an Besserung unseres
Elends und Aufhaltung unseres überm Hals
schwebenden, ohne Säumung herannahen-
den Unglücks verzweifle und die gerechte
Rache des strafenden Gottes vor Augen sehe."
Das Unheil kam rasch genug; im November
des gleichen Jahres überfielen die Franzosen
Lothringen.
Leibniz ist es gewesen, der in der gleichen
Zeit versuchte, die maßlose Eroberungssucht
des französischen Herrschers auf andere Ziele
zu lenken, nachdem es zur „ewigen Schande
und Verfluchung" geschehen war, daß er sieg-
reich geblieben. Er kannte die Grundeigen-
schaften der gallischen Rasse, deren eitle
Ruhmgier er mit scharfen Worten zeichnete.
Im Jahre 1672 wendete sich Leibniz mit
einer Denkschrift an Ludwig XIV. und schlug?
ihm einen allgemeinen Kreuzzug gegen die"
Der junge Ritter. Nach einem Gemälde von Friß Äoehle.
Verlag: Münchener Graphische Gesellschaft Pick s Co.
Gottfried Wilhelm v. Leibniz.
Nach einer Zeichnung von Deygeb gestochen von C. F. Äoetius.