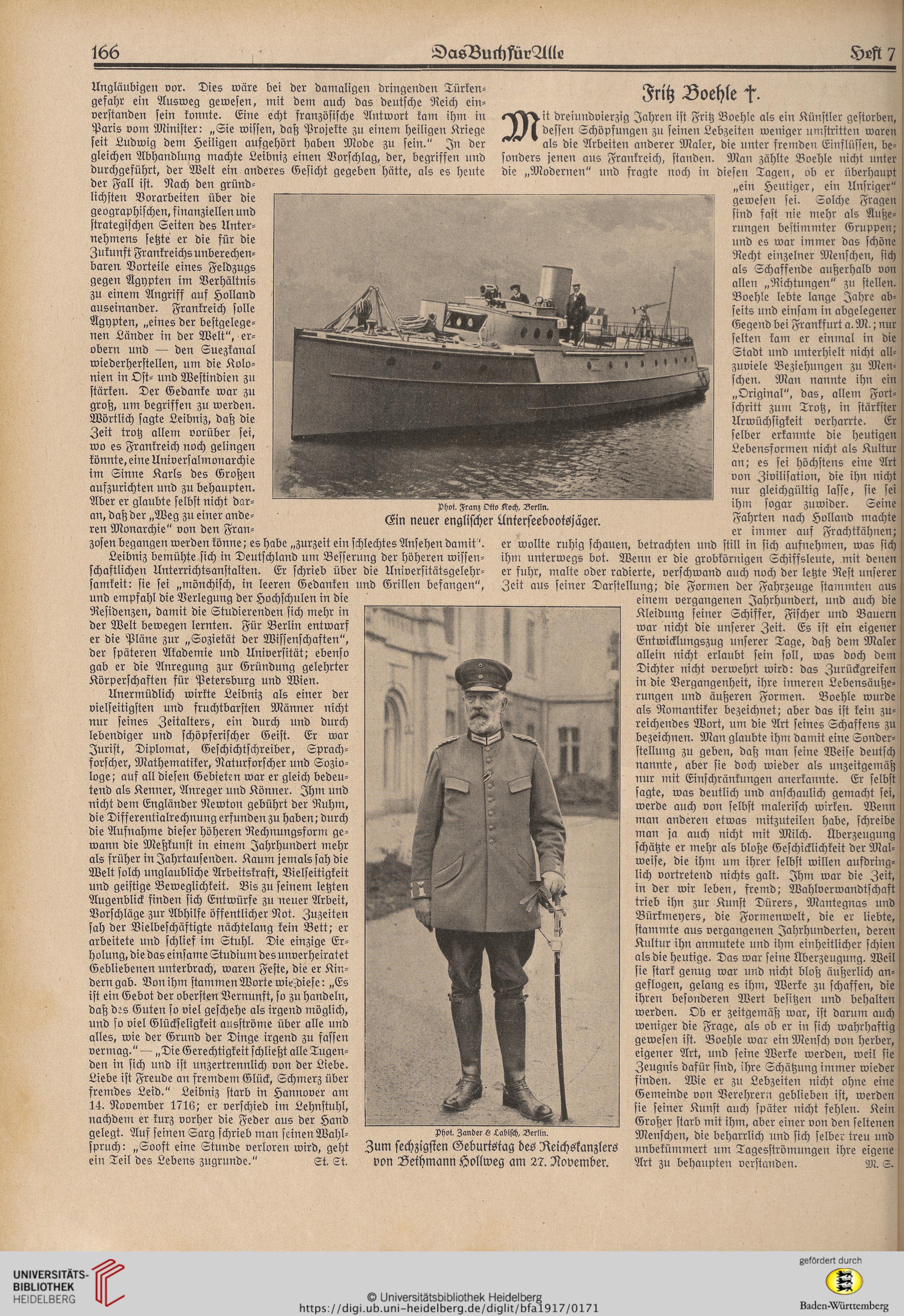166
DasBuchsüvAlls
Heft?
Ungläubigen vor. Dies wäre bei der damaligen dringenden Türken-
gefahr ein Ausweg gewesen, mit dem auch das deutsche Reich ein-
verstanden sein konnte. Eine echt französische Antwort kam ihm in
Paris vom Minister: „Sie wissen, daß Projekte zu einem heiligen Kriege
seit Ludwig dem Heiligen aufgehört haben Mode zu sein." In der
gleichen Abhandlung machte Leibniz einen Vorschlag, der, begriffen und
durchgeführt, der Welt ein anderes Gesicht gegeben hätte, als es hellte
der Fall ist. Nach den gründ¬
lichsten Vorarbeiten über die
geographischen, finanziellen und
strategischen Seiten des Unter¬
nehmens setzte er die für die
Zukunft Frankreichs unberechen¬
baren Vorteile eines Feldzugs
gegen Ägypten im Verhältnis
zu einem Angriff auf Holland
auseinander. Frankreich solle
Ägypten, „eines der bestgelege¬
nen Länder in der Welt", er¬
obern und — den Suezkanal
wiederherstellen, um die Kolo¬
nien in Ost- und Westindien zu
stärken. Der Gedanke war zu
groß, um begriffen zu werden.
Wörtlich sagte Leibniz, daß die
Zeit trotz allem vorüber sei,
wo es Frankreich noch gelingen
könnte, eine Universalmonarchie
im Sinne Karls des Großen
auszurichten und zu behaupten.
Aber er glaubte selbst nicht dar¬
an, daß der „Weg zu einer ande¬
ren Monarchie" von den Fran-
zosen begangen werden könne; es habe „zurzeit ein schlechtes Ansehen damit '.
Leibniz bemühte sich in Deutschland um Besserung der höheren wissen-
schaftlichen Unterrichtsanstalten. Er schrieb über die Universitätsgelehr-
samkeit: sie sei „mönchisch, in leeren Gedanken und Grillen besangen",
und empfahl die Verlegung der Hochschulen in die
Residenzen, damit die Studierenden sich mehr in
der Welt bewegen lernten. Für Berlin entwarf
er die Pläne zur „Sozietät der Wissenschaften",
der späteren Akademie und Universität; ebenso
gab er die Anregung zur Gründung gelehrter
Körperschaften für Petersburg und Wien.
Unermüdlich wirkte Leibniz als einer der
vielseitigsten und fruchtbarsten Männer nicht
nur seines Zeitalters, ein durch und durch
lebendiger und schöpferischer Geist. Er war
Jurist, Diplomat, Geschichtschreiber, Sprach¬
forscher, Mathematiker, Naturforscher und Sozio-
loge; auf all diesen Gebieten war er gleich bedeu-
tend als Kenner, Anreger und Könner. Ihm und
nicht dem Engländer Newton gebührt der Ruhm,
die Differentialrechnung erfunden zu haben; durch
die Aufnahme dieser höheren Rechnungsform ge¬
wann die Meßkunst in einem Jahrhundert mehr
als früher in Jahrtausenden. Kaum jemals sah die
Welt solch unglaubliche Arbeitskraft, Vielseitigkeit
und geistige Beweglichkeit. Bis zu seinem letzten
Augenblick finden sich Entwürfe zu neuer Arbeit,
Vorschläge zur Abhilfe öffentlicher Not. Zuzeiten
sah der Vielbeschäftigte nächtelang kein Bett; er
arbeitete und schlief im Stuhl. Die einzige Er¬
holung, die das einsame Studium des unverheiratet
Gebliebenen unterbrach, waren Feste, die er Kin-
dern gab. Von ihm stammen Worte wiechiese: „Es
ist ein Gebot der obersten Vernunft, so zu handeln,
daß des Guten so viel geschehe als irgend möglich,
und so viel Glückseligkeit ausströme über alle und
alles, wie der Grund der Dinge irgend zu fassen
vermag." — „Die Gerechtigkeit schließt alle Tugen¬
den in sich und ist unzertrennlich von der Liebe.
Liebe ist Freude an fremdem Glück, Schmerz über
fremdes Leid." Leibniz starb in Hannover am
14. November 1716; er verschied im Lehnstuhl,
nachdem er kurz vorher die Feder aus der Hand
gelegt. Auf seinen Sarg schrieb man seinen Wahl¬
spruch: „Sooft eine Stunde verloren wird, geht
ein Teil des Lebens zugrunde." St. St.
Fnh Boehle 4-
i-^HVit dreiundvierzig Jahren ist Fritz Boehle als ein Künstler gestorben,
i dessen Schöpfungen zu seinen Lebzeiten weniger umstritten waren
* als die Arbeiten anderer Maler, die unter fremden Einflüssen, be-
sonders jenen aus Frankreich, standen. Man zählte Boehle nicht unter
die „Modernen" und fragte noch in diesen Tagen, ob er überhaupt
„ein Heutiger, ein Unsriger"
gewesen sei. Solche Fragen
sind fast nie mehr als Äuße-
rungen bestimmter Gruppen;
und es war immer das schöne
Recht einzelner Menschen, sich
als Schaffende außerhalb von
allen „Richtungen" zu stellen.
Boehle lebte lange Jahre ab-
seits und einsam in abgelegener
Gegend bei Frankfurt a.M.; nur
selten kam er einmal in die
Stadt und unterhielt nicht all-
zuviele Beziehungen zu Men-
schen. Man nannte ihn ein
„Original", das, allem Fort-
schritt zum Trotz, in stärkster
Urwüchsigkeit verharrte. Er
selber erkannte die heutigen
Lebensformen nicht als Kultur
an; es sei höchstens eine Art
von Zivilisation, die ihn nicht
nur gleichgültig lasse, sie sei
ihm sogar zuwider. Seine
Fahrten nach Holland machte
er immer auf Frachtkähnen;
er wollte ruhig schauen, betrachten und still in sich aufnehmen, was sich
ihm unterwegs bot. Wenn er die grobkörnigen Schiffsleute, mit denen
er fuhr, malte oder radierte, verschwand auch noch der letzte Rest unserer
Zeit aus seiner Darstellung; die Formen der Fahrzeuge stammten aus
einem vergangenen Jahrhundert, und auch die
Kleidung seiner Schiffer, Fischer und Bauern
war nicht die unserer Zeit. Es ist ein eigener
Entwicklungszug unserer Tage, daß dem Maler
allein nicht erlaubt sein soll, was doch dem
Dichter nicht verwehrt wird: das Zurückgreifen
in die Vergangenheit, ihre inneren Lebensäuße-
rungen und äußeren Formen. Boehle wurde
als Romantiker bezeichnet; aber das ist kein zu-
reichendes Wort, um die Art seines Schaffens zu
bezeichnen. Man glaubte ihm damit eine Sonder-
stellung zu geben, daß man seine Weise deutsch
nannte, aber sie doch wieder als unzeitgemäß
nur mit Einschränkungen anerkannte. Er selbst
sagte, was deutlich und anschaulich gemacht sei,
werde auch von selbst malerisch wirken. Wenn
man anderen etwas mitzuteilen habe, schreibe
man ja auch nicht mit Milch. Überzeugung
schätzte er mehr als bloße Geschicklichkeit der Mal-
weise, die ihm um ihrer selbst willen aufdring-
lich vortretend nichts galt. Ihm war die Zeit,
in der wir leben, fremd; Wahlverwandtschaft
trieb ihn zur Kunst Dürers, Mantegnas und
Bürkmeyers, die Formenwelt, die er liebte,
stammte aus vergangenen Jahrhunderten, deren
Kultur ihn anmutete und ihm einheitlicher schien
als die heutige. Das war seine Überzeugung. Weil
sie stark genug war und nicht bloß äußerlich an-
geflogen, gelang es ihm, Werke zu schaffen, die
ihren besonderen Wert besitzen und behalten
werden. Ob er zeitgemäß war, ist darum auch
weniger die Frage, als ob er in sich wahrhaftig
gewesen ist. Boehle war ein Mensch von herber,
eigener Art, und seine Werke werden, weil sie
Zeugnis dafür sind, ihre Schätzung immer wieder
finden. Wie er zu Lebzeiten nicht ohne eine
Gemeinde von Verehrern geblieben ist, werden
sie seiner Kunst auch später nicht fehlen. Kein
Großer starb mit ihm, aber einer von den seltenen
Menschen, die beharrlich und sich selber treu und
unbekümmert um Tagesströmungen ihre eigene
Art zu behaupten verstanden. M. S.
Phot. Franz Otto Koch. Berlin.
(An neuer englischer ünterseebootsjäger.
Phot. Zander s Labisch, Berlin.
Zum sechzigsten Geburtstag des Reichskanzlers
von Bethmann Hollweg am 27. November.
DasBuchsüvAlls
Heft?
Ungläubigen vor. Dies wäre bei der damaligen dringenden Türken-
gefahr ein Ausweg gewesen, mit dem auch das deutsche Reich ein-
verstanden sein konnte. Eine echt französische Antwort kam ihm in
Paris vom Minister: „Sie wissen, daß Projekte zu einem heiligen Kriege
seit Ludwig dem Heiligen aufgehört haben Mode zu sein." In der
gleichen Abhandlung machte Leibniz einen Vorschlag, der, begriffen und
durchgeführt, der Welt ein anderes Gesicht gegeben hätte, als es hellte
der Fall ist. Nach den gründ¬
lichsten Vorarbeiten über die
geographischen, finanziellen und
strategischen Seiten des Unter¬
nehmens setzte er die für die
Zukunft Frankreichs unberechen¬
baren Vorteile eines Feldzugs
gegen Ägypten im Verhältnis
zu einem Angriff auf Holland
auseinander. Frankreich solle
Ägypten, „eines der bestgelege¬
nen Länder in der Welt", er¬
obern und — den Suezkanal
wiederherstellen, um die Kolo¬
nien in Ost- und Westindien zu
stärken. Der Gedanke war zu
groß, um begriffen zu werden.
Wörtlich sagte Leibniz, daß die
Zeit trotz allem vorüber sei,
wo es Frankreich noch gelingen
könnte, eine Universalmonarchie
im Sinne Karls des Großen
auszurichten und zu behaupten.
Aber er glaubte selbst nicht dar¬
an, daß der „Weg zu einer ande¬
ren Monarchie" von den Fran-
zosen begangen werden könne; es habe „zurzeit ein schlechtes Ansehen damit '.
Leibniz bemühte sich in Deutschland um Besserung der höheren wissen-
schaftlichen Unterrichtsanstalten. Er schrieb über die Universitätsgelehr-
samkeit: sie sei „mönchisch, in leeren Gedanken und Grillen besangen",
und empfahl die Verlegung der Hochschulen in die
Residenzen, damit die Studierenden sich mehr in
der Welt bewegen lernten. Für Berlin entwarf
er die Pläne zur „Sozietät der Wissenschaften",
der späteren Akademie und Universität; ebenso
gab er die Anregung zur Gründung gelehrter
Körperschaften für Petersburg und Wien.
Unermüdlich wirkte Leibniz als einer der
vielseitigsten und fruchtbarsten Männer nicht
nur seines Zeitalters, ein durch und durch
lebendiger und schöpferischer Geist. Er war
Jurist, Diplomat, Geschichtschreiber, Sprach¬
forscher, Mathematiker, Naturforscher und Sozio-
loge; auf all diesen Gebieten war er gleich bedeu-
tend als Kenner, Anreger und Könner. Ihm und
nicht dem Engländer Newton gebührt der Ruhm,
die Differentialrechnung erfunden zu haben; durch
die Aufnahme dieser höheren Rechnungsform ge¬
wann die Meßkunst in einem Jahrhundert mehr
als früher in Jahrtausenden. Kaum jemals sah die
Welt solch unglaubliche Arbeitskraft, Vielseitigkeit
und geistige Beweglichkeit. Bis zu seinem letzten
Augenblick finden sich Entwürfe zu neuer Arbeit,
Vorschläge zur Abhilfe öffentlicher Not. Zuzeiten
sah der Vielbeschäftigte nächtelang kein Bett; er
arbeitete und schlief im Stuhl. Die einzige Er¬
holung, die das einsame Studium des unverheiratet
Gebliebenen unterbrach, waren Feste, die er Kin-
dern gab. Von ihm stammen Worte wiechiese: „Es
ist ein Gebot der obersten Vernunft, so zu handeln,
daß des Guten so viel geschehe als irgend möglich,
und so viel Glückseligkeit ausströme über alle und
alles, wie der Grund der Dinge irgend zu fassen
vermag." — „Die Gerechtigkeit schließt alle Tugen¬
den in sich und ist unzertrennlich von der Liebe.
Liebe ist Freude an fremdem Glück, Schmerz über
fremdes Leid." Leibniz starb in Hannover am
14. November 1716; er verschied im Lehnstuhl,
nachdem er kurz vorher die Feder aus der Hand
gelegt. Auf seinen Sarg schrieb man seinen Wahl¬
spruch: „Sooft eine Stunde verloren wird, geht
ein Teil des Lebens zugrunde." St. St.
Fnh Boehle 4-
i-^HVit dreiundvierzig Jahren ist Fritz Boehle als ein Künstler gestorben,
i dessen Schöpfungen zu seinen Lebzeiten weniger umstritten waren
* als die Arbeiten anderer Maler, die unter fremden Einflüssen, be-
sonders jenen aus Frankreich, standen. Man zählte Boehle nicht unter
die „Modernen" und fragte noch in diesen Tagen, ob er überhaupt
„ein Heutiger, ein Unsriger"
gewesen sei. Solche Fragen
sind fast nie mehr als Äuße-
rungen bestimmter Gruppen;
und es war immer das schöne
Recht einzelner Menschen, sich
als Schaffende außerhalb von
allen „Richtungen" zu stellen.
Boehle lebte lange Jahre ab-
seits und einsam in abgelegener
Gegend bei Frankfurt a.M.; nur
selten kam er einmal in die
Stadt und unterhielt nicht all-
zuviele Beziehungen zu Men-
schen. Man nannte ihn ein
„Original", das, allem Fort-
schritt zum Trotz, in stärkster
Urwüchsigkeit verharrte. Er
selber erkannte die heutigen
Lebensformen nicht als Kultur
an; es sei höchstens eine Art
von Zivilisation, die ihn nicht
nur gleichgültig lasse, sie sei
ihm sogar zuwider. Seine
Fahrten nach Holland machte
er immer auf Frachtkähnen;
er wollte ruhig schauen, betrachten und still in sich aufnehmen, was sich
ihm unterwegs bot. Wenn er die grobkörnigen Schiffsleute, mit denen
er fuhr, malte oder radierte, verschwand auch noch der letzte Rest unserer
Zeit aus seiner Darstellung; die Formen der Fahrzeuge stammten aus
einem vergangenen Jahrhundert, und auch die
Kleidung seiner Schiffer, Fischer und Bauern
war nicht die unserer Zeit. Es ist ein eigener
Entwicklungszug unserer Tage, daß dem Maler
allein nicht erlaubt sein soll, was doch dem
Dichter nicht verwehrt wird: das Zurückgreifen
in die Vergangenheit, ihre inneren Lebensäuße-
rungen und äußeren Formen. Boehle wurde
als Romantiker bezeichnet; aber das ist kein zu-
reichendes Wort, um die Art seines Schaffens zu
bezeichnen. Man glaubte ihm damit eine Sonder-
stellung zu geben, daß man seine Weise deutsch
nannte, aber sie doch wieder als unzeitgemäß
nur mit Einschränkungen anerkannte. Er selbst
sagte, was deutlich und anschaulich gemacht sei,
werde auch von selbst malerisch wirken. Wenn
man anderen etwas mitzuteilen habe, schreibe
man ja auch nicht mit Milch. Überzeugung
schätzte er mehr als bloße Geschicklichkeit der Mal-
weise, die ihm um ihrer selbst willen aufdring-
lich vortretend nichts galt. Ihm war die Zeit,
in der wir leben, fremd; Wahlverwandtschaft
trieb ihn zur Kunst Dürers, Mantegnas und
Bürkmeyers, die Formenwelt, die er liebte,
stammte aus vergangenen Jahrhunderten, deren
Kultur ihn anmutete und ihm einheitlicher schien
als die heutige. Das war seine Überzeugung. Weil
sie stark genug war und nicht bloß äußerlich an-
geflogen, gelang es ihm, Werke zu schaffen, die
ihren besonderen Wert besitzen und behalten
werden. Ob er zeitgemäß war, ist darum auch
weniger die Frage, als ob er in sich wahrhaftig
gewesen ist. Boehle war ein Mensch von herber,
eigener Art, und seine Werke werden, weil sie
Zeugnis dafür sind, ihre Schätzung immer wieder
finden. Wie er zu Lebzeiten nicht ohne eine
Gemeinde von Verehrern geblieben ist, werden
sie seiner Kunst auch später nicht fehlen. Kein
Großer starb mit ihm, aber einer von den seltenen
Menschen, die beharrlich und sich selber treu und
unbekümmert um Tagesströmungen ihre eigene
Art zu behaupten verstanden. M. S.
Phot. Franz Otto Koch. Berlin.
(An neuer englischer ünterseebootsjäger.
Phot. Zander s Labisch, Berlin.
Zum sechzigsten Geburtstag des Reichskanzlers
von Bethmann Hollweg am 27. November.