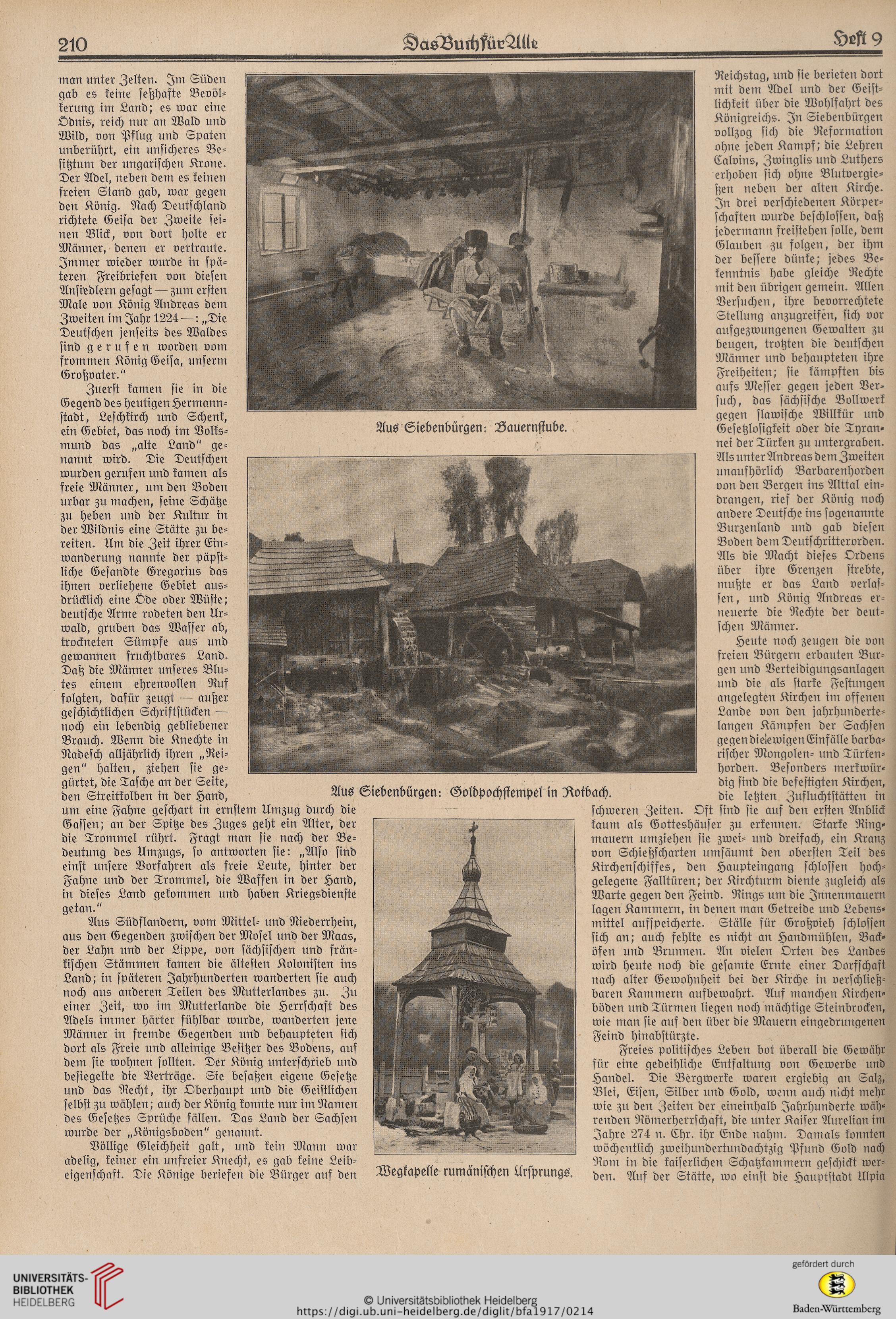210 DasBurtMvAtlL Hefty
man unter Zelten. Im Süden
gab es keine seßhafte Bevöl-
kerung im Land; es war eine
Odnis, reich nur an Wald und
Wild, von Pflug uud Spaten
unberührt, ein unsicheres Be-
sitztum der ungarischen Krone.
Der Adel, neben dem es keinen
freien Stand gab, war gegen
den König. Nach Deutschland
richtete Geisa der Zweite sei-
nen Blick, von dort holte er
Männer, denen er vertraute.
Immer wieder wurde in spä-
teren Freibriefen von diesen
Ansiedlern gesagt — zum ersten
Male von König Andreas dem
Zweiten im Jahr 1224 —: „Die
Deutschen jenseits des Waldes
sind gerufen worden vom
frommen König Geisa, unserm
Großvater."
Zuerst kamen sie in die
Gegend des heutigen Hermann-
stadt, Leschkirch und Schenk,
ein Gebiet, das noch im Volks-
mund das „alte Land" ge-
nannt wird. Die Deutschen
wurden gerufen und kamen als
freie Männer, um den Boden
urbar zu machen, seine Schätze
zu heben und der Kultur in
der Wildnis eine Stätte zu be-
reiten. Um die Zeit ihrer Ein-
wanderung nannte der päpst-
liche Gesandte Gregorius das
ihnen verliehene Gebiet aus-
drücklich eine Ode oder Wüste;
deutsche Arme rodeten den Ur¬
wald, gruben das Wasser ab,
trockneten Sümpfe aus und
gewannen fruchtbares Land.
Daß die Männer unseres Blu-
tes einem ehrenvollen Ruf
folgten, dafür zeugt — außer
geschichtlichen Schriftstücken —
noch ein lebendig gebliebener
Brauch. Wenn die Knechte in
Nadesch alljährlich ihren „Rei-
gen" halten, ziehen sie ge¬
gürtet, die Tasche an der Seite,
den Streitkolben in der Hand,
um eine Fahne geschart in ernstem Umzug durch die
Gassen; an der Spitze des Zuges geht ein Alter, der
die Trommel rührt. Fragt man sie nach der Be-
deutung des Umzugs, so antworten sie: „Also sind
einst unsere Vorfahren als freie Leute, hinter der
Fahne und der Trommel, die Waffen in der Hand,
in dieses Land gekommen und haben Kriegsdienste
getan."
Aus Südflandern, vom Mittel- und Niederrhein,
aus den Gegenden zwischen der Mosel und der Maas,
der Lahn und der Lippe, von sächsischen und frän-
kischen Stämmen kamen die ältesten Kolonisten ins
Land; in späteren Jahrhunderten wanderten sie auch
noch aus anderen Teilen des Mutterlandes zu. Zu
einer Zeit, wo im Mutterlande die Herrschaft des
Adels immer härter fühlbar wurde, wanderten jene
Männer in fremde Gegenden und behaupteten sich
dort als Freie und alleinige Besitzer des Bodens, auf
dem sie wohnen sollten. Der König unterschrieb und
besiegelte die Verträge. Sie besaßen eigene Gesetze
und das Recht, ihr Oberhaupt und die Geistlichen
selbst zu wählen; auch der König konnte nur im Namen
des Gesetzes Sprüche fällen. Das Land der Sachsen
wurde der „Königsboden" genannt.
Völlige Gleichheit galt, und kein Mann war
adelig, keiner ein unfreier Knecht, es gab keine Leib-
eigenschaft. Die Könige beriefen die Bürger auf den
Reichstag, und sie berieten dort
mit dem Adel und der Geist-
lichkeit über die Wohlfahrt des
Königreichs. In Siebenbürgen
vollzog sich die Reformation
ohne jeden Kampf; die Lehren
Calvins, Zwinglis und Luthers
erhoben sich ohne Blutvergie-
ßen neben der alten Kirche.
In drei verschiedenen Körper-
schaften wurde beschlossen, daß
jedermann freistehen solle, dem
Glauben zu folgen, der ihm
der bessere dünke; jedes Be-
kenntnis habe gleiche Rechte
mit den übrigen gemein. Allen
Versuchen, ihre bevorrechtete
Stellung anzugreifen, sich vor
aufgezwungenen Gewalten zu
beugen, trotzten die deutschen
Männer und behaupteten ihre
Freiheiten; sie kämpften bis
aufs Messer gegen jeden Ver-
such, das sächsische Bollwerk
gegen slawische Willkür und
Gesetzlosigkeit oder die Tyran-
nei der Türken zu untergraben.
Als unter Andreas dem Zweiten
unaufhörlich Barbarenhorden
von den Bergen ins Alttal ein-
drangen, rief der König noch
andere Deutsche ins sogenannte
Burzenland und gab diesen
Boden dem Deutschritterorden.
Als die Macht dieses Ordens
über ihre Grenzen strebte,
mußte er das Land verlas-
sen, und König Andreas er-
neuerte die Rechte der deut-
schen Männer.
Heute noch zeugen die von
freien Bürgern erbauten Bur-
gen und Verteidigungsanlagen
und die als starke Festungen
angelegten Kirchen im offenen
Lande von den jahrhunderte-
langen Kämpfen der Sachsen
gegen dieiewigen Einfälle barba-
rischer Mongolen- und Türken-
horden. Besonders merkwür-
dig sind die befestigten Kirchen,
die letzten Zufluchtstätten in
Oft sind sie auf den ersten Anblick
kaum als Gotteshäuser zu erkennen. Starke Ring-
mauern umziehen sie zwei- und dreifach, ein Kranz
von Schießscharten umsäumt den obersten Teil des
Kirchenschiffes, den Haupteingang schlossen hoch-
gelegene Falltüren; der Kirchturm diente zugleich als
Warte gegen den Feind. Rings um die Jnnenmauern
lagen Kammern, in denen man Getreide und Lebens-
mittel aufspeicherte. Ställe für Großvieh schlossen
sich an; auch fehlte es nicht an Handmühlen, Back-
öfen und Brunnen. An vielen Orten des Landes
wird heute noch die gesamte Ernte einer Dorfschaft
nach alter Gewohnheit bei der Kirche in verschließ-
baren Kammern aufbewahrt. Auf manchen Kirchen-
böden und Türmen liegen noch mächtige Steinbrocken,
wie man sie auf den über die Mauern eingedrungenen
Feind hinabstürzte.
Freies politisches Leben bot überall die Gewähr
für eine gedeihliche Entfaltung von Gewerbe und
Handel. Die Bergwerke waren ergiebig an Salz,
Blei, Eisen, Silber und Gold, wenn auch nicht mehr
wie zu den Zeiten der eineinhalb Jahrhunderte wäh-
renden Römerherrschaft, die unter Kaiser Aurelian im
Jahre 274 n. Ehr. ihr Ende nahm. Damals konnten
wöchentlich zweihundertundachtzig Pfund Gold nach
Rom in die kaiserlichen Schatzkammern geschickt wer-
den. Auf der Stätte, wo einst die Hauptstadt Ulpia
Wegkapelle rumänischen Ursprungs.
Aus Siebenbürgen: Äauernstube.
Aus Siebenbürgen: Goldpochstempel in iKotbach.
schweren Zeiten.
man unter Zelten. Im Süden
gab es keine seßhafte Bevöl-
kerung im Land; es war eine
Odnis, reich nur an Wald und
Wild, von Pflug uud Spaten
unberührt, ein unsicheres Be-
sitztum der ungarischen Krone.
Der Adel, neben dem es keinen
freien Stand gab, war gegen
den König. Nach Deutschland
richtete Geisa der Zweite sei-
nen Blick, von dort holte er
Männer, denen er vertraute.
Immer wieder wurde in spä-
teren Freibriefen von diesen
Ansiedlern gesagt — zum ersten
Male von König Andreas dem
Zweiten im Jahr 1224 —: „Die
Deutschen jenseits des Waldes
sind gerufen worden vom
frommen König Geisa, unserm
Großvater."
Zuerst kamen sie in die
Gegend des heutigen Hermann-
stadt, Leschkirch und Schenk,
ein Gebiet, das noch im Volks-
mund das „alte Land" ge-
nannt wird. Die Deutschen
wurden gerufen und kamen als
freie Männer, um den Boden
urbar zu machen, seine Schätze
zu heben und der Kultur in
der Wildnis eine Stätte zu be-
reiten. Um die Zeit ihrer Ein-
wanderung nannte der päpst-
liche Gesandte Gregorius das
ihnen verliehene Gebiet aus-
drücklich eine Ode oder Wüste;
deutsche Arme rodeten den Ur¬
wald, gruben das Wasser ab,
trockneten Sümpfe aus und
gewannen fruchtbares Land.
Daß die Männer unseres Blu-
tes einem ehrenvollen Ruf
folgten, dafür zeugt — außer
geschichtlichen Schriftstücken —
noch ein lebendig gebliebener
Brauch. Wenn die Knechte in
Nadesch alljährlich ihren „Rei-
gen" halten, ziehen sie ge¬
gürtet, die Tasche an der Seite,
den Streitkolben in der Hand,
um eine Fahne geschart in ernstem Umzug durch die
Gassen; an der Spitze des Zuges geht ein Alter, der
die Trommel rührt. Fragt man sie nach der Be-
deutung des Umzugs, so antworten sie: „Also sind
einst unsere Vorfahren als freie Leute, hinter der
Fahne und der Trommel, die Waffen in der Hand,
in dieses Land gekommen und haben Kriegsdienste
getan."
Aus Südflandern, vom Mittel- und Niederrhein,
aus den Gegenden zwischen der Mosel und der Maas,
der Lahn und der Lippe, von sächsischen und frän-
kischen Stämmen kamen die ältesten Kolonisten ins
Land; in späteren Jahrhunderten wanderten sie auch
noch aus anderen Teilen des Mutterlandes zu. Zu
einer Zeit, wo im Mutterlande die Herrschaft des
Adels immer härter fühlbar wurde, wanderten jene
Männer in fremde Gegenden und behaupteten sich
dort als Freie und alleinige Besitzer des Bodens, auf
dem sie wohnen sollten. Der König unterschrieb und
besiegelte die Verträge. Sie besaßen eigene Gesetze
und das Recht, ihr Oberhaupt und die Geistlichen
selbst zu wählen; auch der König konnte nur im Namen
des Gesetzes Sprüche fällen. Das Land der Sachsen
wurde der „Königsboden" genannt.
Völlige Gleichheit galt, und kein Mann war
adelig, keiner ein unfreier Knecht, es gab keine Leib-
eigenschaft. Die Könige beriefen die Bürger auf den
Reichstag, und sie berieten dort
mit dem Adel und der Geist-
lichkeit über die Wohlfahrt des
Königreichs. In Siebenbürgen
vollzog sich die Reformation
ohne jeden Kampf; die Lehren
Calvins, Zwinglis und Luthers
erhoben sich ohne Blutvergie-
ßen neben der alten Kirche.
In drei verschiedenen Körper-
schaften wurde beschlossen, daß
jedermann freistehen solle, dem
Glauben zu folgen, der ihm
der bessere dünke; jedes Be-
kenntnis habe gleiche Rechte
mit den übrigen gemein. Allen
Versuchen, ihre bevorrechtete
Stellung anzugreifen, sich vor
aufgezwungenen Gewalten zu
beugen, trotzten die deutschen
Männer und behaupteten ihre
Freiheiten; sie kämpften bis
aufs Messer gegen jeden Ver-
such, das sächsische Bollwerk
gegen slawische Willkür und
Gesetzlosigkeit oder die Tyran-
nei der Türken zu untergraben.
Als unter Andreas dem Zweiten
unaufhörlich Barbarenhorden
von den Bergen ins Alttal ein-
drangen, rief der König noch
andere Deutsche ins sogenannte
Burzenland und gab diesen
Boden dem Deutschritterorden.
Als die Macht dieses Ordens
über ihre Grenzen strebte,
mußte er das Land verlas-
sen, und König Andreas er-
neuerte die Rechte der deut-
schen Männer.
Heute noch zeugen die von
freien Bürgern erbauten Bur-
gen und Verteidigungsanlagen
und die als starke Festungen
angelegten Kirchen im offenen
Lande von den jahrhunderte-
langen Kämpfen der Sachsen
gegen dieiewigen Einfälle barba-
rischer Mongolen- und Türken-
horden. Besonders merkwür-
dig sind die befestigten Kirchen,
die letzten Zufluchtstätten in
Oft sind sie auf den ersten Anblick
kaum als Gotteshäuser zu erkennen. Starke Ring-
mauern umziehen sie zwei- und dreifach, ein Kranz
von Schießscharten umsäumt den obersten Teil des
Kirchenschiffes, den Haupteingang schlossen hoch-
gelegene Falltüren; der Kirchturm diente zugleich als
Warte gegen den Feind. Rings um die Jnnenmauern
lagen Kammern, in denen man Getreide und Lebens-
mittel aufspeicherte. Ställe für Großvieh schlossen
sich an; auch fehlte es nicht an Handmühlen, Back-
öfen und Brunnen. An vielen Orten des Landes
wird heute noch die gesamte Ernte einer Dorfschaft
nach alter Gewohnheit bei der Kirche in verschließ-
baren Kammern aufbewahrt. Auf manchen Kirchen-
böden und Türmen liegen noch mächtige Steinbrocken,
wie man sie auf den über die Mauern eingedrungenen
Feind hinabstürzte.
Freies politisches Leben bot überall die Gewähr
für eine gedeihliche Entfaltung von Gewerbe und
Handel. Die Bergwerke waren ergiebig an Salz,
Blei, Eisen, Silber und Gold, wenn auch nicht mehr
wie zu den Zeiten der eineinhalb Jahrhunderte wäh-
renden Römerherrschaft, die unter Kaiser Aurelian im
Jahre 274 n. Ehr. ihr Ende nahm. Damals konnten
wöchentlich zweihundertundachtzig Pfund Gold nach
Rom in die kaiserlichen Schatzkammern geschickt wer-
den. Auf der Stätte, wo einst die Hauptstadt Ulpia
Wegkapelle rumänischen Ursprungs.
Aus Siebenbürgen: Äauernstube.
Aus Siebenbürgen: Goldpochstempel in iKotbach.
schweren Zeiten.