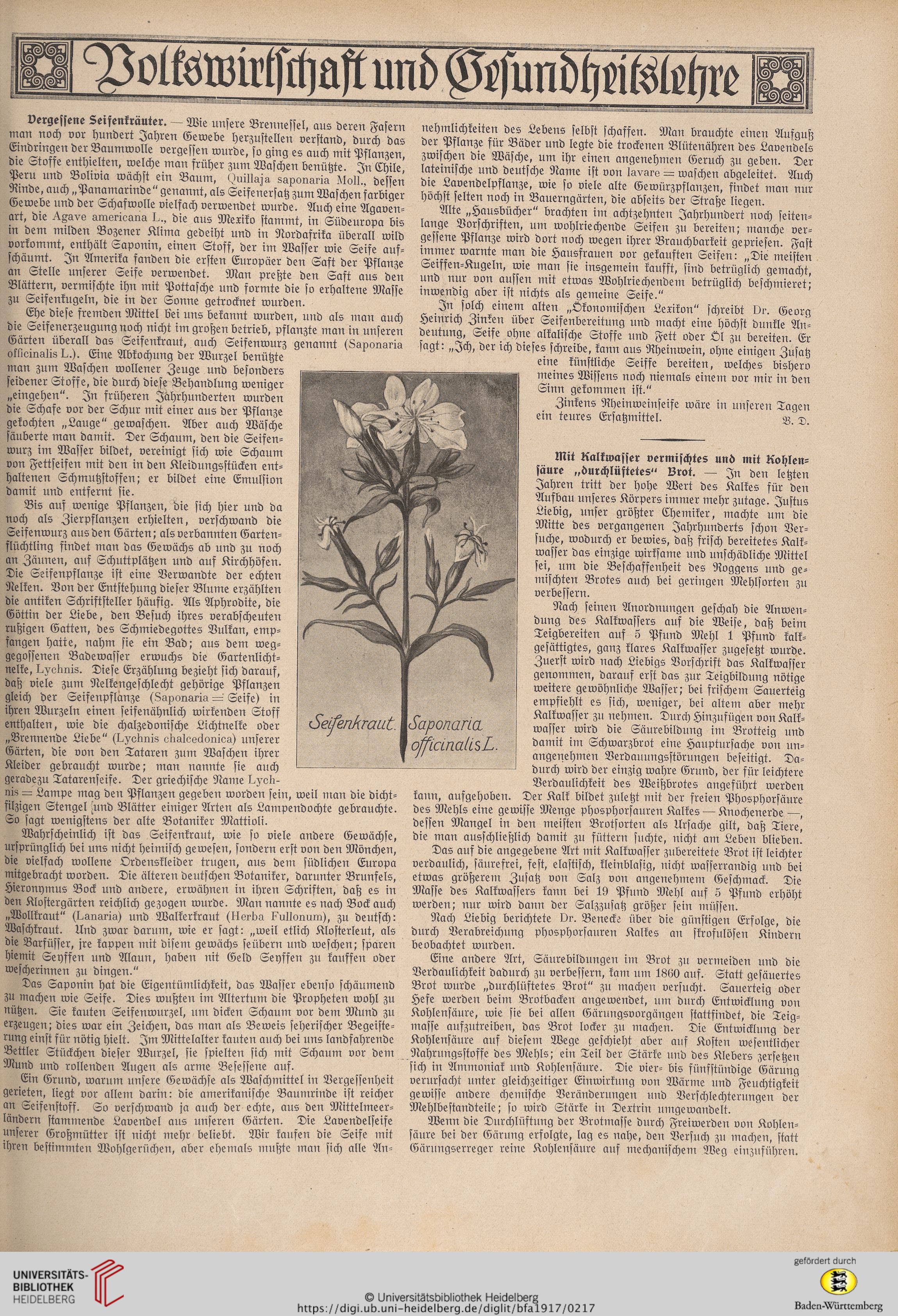vergessene Seifenkräuter. — Wie unsere Brennessel, aus deren Fasern
man noch vor hundert Jahren Gewebe herzustellen verstand, durch das
Eindringen der Baumwolle vergessen wurde, so ging es auch mit Pflanzen,
die Stoffe enthielten, welche man früher zum Waschen benützte. In Chile,
Peru und Bolivia wächst ein Baum, (stnllaja 8aponaria Noll., dessen
Rinde, auch „Panamarinde" genannt, als Seifenersatz zum Waschen farbiger
Gewebe und der Schafwolle vielfach verwendet wurde. Auch eine Agaven-
art, die amorieana D., die aus Mexiko stammt, in Südeuropa bis
in dem milden Bozener Klima gedeiht und in Nordafrika überall wild
vorkommt, enthüll Saponin, einen Stoff, der im Wasser wie Seife auf-
schäumt. In Amerika fanden die ersten Europäer den Saft der Pflanze
an Stelle unserer Seife verwendet. Man preßte den Saft aus den
Blättern, vermischte ihn mit Pottasche und formte die so erhaltene Masse
zu Seifenkugeln, die in der Sonne getrocknet wurden.
Ehe diese fremden Mittel bei uns bekannt wurden, und als man auch
die Seifenerzeugung noch nicht im großen betrieb, pflanzte man in unseren
Gärten überall das Seifenkraut, auch Seifenwurz genannt (8aponaria
oklloinali8 ÜZ. Eine Abkochung der Wurzel benützte
man zum Waschen wollener Zeuge und besonders
seidener Stoffe, die durch diese Behandlung weniger
„eingehen". In früheren Jahrhunderten wurden
die Schafe vor der Schur mit einer aus der Pflanze
gekochten „Lauge" gewaschen. Aber auch Wäsche
säuberte man damit. Der Schaum, den die Seifen-
wurz im Wasser bildet, vereinigt sich wie Schaum
von Fettseifen mit den in den Kleidungsstücken ent-
haltenen Schmutzstoffen,- er bildet eine Emulsion
damit und entfernt sie.
Bis auf wenige Pflanzen, die sich hier und da
noch als Zierpflanzen erhielten, verschwand die
Seifenwurz aus den Gärten; als verbannten Garten¬
flüchtling findet man das Gewächs ab und zu noch
an Zäunen, auf Schuttplätzen und auf Kirchhöfen.
Die Seifenpflanze ist eine Verwandte der echten
Nelken. Von der Entstehung dieser Blume erzählten
die antiken Schriftsteller häufig. Als Aphrodite, die
Göttin der Liebe, den Besuch ihres verabscheuten
rußigen Gatten, des Schmiedegottes Vulkan, emp-
fangen hatte, nahm sie ein Bad; aus dem weg-
gegossenen Badewasser erwuchs die Gartenlicht-
nelke, b^6bni8. Diese Erzählung bezieht sich darauf,
daß viele zum Nelkengeschlecht gehörige Pflanzen
gleich der Seifenpflanze (8aponaria —' Seife) in
ihren Wurzeln einen seifenähnlich wirkenden Stoff
enthalten, wie die chalzedonische Lichtnelke oder
„Brennende Liebe" (L^obnis obeckooäonioa) unserer
Gärten, die von den Tataren zum Waschen ihrer
Kleider gebraucht wurde; man nannte sie auch
geradezu Tatarenseife. Der griechische Name D^ob-
M8 — Lampe mag den Pflanzen gegeben worden sein, weil man die dicht-
filzigen Stengel ^und Blätter einiger Arten als Lampendochte gebrauchte.
So sagt wenigstens der alte Botaniker Mattioli.
Wahrscheinlich ist das Seifenkraut, wie so viele andere Gewächse,
ursprünglich bei uns nicht heimisch gewesen, sondern erst von den Mönchen,
die vielfach wollene Ordenskleider trugen, aus dem südlichen Europa
mitgebracht worden. Die älteren deutschen Botaniker, darunter Brunfels,
Hieronymus Bock und andere, erwähnen in ihren Schriften, daß es in
den Klostergärten reichlich gezogen wurde. Man nannte es nach Bock auch
„Wollkraut" (Danaria) und Walkerkraut (Horba bullonum), zu deutsch:
Waschkraut. Und zwar darum, wie er sagt: „weil etlich Klosterleut, als
die Barfüsser, jre kappen mit disem gewächs seübern und weschen; sparen
hiemit Seyffen und Alaun, haben nit Geld Seyffen zu kauffen oder
wescherinnen zu dingen."
Das Saponin hat die Eigentümlichkeit, das Wasser ebenso schäumend
zu machen wie Seife. Dies wußten im Altertum die Propheten wohl zu
nützen. Sie kauten Seifenwurzel, um dicken Schaum vor dem Mund zu
erzeugen; dies war ein Zeichen, das man als Beweis seherischer Begeiste-
rung einst für nötig hielt. Im Mittelalter kauten auch bei uns landfahrende
Bettler Stückchen dieser Wurzel, sie spielten sich mit Schaum vor dem
Mund und rollenden Augen als arme Besessene auf.
Ein Grund, warum unsere Gewächse als Waschmittel in Vergessenheit
gerieten, liegt vor allem darin: die amerikanische Baumrinde ist reicher
an Seifenstoff. So verschwand ja auch der echte, aus den Mittelmeer-
ländern stammende Lavendel aus unseren Gärten. Die Lavendelseife
unserer Großmütter ist nicht mehr beliebt. Wir kaufen die Seife mit
ihren bestimmten Wohlgerüchen, aber ehemals mußte man sich alle An-
nehmlichkeiten des Lebens selbst schaffen. Man brauchte einen Aufguß
der Pflanze für Bäder und legte die trockenen Blütenähren des Lavendels
zwischen die Wäsche, um ihr einen angenehmen Geruch zu geben. Der
lateinische und deutsche Name ist von lavaro — waschen abgeleitet. Auch
die Lavendelpflanze, wie so viele alte Gewürzpflanzen, findet man nur
höchst selten noch in Bauerngürten, die abseits der Straße liegen.
Alte „Hausbücher" brachten im achtzehnten Jahrhundert noch seiten-
lange Vorschriften, um wohlriechende Seifen zu bereiten; manche ver-
gessene Pflanze wird dort noch wegen ihrer Brauchbarkeit gepriesen. Fast
immer warnte man die Hausfrauen vor gekauften Seifen: „Die meisten
Seiffen-Kugeln, wie man sie insgemein kaufst, sind betrüglich gemacht,
und nur von aussen mit etwas Wohlriechendem betrüglich beschmieret;
inwendig aber ist nichts als gemeine Seife."
In solch einem alten „Ökonomischen Lexikon" schreibt vr. Georg
Heinrich Zinken über Seifenbereitung und macht eine höchst dunkle An-
deutung, Seife ohne alkalische Stoffe und Fett oder Dl zu bereiten. Er
sagt: „Ich, der ich dieses schreibe, kann aus Rheinwein, ohne einigen Zusatz
eine künstliche Seiffe bereiten, welches bishero
meines Wissens noch niemals einem vor mir in den
Sinn gekommen ist."
Zinkens Rheinweinseife wäre in unseren Tagen
ein teures Ersatzmittel. B. D.
Mit Nalkwasser vermischtes und mit Aohlen-
säure „durchlüftetes" Brot. — In den letzten
Jahren tritt der hohe Wert des Kalkes für den
Aufbau unseres Körpers immer mehr zutage. Justus
Liebig, unser größter Chemiker, machte um die
Mitte des vergangenen Jahrhunderts schon Ver-
suche, wodurch er bewies, daß frisch bereitetes Kalk-
wasser das einzige wirksame und unschädliche Mittel
sei, um die Beschaffenheit des Roggens und ge-
mischten Brotes auch bei geringen Mehlsorten zu
verbessern.
Nach seinen Anordnungen geschah die Anwen-
dung des Kalkwassers auf die Weise, daß beim
Teigbereiten auf 5 Pfund Mehl 1 Pfund kalk-
gesättigtes, ganz klares Kalkwasser zugeseht wurde.
Zuerst wird nach Liebigs Vorschrift das Kalkwasser
genommen, darauf erst das zur Teigbildung nötige
weitere gewöhnliche Wasser; bei frischem Sauerteig
empfiehlt es sich, weniger, bei alten: aber mehr
Kalkwasser zu nehmen. Durch Hinzufügen von Kalk-
wasser wird die Säurebildung in: Brotteig und
damit im Schwarzbrot eine Hauptursache von un-
angenehmen Verdauungsstörungen beseitigt. Da-
durch wird der einzig wahre Grund, der für leichtere
Verdaulichkeit des Weißbrotes angeführt werden
kann, aufgehoben. Der Kalk bildet zuletzt nut der freien Phosphorsäure
des Mehls eine gewisse Menge phosphorsauren Kalkes — Knochenerde —,
dessen Mangel in den meisten Brotsorten als Ursache gilt, daß Tiere,
die man ausschließlich damit zu füttern suchte, nicht am Leben blieben.
Das auf die angegebene Art mit Kalkwasser zubereitete Brot ist leichter
verdaulich, säurefrei, fest, elastisch, kleinblasig, nicht wasserrandig und bei
etwas größerem Zusatz von Salz von angenehmem Geschmack. Die
Masse des Kalkwassers kann bei 19 Pfund Mehl auf 5 Pfund erhöht
werden; nur wird dann der Salzzusatz größer sein müssen.
Nach Liebig berichtete b>r. Benecke über die günstigen Erfolge, die
durch Verabreichung phosphorsauren Kalkes an skrofulösen Kindern
beobachtet wurden.
Eine andere Art, Süurebildungen im Brot zu vermeiden und die
Verdaulichkeit dadurch zu verbessern, kau: um 1860 auf. Statt gesäuertes
Brot wurde „durchlüftetes Brot" zu machen versucht. Sauerteig oder
Hefe werden beim Brotbacken angewendet, um durch Entwicklung von
Kohlensäure, wie sie bei allen Gärungsvorgüngen stattfindet, die Teig-
masse aufzutreiben, das Brot locker zu machen. Die Entwicklung der
Kohlensäure auf diesen: Wege geschieht aber auf Kosten wesentlicher
Nahrungsstoffe des Mehls; ein Teil der Stärke und des Klebers zersetzen
sich in Ammoniak und Kohlensäure. Die vier- bis fünfstündige Gärung
verursacht unter gleichzeitiger Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit
gewisse andere chemische Veränderungen und Verschlechterungen der
Mehlbestandteile; so wird Stärke in Dextrin umgewandelt.
Wenn die Durchlüftung der Brotmasse durch Freiwerden von Kohlen-
säure bei der Gärung erfolgte, lag es nahe, den Versuch zu machen, statt
Gärungserreger reine Kohlensäure auf mechanischen: Weg einzuführen.