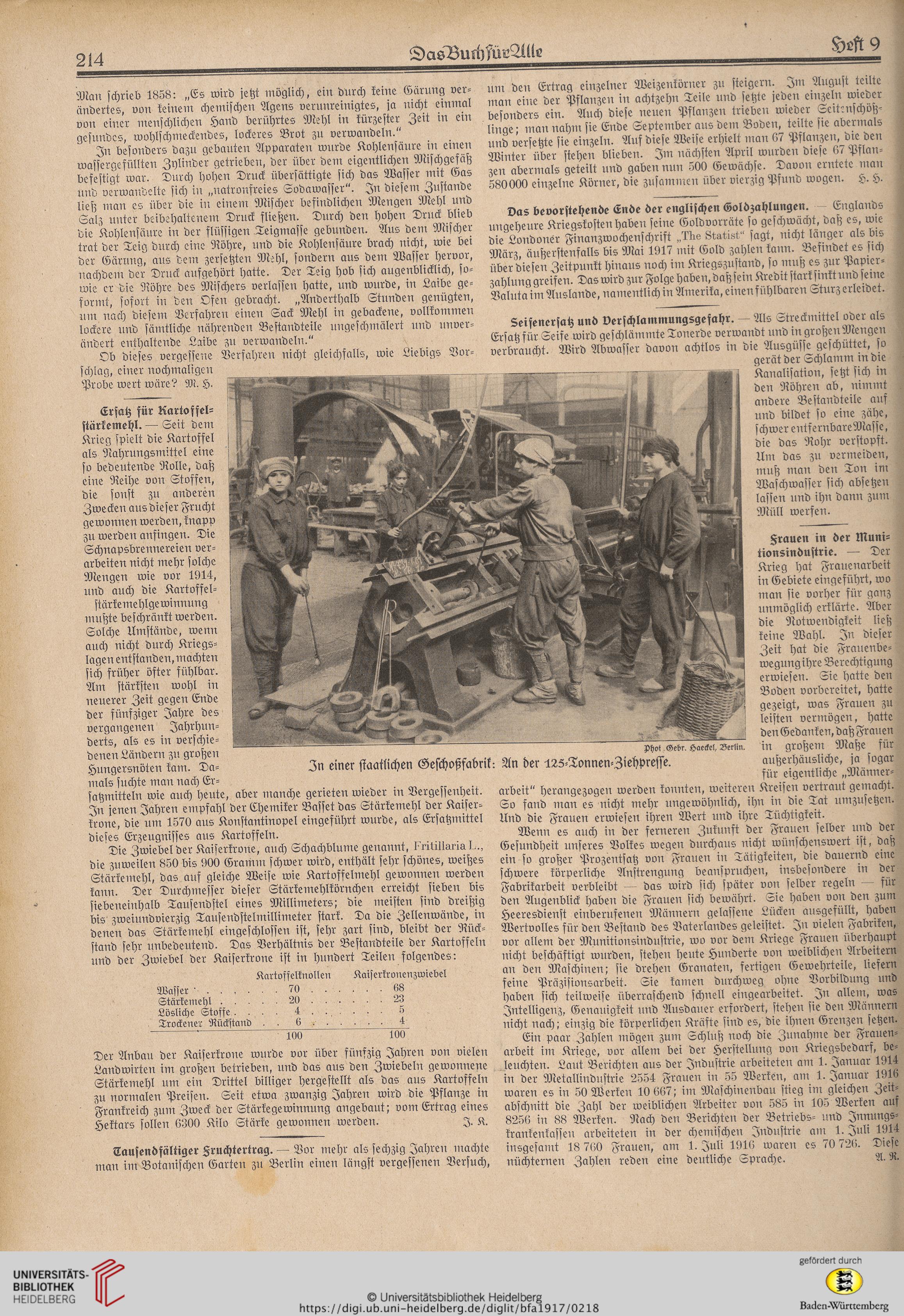214
DasBuchsürAlte
Hefty
Man schrieb 1858: „Es wird jetzt möglich, ein durch keine Gärung ver-
ändertes, von keinem chemischen Agens verunreinigtes, ja nicht einmal
von einer menschlichen Hand berührtes Mehl in kürzester Zeit irr ein
gesundes, wohlschmeckendes, lockeres Brot Zu verwandeln."
In besonders dazu gebauten Apparaten wurde Kohlensäure irr einen
wassergefüllten Zylinder getrieben, der über dem eigentlichen Mischgefäß
befestigt war. Durch hohen Druck übersättigte sich das Wasser mit Gas
und verwandelte sich in „natronfreies Sodawasser". In diesem Zustande
ließ inan es über die in einem Mischer befindlichen Mengen Mehl und
Salz unter beibehaltenem Druck fließen. Durch den hohen Druck blieb
die Kohlensäure in der flüssigen Teigmasse gebunden. Aus den: Mischer
trat der Teig durch eine Nähre, und die Kohlensäure brach nicht, wie bei
der Gärung, aus dein zersetzten Mehl, sondern aus dem Wasser hervor,
nachdem der Druck aufgehört hatte. Der Teig hob sich augenblicklich, so-
wie er die Röhre des Mischers verlassen hatte, und wurde, in Laibe ge-
formt, sofort in den Ofen gebracht. „Anderthalb Stunden genügten,
um nach diesem Verfahren einen Sack Mehl in gebackene, vollkommen
lockere und sämtliche nährenden Bestandteile ungeschmälert und unver-
ändert enthaltende Laibe zu verwandeln."
Ob dieses vergessene Verfahren nicht gleichfalls, wie Liebigs Vor-
schlag, einer nochmaligen
Probe wert wäre? M. H.
Ersatz für Rartoffel-
stärkemehl. — Seit dem
Krieg spielt die Kartoffel
als Nahrungsmittel eine
so bedeutende Rolle, daß
eine Reihe von Stoffen,
die sonst Zu anderen
Zwecken aus dieser Frucht
gewonnen werden, knapp
zu werden anfingen. Die
Schnapsbrennereien ver¬
arbeiten nicht mehr solche
Mengen wie vor 1914,
und auch die Kartoffel-
stärkemehlge winnung
mußte beschränkt werden.
Solche Umstände, wenn
auch nicht durch Kriegs¬
lagen entstanden, machten
sich früher öfter fühlbar.
Am stärksten wohl in
neuerer Zeit gegen Ende
der fünfziger Jahre des
vergangenen Jahrhun¬
derts, als es in verschie¬
denen Ländern zu großen
Hungersnöten kam. Da¬
mals suchte man nach Er-
satzmitteln wie auch heute, aber manche gerieten wieder in Vergessenheit.
In jenen Jahren empfahl der Chemiker Basset das Stärkemehl der Kaiser-
krone, die um 1570 aus Konstantinopel eingeführt wurde, als Ersatzmittel
dieses Erzeugnisses aus Kartoffeln.
Die Zwiebel der Kaiserkrone, auch Schachblume genannt, britillariM.,
die zuweilen 850 bis 900 Gramm schwer wird, enthält sehr schönes, weißes
Stärkemehl, das auf gleiche Weise wie Kartoffelmehl gewonnen werden
kann. Der Durchmesser dieser Stärkemehlkörnchen erreicht sieben bis
siebeneinhalb Tausendstel eines Millimeters; die meisten sind dreißig
bis zweiundvierzig Tausendstelmillimeter stark. Da die Zellenwände, in
denen das Stärkemehl eingeschlossen ist, sehr zart sind, bleibt der Rück-
stand sehr unbedeutend. Das Verhältnis der Bestandteile der Kartoffeln
und der Zwiebel der Kaiserkrone ist in hundert Teilen folgendes:
Kartoffelknollen Kaisertronenzroiebel
Wasser '.70.68
Stärkemehl.20.23
Lösliche Stoffe.... 4 ..... . 8
Trockener Rückstand . . 6.4
100 DM
Der Anbau der Kaiserkrone wurde vor über fünfzig Jahren von vielen
Landwirten im großen betrieben, und das aus den Zwiebeln gewonnene
Stärkemehl um ein Drittel billiger hergestellt als das aus Kartoffeln
zu normalen Preisen. Seit etwa Zwanzig Jahren wird die Pflanze in
Frankreich zum Zweck der Stärkegewinnung angebaut; vom Ertrag eines
Hektars sollen 6300 Kilo Stärke gewonnen werden. I. K.
Tausendfältiger Sruchtertrag. — Vor mehr als sechzig Jahren machte
man im Botanischen Garten zu Berlin einen längst vergessenen Versuch,
um den Ertrag einzelner Weizenkörner zu steigern. Im August teilte
man eine der Pflanzen in achtzehn Teile und setzte jeden einzeln wieder
besonders ein. Auch diese neuen Pflanzen trieben wieder Seitenschöß-
linge; man nahm sie Ende September aus dem Boden, teilte sie abermals
und versetzte sie einzeln. Auf diese Weise erhielt man 67 Pflanzen, die den
Winter über stehen blieben. Im nächsten April wurden diese 67 Pflan-
zen abermals geteilt und gaben nun 500 Gewächse. Davon erntete man
580000 einzelne Körner, die zusammen über vierzig Pfund wogen. H. H.
Das bevorstehende Ende der englischen Goldzahlungen. Englands
ungeheure Kriegskostenhaben seine Goldvorräte so geschwächt, daß es, wie
die Londoner Finanzwochenschrift „Düs Statist" sagt, nicht länger als bis
März, äußerstenfalls bis Mai 1917 mit Gold zahlen kann. Befindet es sich
über diesen Zeitpunkt hinaus noch im Kriegszustand, so muß es zur Papier-
zahlung greifen. Das wird zur Folge haben, daß sein Kredit stark sinkt und seine
Valuta im Auslande, namentlich in Amerika, einen fühlbaren Sturz erleidet.
Seifenersatz und Verschlammungsgefahr. — Als Streckmittel oder als
Ersatz für Seife wird geschlämmte Tonerde verwandt und in großen Mengen
verbraucht. Wird Abwasser davon achtlos in die Ausgüsse geschüttet, so
gerät der Schlamm in die
Kanalisation, setzt sich in
den Röhren ab, nimmt
andere Bestandteile auf
und bildet so eine zähe,
schwer entfernbareMasse,
die das Rohr verstopft.
Um das zu vermeiden,
muß man den Ton im
Waschwasser sich absetzen
lassen und ihn dann zum
Müll werfen.
Zrauen in der Muni-
tionsindustrie. — Der
Krieg hat Frauenarbeit
in Gebiete eingeführt, wo
man sie vorher für ganz
unmöglich erklärte. Aber
die Notwendigkeit ließ
keine Wahl. In dieser
Zeit hat die Frauenbe-
wegung ihre Berechtigung
erwiesen. Sie hatte den
Boden vorbereitet, hatte
gezeigt, was Frauen zu
leisten vermögen, hatte
den Gedanken, daß Frauen
in großem Maße für
außerhäusliche, ja sogar
für eigentliche „Männer-
arbeit" herangezogen werden konnten, weiteren Kreisen vertraut gemacht.
So faud man es nicht mehr ungewöhnlich, ihn in die Tat umzusetzen.
Und die Frauen erwiesen ihren Wert und ihre Tüchtigkeit.
Wenn es auch in der ferneren Zukunft der Frauen selber und der
Gesundheit unseres Volkes wegen durchaus nicht wünschenswert ist, daß
ein so großer Prozentsatz von Frauen in Tätigkeiten, die dauernd eine
schwere körperliche Anstrengung beanspruchen, insbesondere in der
Fabrikarbeit verbleibt - das wird sich später von selber regeln — für
den Augenblick haben die Frauen sich bewährt. Sie haben von den zum
Heeresdienst einberufenen Männern gelassene Lücken ausgefüllt, haben
Wertvolles für den Bestand des Vaterlandes geleistet. In vielen Fabriken,
vor allem der Munitionsindustrie, wo vor dem Kriege Frauen überhaupt
nicht beschäftigt wurden, stehen heute Hunderte von weiblichen Arbeitern
an den Maschinen; sie drehen Granaten, fertigen Gewehrteile, liefern
feine Präzisionsarbeit. Sie kamen durchweg ohne Vorbildung und
haben sich teilweise überraschend schnell eingearbeitet. In allem, was
Intelligenz, Genauigkeit und Ausdauer erfordert, steheu sie den Männern
nicht nach; einzig die körperlichen Kräfte sind es, die ihnen Grenzen setzen.
Ein paar Zahlen mögen zum Schluß noch die Zunahme der Frauen-
arbeit im Kriege, vor allem bei der Herstellung von Kriegsbedarf, be-
leuchten. Laut Berichten aus der Industrie arbeiteten am 1. Januar 1914
in der Metallindustrie 2554 Frauen in 55 Werken, am 1. Januar 1916
waren es in 50 Werken 10 667; im Maschinenbau stieg im gleichen Zeit-
abschnitt die Zahl der weiblichen Arbeiter von 585 in 105 Werken auf
8256 in 88 Werken. Nach den Berichten der Betriebs- und Innungs-
krankenkassen arbeiteten in der chemischen Industrie am I.Juli 1914
insgesamt 18 760 Frauen, am I.Juli 1916 waren es 70 726. Diese
nüchternen Zahlen reden eine deutliche Sprache. A. R.
Phot Gebr. Haeckel, Berlin.
In einer staatlichen Geschoßfabrik: An der 42S-Tonnen-Ziehpresse.
DasBuchsürAlte
Hefty
Man schrieb 1858: „Es wird jetzt möglich, ein durch keine Gärung ver-
ändertes, von keinem chemischen Agens verunreinigtes, ja nicht einmal
von einer menschlichen Hand berührtes Mehl in kürzester Zeit irr ein
gesundes, wohlschmeckendes, lockeres Brot Zu verwandeln."
In besonders dazu gebauten Apparaten wurde Kohlensäure irr einen
wassergefüllten Zylinder getrieben, der über dem eigentlichen Mischgefäß
befestigt war. Durch hohen Druck übersättigte sich das Wasser mit Gas
und verwandelte sich in „natronfreies Sodawasser". In diesem Zustande
ließ inan es über die in einem Mischer befindlichen Mengen Mehl und
Salz unter beibehaltenem Druck fließen. Durch den hohen Druck blieb
die Kohlensäure in der flüssigen Teigmasse gebunden. Aus den: Mischer
trat der Teig durch eine Nähre, und die Kohlensäure brach nicht, wie bei
der Gärung, aus dein zersetzten Mehl, sondern aus dem Wasser hervor,
nachdem der Druck aufgehört hatte. Der Teig hob sich augenblicklich, so-
wie er die Röhre des Mischers verlassen hatte, und wurde, in Laibe ge-
formt, sofort in den Ofen gebracht. „Anderthalb Stunden genügten,
um nach diesem Verfahren einen Sack Mehl in gebackene, vollkommen
lockere und sämtliche nährenden Bestandteile ungeschmälert und unver-
ändert enthaltende Laibe zu verwandeln."
Ob dieses vergessene Verfahren nicht gleichfalls, wie Liebigs Vor-
schlag, einer nochmaligen
Probe wert wäre? M. H.
Ersatz für Rartoffel-
stärkemehl. — Seit dem
Krieg spielt die Kartoffel
als Nahrungsmittel eine
so bedeutende Rolle, daß
eine Reihe von Stoffen,
die sonst Zu anderen
Zwecken aus dieser Frucht
gewonnen werden, knapp
zu werden anfingen. Die
Schnapsbrennereien ver¬
arbeiten nicht mehr solche
Mengen wie vor 1914,
und auch die Kartoffel-
stärkemehlge winnung
mußte beschränkt werden.
Solche Umstände, wenn
auch nicht durch Kriegs¬
lagen entstanden, machten
sich früher öfter fühlbar.
Am stärksten wohl in
neuerer Zeit gegen Ende
der fünfziger Jahre des
vergangenen Jahrhun¬
derts, als es in verschie¬
denen Ländern zu großen
Hungersnöten kam. Da¬
mals suchte man nach Er-
satzmitteln wie auch heute, aber manche gerieten wieder in Vergessenheit.
In jenen Jahren empfahl der Chemiker Basset das Stärkemehl der Kaiser-
krone, die um 1570 aus Konstantinopel eingeführt wurde, als Ersatzmittel
dieses Erzeugnisses aus Kartoffeln.
Die Zwiebel der Kaiserkrone, auch Schachblume genannt, britillariM.,
die zuweilen 850 bis 900 Gramm schwer wird, enthält sehr schönes, weißes
Stärkemehl, das auf gleiche Weise wie Kartoffelmehl gewonnen werden
kann. Der Durchmesser dieser Stärkemehlkörnchen erreicht sieben bis
siebeneinhalb Tausendstel eines Millimeters; die meisten sind dreißig
bis zweiundvierzig Tausendstelmillimeter stark. Da die Zellenwände, in
denen das Stärkemehl eingeschlossen ist, sehr zart sind, bleibt der Rück-
stand sehr unbedeutend. Das Verhältnis der Bestandteile der Kartoffeln
und der Zwiebel der Kaiserkrone ist in hundert Teilen folgendes:
Kartoffelknollen Kaisertronenzroiebel
Wasser '.70.68
Stärkemehl.20.23
Lösliche Stoffe.... 4 ..... . 8
Trockener Rückstand . . 6.4
100 DM
Der Anbau der Kaiserkrone wurde vor über fünfzig Jahren von vielen
Landwirten im großen betrieben, und das aus den Zwiebeln gewonnene
Stärkemehl um ein Drittel billiger hergestellt als das aus Kartoffeln
zu normalen Preisen. Seit etwa Zwanzig Jahren wird die Pflanze in
Frankreich zum Zweck der Stärkegewinnung angebaut; vom Ertrag eines
Hektars sollen 6300 Kilo Stärke gewonnen werden. I. K.
Tausendfältiger Sruchtertrag. — Vor mehr als sechzig Jahren machte
man im Botanischen Garten zu Berlin einen längst vergessenen Versuch,
um den Ertrag einzelner Weizenkörner zu steigern. Im August teilte
man eine der Pflanzen in achtzehn Teile und setzte jeden einzeln wieder
besonders ein. Auch diese neuen Pflanzen trieben wieder Seitenschöß-
linge; man nahm sie Ende September aus dem Boden, teilte sie abermals
und versetzte sie einzeln. Auf diese Weise erhielt man 67 Pflanzen, die den
Winter über stehen blieben. Im nächsten April wurden diese 67 Pflan-
zen abermals geteilt und gaben nun 500 Gewächse. Davon erntete man
580000 einzelne Körner, die zusammen über vierzig Pfund wogen. H. H.
Das bevorstehende Ende der englischen Goldzahlungen. Englands
ungeheure Kriegskostenhaben seine Goldvorräte so geschwächt, daß es, wie
die Londoner Finanzwochenschrift „Düs Statist" sagt, nicht länger als bis
März, äußerstenfalls bis Mai 1917 mit Gold zahlen kann. Befindet es sich
über diesen Zeitpunkt hinaus noch im Kriegszustand, so muß es zur Papier-
zahlung greifen. Das wird zur Folge haben, daß sein Kredit stark sinkt und seine
Valuta im Auslande, namentlich in Amerika, einen fühlbaren Sturz erleidet.
Seifenersatz und Verschlammungsgefahr. — Als Streckmittel oder als
Ersatz für Seife wird geschlämmte Tonerde verwandt und in großen Mengen
verbraucht. Wird Abwasser davon achtlos in die Ausgüsse geschüttet, so
gerät der Schlamm in die
Kanalisation, setzt sich in
den Röhren ab, nimmt
andere Bestandteile auf
und bildet so eine zähe,
schwer entfernbareMasse,
die das Rohr verstopft.
Um das zu vermeiden,
muß man den Ton im
Waschwasser sich absetzen
lassen und ihn dann zum
Müll werfen.
Zrauen in der Muni-
tionsindustrie. — Der
Krieg hat Frauenarbeit
in Gebiete eingeführt, wo
man sie vorher für ganz
unmöglich erklärte. Aber
die Notwendigkeit ließ
keine Wahl. In dieser
Zeit hat die Frauenbe-
wegung ihre Berechtigung
erwiesen. Sie hatte den
Boden vorbereitet, hatte
gezeigt, was Frauen zu
leisten vermögen, hatte
den Gedanken, daß Frauen
in großem Maße für
außerhäusliche, ja sogar
für eigentliche „Männer-
arbeit" herangezogen werden konnten, weiteren Kreisen vertraut gemacht.
So faud man es nicht mehr ungewöhnlich, ihn in die Tat umzusetzen.
Und die Frauen erwiesen ihren Wert und ihre Tüchtigkeit.
Wenn es auch in der ferneren Zukunft der Frauen selber und der
Gesundheit unseres Volkes wegen durchaus nicht wünschenswert ist, daß
ein so großer Prozentsatz von Frauen in Tätigkeiten, die dauernd eine
schwere körperliche Anstrengung beanspruchen, insbesondere in der
Fabrikarbeit verbleibt - das wird sich später von selber regeln — für
den Augenblick haben die Frauen sich bewährt. Sie haben von den zum
Heeresdienst einberufenen Männern gelassene Lücken ausgefüllt, haben
Wertvolles für den Bestand des Vaterlandes geleistet. In vielen Fabriken,
vor allem der Munitionsindustrie, wo vor dem Kriege Frauen überhaupt
nicht beschäftigt wurden, stehen heute Hunderte von weiblichen Arbeitern
an den Maschinen; sie drehen Granaten, fertigen Gewehrteile, liefern
feine Präzisionsarbeit. Sie kamen durchweg ohne Vorbildung und
haben sich teilweise überraschend schnell eingearbeitet. In allem, was
Intelligenz, Genauigkeit und Ausdauer erfordert, steheu sie den Männern
nicht nach; einzig die körperlichen Kräfte sind es, die ihnen Grenzen setzen.
Ein paar Zahlen mögen zum Schluß noch die Zunahme der Frauen-
arbeit im Kriege, vor allem bei der Herstellung von Kriegsbedarf, be-
leuchten. Laut Berichten aus der Industrie arbeiteten am 1. Januar 1914
in der Metallindustrie 2554 Frauen in 55 Werken, am 1. Januar 1916
waren es in 50 Werken 10 667; im Maschinenbau stieg im gleichen Zeit-
abschnitt die Zahl der weiblichen Arbeiter von 585 in 105 Werken auf
8256 in 88 Werken. Nach den Berichten der Betriebs- und Innungs-
krankenkassen arbeiteten in der chemischen Industrie am I.Juli 1914
insgesamt 18 760 Frauen, am I.Juli 1916 waren es 70 726. Diese
nüchternen Zahlen reden eine deutliche Sprache. A. R.
Phot Gebr. Haeckel, Berlin.
In einer staatlichen Geschoßfabrik: An der 42S-Tonnen-Ziehpresse.