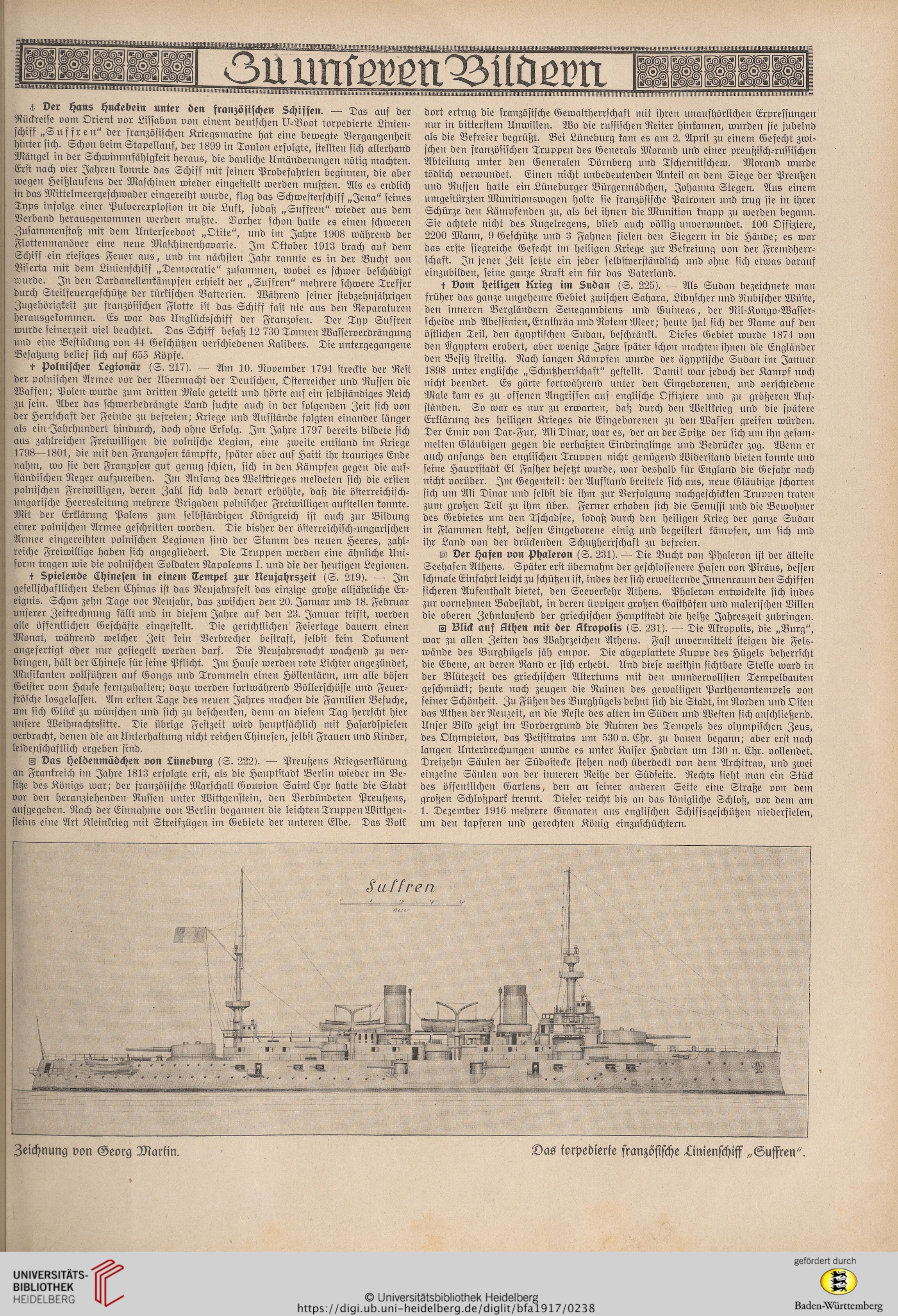WWUUMMM
r Der Hans Huckebein unter den französischen Schiffen. — Das auf der
Rückreise vom Orient vor Lissabon von einem deutschen D-Boot torpedierte Linien-
schiff „Suffren" der französischen Kriegsmarine hat eine bewegte Vergangenheit
hinter sich. Schon beim Stapellauf, der 1899 in Toulon erfolgte, stellten sich allerhand
Mängel in der Schwimmfähigkeit heraus, die bauliche Umänderungen nötig machten.
Erst nach vier Jahren konnte das Schiff mit seinen Probefahrten "beginnen, die aber
wegen Heißlaufens der Maschinen wieder eingestellt werden mußten. Als es endlich
in das Mittelmeergeschwader eingereiht wurde, flog das Schwesterschiff „Jena" seines
Typs infolge einer Pulvererplosion in die Luft, sodaß „Suffren" wieder aus dem
Verband herausgenommen werden mußte. Vorher schon hatte es einen schweren
Zusammenstoß mit dem Unterseeboot „Otite", und im Jahre 1908 während der
Flottenmanöver eine neue Maschinenhavarie. Im Oktober 1913 brach auf dem
Schiff ein riesiges Feuer aus, und im nächsten Jahr rannte es in der Bucht von
Biserta mit dem Linienschiff „Democratie" zusammen, wobei es schwer beschädigt
wurde. In den Dardanellenkämpfen erhielt der „Suffren" mehrere schwere Treffer
durch Steilfeuergeschütze der türkischen Batterien. Während seiner siebzehnjährigen
Zugehörigkeit zur französischen Flotte ist das Schiff fast nie aus den Reparaturen
herausgekommen. Es war das Unglücksschiff der Franzosen. Der Typ Suffren
wurde seinerzeit viel beachtet. Das Schiff besaß 12 730 Tonnen Wasserverdrängung
und eine Bestückung von 44 Geschützen verschiedenen Kalibers. Die untergegangene
Besatzung belief sich auf 655 Köpfe.
1- Polnischer Legionär (S. 217). — Am 10. November 1794 streckte der Rest
der polnischen Armee vor der Übermacht der Deutschen, Österreicher und Russen die
Waffen; Polen wurde zum dritten Male geteilt und hörte auf ein selbständiges Reich
zu sein. Aber das schwerbedrängte Land suchte auch iu der folgenden Zeit sich von
der Herrschaft der Feinde zu befreien; Kriege und Aufstände folgten einander länger
als ein Jahrhundert hindurch, doch ohne Erfolg. Im Jahre 1797 bereits bildete sich
aus zahlreichen Freiwilligen die polnische Legion, eine zweite entstand im Kriege
1798—1801, die mit den Franzosen kämpfte, später aber auf Haiti ihr trauriges Ende
nahm, wo sie den Franzosen gut genug schien, sich in den Kämpfen gegen die auf-
ständischen Neger aufzureiben. Im Anfang des Weltkrieges meldeten sich die ersten
polnischen Freiwilligen, deren Zahl sich bald derart erhöhte, daß die österreichisch-
ungarische Heeresleitung mehrere Brigaden polnischer Freiwilligen aufstellen konnte.
Mit der Erklärung Polens zum selbständigen Königreich ist auch zur Bildung
einer polnischen Armee geschritten worden. Die bisher der österreichisch-ungarischen
Armee eingereihten polnischen Legionen sind der Stamm des neuen Heeres, zahl-
reiche Freiwillige haben sich angegliedert. Die Truppen werden eine ähnliche Uni-
form tragen wie die polnischen Soldaten Napoleons I. und die der heutigen Legionen.
1 Spielende Chinesen in einem Tempel zur Neujahrszeit (S. 219). — Im
gesellschaftlichen Leben Chinas ist das Neujahrsfest das einzige große alljährliche Er-
eignis. Schon zehn Tage vor Neujahr, das zwischen den 20. Januar und 18. Februar
unserer Zeitrechnung fällt und in diesem Jahre auf den 23. Januar trifft, werden
alle öffentlichen Geschäfte eingestellt. Die gerichtlichen Feiertage dauern einen
Monat, während welcher Zeit kein Verbrecher bestraft, selbst kein Dokument
angefertigt oder nur gesiegelt werden darf. Die Neujahrsnacht wachend zu ver-
bringen, hält der Chinese für seine Pflicht. Im Hause werden rote Lichter angezündet,
Musikanten vollführen auf Gongs und Trommeln einen Höllenlärm, um alle bösen
Geister vom Hause fernzuhalten; dazu werden fortwährend Böllerschüsse und Feuer-
frösche losgelassen. Am ersten Tage des neuen Jahres machen die Familien Besuche,
um sich Glück zu wünschen und sich zu beschenken, denn an diesem Tag herrscht hier
unsere Weihnachtssitte. Die übrige Festzeit wird hauptsächlich mit Hasardspielen
verbracht, denen die an Unterhaltung nicht reichen Chinesen, selbst Frauen und Kinder,
leidenschaftlich ergeben sind.
H Das heldemnä-chen von Lüneburg (S. 222). — Preußens Kriegserklärung
an Frankreich im Jahre 1813 erfolgte erst, als die Hauptstadt Berlin wieder im Be-
sitze des Königs war; der französische Marschall Gouvion Saint Cyr hatte die Stadt
vor den heranziehenden Russen unter Wittgenstein, den Verbündeten Preußens,
aufgegeben. Nach der Einnahme von Berlin begannen die leichten Truppen Wittgen-
steins eine Art Kleinkrieg mit Streifzügen im Gebiete der unteren Elbe. Das Volk
dort ertrug die französische Gewaltherrschaft mit ihren unaufhörlichen Erpressungen
nur in bitterstem Unwillen. Wo die russischen Reiter hinkamen, wurden sie jubelnd
als die Befreier begrüßt. Bei Lüneburg kam es am 2. April zu einem Gefecht zwi-
schen den französischen Truppen des Generals Morand und einer preußisch-russischen
Abteilung unter den Generalen Dörnberg und Tschernitschew. Morand wurde
tödlich verwundet. Einen nicht unbedeutenden Anteil an dem Siege der Preußen
und Russen hatte ein Lüneburger Bürgermädchen, Johanna Stegen. Aus einem
umgestürzten Munitionswagen holte sie französische Patronen und trug sie in ihrer
Schürze den Kämpfenden zu, als bei ihnen die Munition knapp zu werden begann.
Sie achtete nicht des Kugelregens, blieb auch völlig unverwundet. 100 Offiziere,
2200 Mann, 9 Geschütze und 3 Fahnen fielen den Siegern in die Hände; es war
das erste siegreiche Gefecht im heiligen Kriege zur Befreiung von der Fremdherr-
schaft. In jener Zeit setzte ein jeder selbstverständlich und ohne sich etwas darauf
einzubilden, seine ganze Kraft ein für das Vaterland.
t vom heiligen Krieg im Sudan (S. 225). — Als Sudan bezeichnete man
früher das ganze ungeheure Gebiet zwischen Sahara, Libyscher und Nubischer Wüste,
den inneren Bergländern Senegambiens und Guineas, der Nil-Kongo-Wasser-
scheide und Abessinien, Erythräa und Rotem Meer; heute hat sich der Name auf den
östlichen Teil, den ägyptischen Sudan, beschränkt. Dieses Gebiet wurde 1874 von
den Ägyptern erobert, aber wenige Jahre später schon machten ihnen die Engländer
den Besitz streitig. Nach langen Kämpfen wurde der ägyptische Sudan im Januar
1898 unter englische „Schutzherrschaft" gestellt. Damit war jedoch der Kampf noch
nicht beendet. Es gärte fortwährend unter den Eingeborenen, und verschiedene
Male kam es zu offenen Angriffen auf englische Offiziere und zu größeren Auf-
ständen. So war es nur zu erwarten, daß durch den Weltkrieg und die spätere
Erklärung des heiligen Krieges die Eingeborenen zu deu Waffeu greifen würden.
Der Emir von Dar-Fur, Ali Dinar, war es, der an der Spitze der sich um ihn gesam-
melten Gläubigen gegen die verhaßten Eindringlinge und Bedrücker zog. Wenn er
auch anfangs den englischen Truppen nicht genügend Widerstand bieten konnte und
seine Hauptstadt El Facher besetzt wurde, war deshalb für England die Gefahr noch
nicht vorüber. Im Gegenteil: der Aufstand breitete sich aus, neue Gläubige scharten
sich um Ali Dinar und selbst die ihm zur Verfolgung nachgeschickten Truppen traten
zum großen Teil zu ihm über. Ferner erhoben sich die Senussi und die Bewohner
des Gebietes um den Tschadsee, sodaß durch den heiligen Krieg der ganze Sudan
in Flammen steht, dessen Eingeborene einig und begeistert kämpfen, um. sich uud
ihr Land von der drückenden Schutzherrschaft zu befreien.
Der Hafen von phaleron (S. 231). — Die Bucht von Phaleron ist der älteste
Seehafen Athens. Später erst übernahm der geschlossenere Hafen von Piräus, dessen
schmale Einfahrt leicht zu schützen ist, indes der sich erweiternde Jnnenraum den Schiffen
sicheren Aufenthalt bietet, den Seeverkehr Athens. Phaleron entwickelte sich indes
zur vornehmen Badestadt, in deren üppigen großen Gasthöfen und malerischen Villen
die oberen Zehntausend der griechischen Hauptstadt die heiße Jahreszeit zubringeu.
IZ Blick auf Athen mit der Akropolis (S. 231). — Die Akropolis, die „Burg",
war zu allen Zeiten das Wahrzeichen Athens. Fast unvermittelt steigen die Fels-
wände des Burghügels jäh empor. Die abgeplattete Kuppe des Hügels beherrscht
die Ebene, an deren Rand er sich erhebt. Und diese weithin sichtbare Stelle ward in
der Blütezeit des griechischen Altertums mit den wundervollsten Tempelbauten
geschmückt; heute noch zeugen die Ruinen des gewaltigen Parthenontempels von
seiner Schönheit. Zu Füßen des Burghügels dehnt sich die Stadt, im Norden und Osten
das Athen der Neuzeit, an die Reste des alten im Süden und Westen sich anschließend.
Unser Bild zeigt im Vordergrund die Ruinen des Tempels des olympischen Zeus,
des Olympieion, das Peisistratos um 530 v. Ehr. zu bauen begann; aber erst nach
langen Unterbrechungen wurde es unter Kaiser Hadrian um 130 n. Ehr. vollendet.
Dreizehn Säulen der Südostecke stehen noch überdeckt von dem Architrav, und zwei
einzelne Säulen von der inneren Reihe der Südseite. Rechts sieht man ein Stück
des öffentlichen Gartens, den an seiner anderen Seite eine Straße von dem
großen Schloßpark trennt. Dieser reicht bis an das königliche Schloß, vor dem am
1. Dezember 1916 mehrere Granaten aus englischen Schiffsgeschützen niederfielen,
um den tapferen und gerechten König einzuschüchtern.
Zeichnung von Georg Martin.
Das torpedierte französische Linienschiff „Suffren".