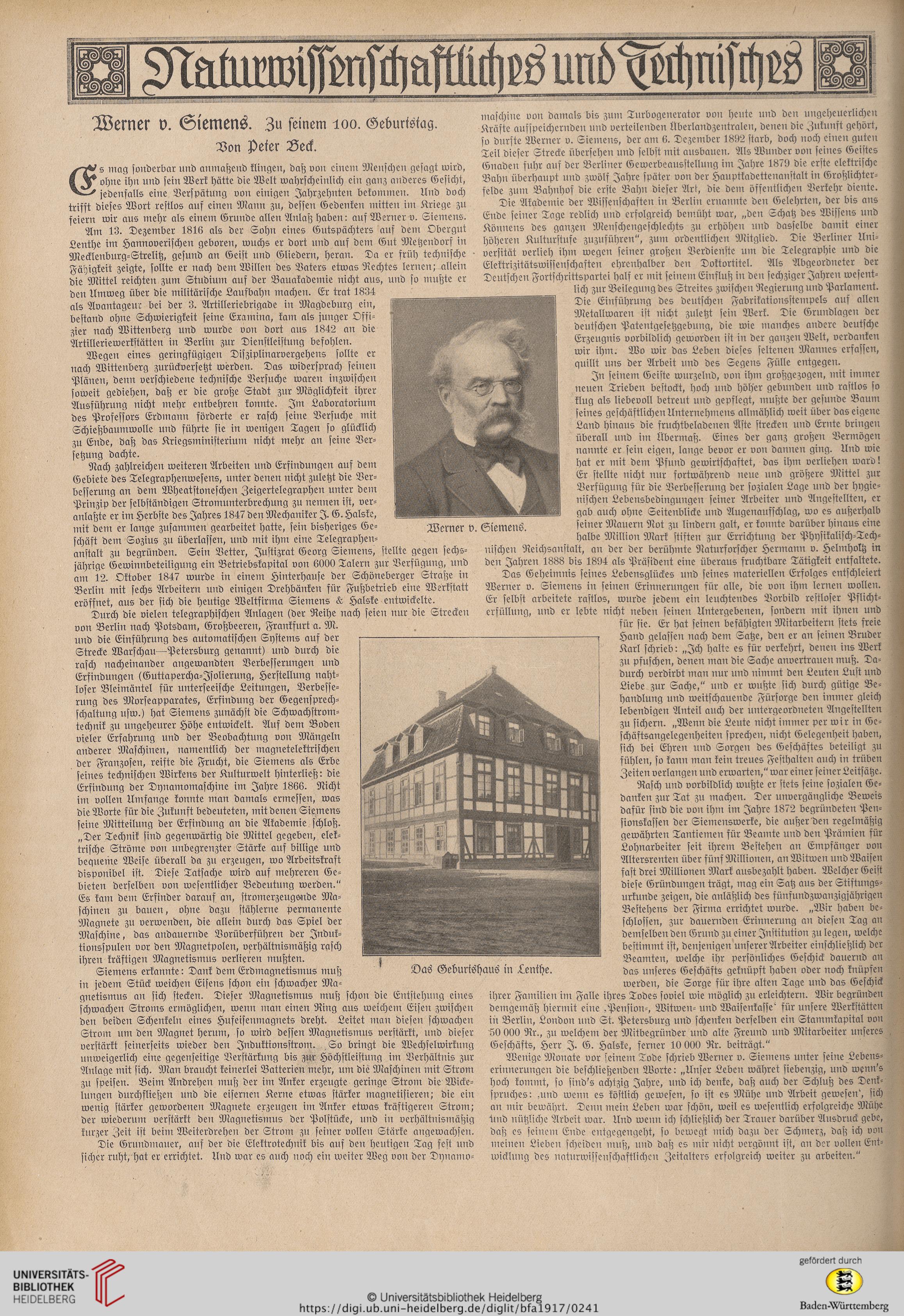Werner v. Siemens. Zu seinem KOO. Geburtstag.
Von Peter Leck.
s mag sonderbar und anmatzend klingen, datz von einem Menschen gesagt wird,
ohne ihn und sein Werk hätte die Welt wahrscheinlich ein ganz anderes Gesicht,
jedenfalls eine Verspätung von einigen Jahrzehnten bekommen. Und doch
trifft dieses Wort restlos auf einen Mann zu, dessen Gedenken mitten im Kriege zu
feiern wir aus mehr als einem Grunde allen Anlah haben: auf Weruer v. Siemens.
Am 13. Dezember 1816 als der Sohn eines Gutspächters auf dem Obergut
Lenthe im Hannoverischen geboren, wuchs er dort uud auf den: Gut Metzendorf in
Mecklenburg-Strelih, gesund an Geist und Gliedern, heran. Da er früh technische -
Fähigkeit zeigte, sollte er nach dem Willen des Vaters etwas Rechtes lernen; allein
die Mittel reichten zum Studium auf der Bauakademie uicht aus, und so mutzte er
den Umweg über die militärische Laufbahn machen. Er trat 1834
als Avantageur bei der 3. Artilleriebrigade in Magdeburg ein,
bestand ohne Schwierigkeit seine Erainina, kam als junger Offi¬
zier nach Wittenberg und wurde vou dort aus 1842 an die
Artilleriewerkstätten in Berlin zur Dienstleistung befohlen.
Wegen eines geringfügigen Disziplinarvergehens sollte er
nach Wittenberg zurückversetzt werden. Das widersprach seinen
Plänen, denn verschiedene technische Versuche waren inzwischen
soweit gediehen, datz er die grotze Stadt zur Möglichkeit ihrer
Ausführung nicht mehr entbehren konnte. Jin Laboratorium
des Professors Erdmann förderte er rasch seine Versuche mit
Schietzbaumwolle und führte sie in wenigen Tagen so glücklich
zu Ende, datz das Kriegsministerium nicht mehr an seine Ver-
setzung dachte.
Nach zahlreichen weiteren Arbeiten und Erfindungen auf dem
Gebiete des Telegraphenwesens, unter denen nicht zuletzt die Ver-
besserung an dem Wheatstoneschen Zeigertelegraphen unter dein
Prinzip der selbständigen Stromunterbrechung zu nennen ist, ver-
anlatzte er im Herbste des Jahres 1847 den Mechaniker I. G. Halske,
mit dem er lange zusammen gearbeitet hatte, sein bisheriges Ge-
schäft dem Sozius zu überlassen, und mit ihn: eine Telegraphen¬
anstalt zu begründen. Sein Vetter, Justizrat Georg Siemens, stellte gegen sechs-
jährige Gewinnbeteiligung ein Betriebskapital von 6000 Talern zur Verfügung, und
mn 12. Oktober 1847 wurde in einein Hinterhause der Schöneberger Stratze in
Berlin mit sechs Arbeitern und einigen Drehbänken für Futzbetrieb eine Werkstatt
eröffnet, aus der sich die heutige Weltfirma Siemens L Halske entwickelte.
Durch die vielen telegraphischen Anlagen (der Reihe nach seien nur die Strecken
von Berlin nach Potsdam, Grotzbeeren, Frankfurt a. M.
uud die Einführung des automatischen Systems auf der
Strecke Warschau—Petersburg genannt) und durch die
rasch nacheinander angewandten Verbesserungen und
Erfindungen (Guttapercha-Isolierung, Herstellung naht¬
loser Bleimäntel für unterseeische Leitungen, Verbesse¬
rung des Morseapparates, Erfindung der Gegensprech¬
schaltung usw.) hat Siemens zunächst die Schwachstrom¬
technik zu ungeheurer Höhe entwickelt. Auf dem Boden
vieler Erfahrung und der Beobachtung von Mängeln
anderer Maschinen, namentlich der magnetelektrischen
der Franzosen, reifte die Frucht, die Siemens als Erbe
seines technischen Wirkens der Kulturwelt hinterlietz: die
Erfindung der Dynamomaschine im Jahre 1866. Nicht
im vollen Umfange konnte inan damals ermessen, was
die Worte für die Zukunft bedeuteten, mit denen Siemens
seine Mitteilung der Erfindung an die Akademie schlotz.
„Der Technik sind gegenwärtig die Mittel gegeben, elek¬
trische Ströme von unbegrenzter Stärke auf billige und
bequeme Weise überall da zu erzeugen, wo Arbeitskraft
disponibel ist. Diese Tatsache wird auf mehreren Ge¬
bieten derselben von wesentlicher Bedeutung werden."
Es kam dem Erfinder darauf au, stromerzeugsude Ma¬
schinen zu baueu, ohne dazu stählerue permanente
Magnete zu verwenden, die allein durch das Spiel der
Maschine, das andauernde Vorüberführen der Induk¬
tionsspulen vor den Magnetpolen, verhältnismäßig rasch
ihren kräftigen Magnetismus verlieren mutzten.
Siemens erkannte: Dank dem Erdmagnetismus mutz
in jedem Stück weichen Eisens schon ein schwacher Ma¬
gnetismus an sich stecken. Dieser Magnetismus mutz schon die Entstehung eines
schwachen Stroms ermöglichen, wenn man einen Ring aus weichem Eisen zwischen
den beiden Schenkeln eines Hufeisenmagnets dreht. Leitet inan diesen schwachen
Strom um den Magnet herum, so wird dessen Magnetismus verstärkt, und dieser
verstärkt seinerseits wieder den Jnduktionsstrom. So bringt die Wechselwirkung
unweigerlich eine gegenseitige Verstärkung bis zur Höchstleistung im Verhältnis zur
Anlage mit sich. Man braucht keinerlei Batterien mehr, um die Maschinen mit Strom
zu speisen. Beim Andrehen mutz der im Anker erzeugte geringe Strom die Wicke-
lungen durchflietzen und die eisernen Kerne etwas stärker magnetisieren; die ein
wenig stärker gewordenen Magnete erzeugen im Anker etwas kräftigeren Strom;
der wiederum verstärkt deu Magnetismus der Polstücke, und in verhältnismässig
kurzer Zeit ist beim Weiterdrehen der Strom zu seiner vollen Stärke angewachsen.
Die Grundmauer, auf der die Elektrotechnik bis auf deu heutigeu Tag fest uud
sicher ruht, hat er errichtet. Und war es auch noch ein weiter Weg von der Dynamo¬
maschine von damals bis zum Turbogenerator von heute und den ungeheuerlichen
Kräfte aufspeichernden und verteilenden Uberlandzentralen, denen die Zukunft gehört,
so durfte Weruer v. Siemens, der am 6. Dezember 1892 starb, doch noch einen guten
Teil dieser Strecke übersehen und selbst mit ausbauen. Als Wunder von seines Geistes
Gnaden fuhr auf der Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1879 die erste elektrische
Bahn überhaupt uud zwölf Jahre später vou der Hauptkadetteuaustalt in Erotzlichter-
felde zum Bahnhof die erste Bahn dieser Art, die dem öffentlichen Verkehr diente.
Die Akademie der Wissenschaften in Berlin ernannte den Gelehrten, der bis ans
Ende seiner Tage redlich uud erfolgreich bemüht war, „den Schatz des Wissens und
Könnens des ganzen Menschengeschlechts zu erhöhen uud dasselbe damit einer-
höheren Kulturstufe zuzuführeu", zum ordentlichen Mitglied. Die Berliner Uni-
versität verlieh ihm wegen seiner grotzen Verdienste um die Telegraphie und die
Elektrizitätswissenschaften ehrenhalber den Doktortitel. Als Abgeordneter der
Deutschen Fortschrittspartei half er mit seinem Einflutz in den sechziger Jahren wesent-
lich zur Beilegung des Streites zwischen Regierung und Parlament.
Die Einführung des deutschen. Fabrikationsstempels auf allen
Metallwaren ist nicht zuletzt sein Werk. Die Grundlagen der
deutschen Pateutgesetzgebung, die wie manches andere deutsche
Erzeugnis vorbildlich geworden ist in der ganzen Welt, verdanken
wir ihm. Wo wir das Leben dieses seltenen Mannes erfassen,
quillt uns der Arbeit und des Segens Fülle entgegen.
In seinem Geiste wurzelnd, von ihm grotzgezogen, mit immer
neuen Trieben bestockt, hoch und höher gebunden und rastlos so
klug als liebevoll betreut uud gepflegt, mutzte der gesunde Baum
seines geschäftlichen Unternehmens allmählich weit über das eigene
Land hinaus die fruchtbeladenen Aste strecken und Ernte bringen
überall und im Ubermatz. Eines der ganz grotzen Vermögen
nannte er sein eigen, lange bevor er von dannen ging. Und wie
hat er mit dein Pfund gewirtschaftet, das ihm verliehen ward!
Er stellte nicht nur fortwährend neue uud grötzere Mittel zur
Verfügung für die Verbesserung der sozialen Lage und der hygie-
nischen Lebensbedingungen seiner Arbeiter und Angestellten, er
gab auch ohue Seiteublicke und Augenaufschlag, wo es autzerhalb
seiuer Mauern Not zu lindern galt, er konnte darüber hinaus eine
halbe Million Mark stiften zur Errichtung der Physikalisch-Tech-
nischen Reichsanstalt, an der der berühmte Naturforscher Hermann v. Helmholtz in
den Jahren 1888 bis 1894 als Präsident eine überaus fruchtbare Tätigkeit entfaltete.
Das Geheimnis seines Lebensglückes und seines materiellen Erfolges entschleiert
Werner v. Siemens in seinen Erinnerungen für alle, die von ihm lernen wollen.
Er selbst arbeitete rastlos, wurde jedem ein leuchtendes Vorbild restloser Pflicht-
erfüllung, und er lebte nicht neben seinen Untergebenen, sondern mit ihnen und
für sie. Er hat seinen befähigten Mitarbeitern stets freie
Hand gelassen nach dem Satze, den er an seinen Bruder
Karl schrieb: „Ich halte es für verkehrt, denen ins Werk
zu pfuschen, denen man die Sache anvertrauen mutz. Da-
durch verdirbt mau nur und nimmt den Leuten Lust und
Liebe zur Sache," und er wutzte sich durch gütige Be-
handlung und weitschauende Fürsorge den immer gleich
lebendigen Anteil auch der untergeordneten Angestellten
zu sichern. „Wenn die Leute nicht immer per wir in Ge-
schäftsangelegenheiten sprechen, nicht Gelegenheit haben,
sich bei Ehren und Sorgen des Geschäftes beteiligt zu
fühlen, so kann man kein treues Festhalten auch in trüben
Zeiten verlangen und erwarten," war einer seiner Leitsätze.
Rasch und vorbildlich wutzte er stets seine sozialen Ge-
danken zur Tat zu machen. Der unvergängliche Beweis
dafür sind die von ihn: im Jahre 1872 begründeten Pen-
sionskassen der Siemenswerke, die außer den regelmätzig
gewährten Tantiemen für Beamte und den Prämien für
Lohnarbeiter seit ihrem Bestehen an Empfänger von
Altersrenten über fünf Millionen, an Witwen und Waisen
fast drei Millionen Mark ausbezahlt haben. Welcher Geist
diese Gründungen trügt, mag ein Satz aus der Stiftungs-
urkuude zeigen, die anlätzlich des fünfundzwanzigjährigen
Bestehens der Firma errichtet wurde. „Wir haben be-
schlossen, zur dauerudeu Erinnerung an diesen Tag an
demselben den Grund zu eiuer Institution zu legeu, welche
bestimmt ist, denjenigen unserer Arbeiter einschliesslich der
Beamten, welche ihr persönliches Geschick dauernd an
das unseres Geschäfts geknüpft haben oder noch knüpfen
werden, die Sorge für ihre alten Tage und das Geschick
ihrer Familien im Falle ihres Todes soviel wie möglich zu erleichtern. Wir begründen
demgemäß hiermit eine .Pension-, Witwen- und Waisenkasse' für unsere Werkstätten
in Berlin, London und St. Petersburg uud schenkeu derselben ein Stammkapital von
60 000 Rr., zu welchem der Mitbegründer und alte Freund und Mitarbeiter unseres
Geschäfts, Herr I. G. Halske, ferner 10 000 Rr. beitrügt."
Wenige Monate vor seinen: Tode schrieb Werner v. Siemens unter seine Lebens-
erinnerungen die beschließenden Worte: „Unser Leben währet siebenzig, und wenn's
hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und ich denke, datz auch der Schluß des Denk-
spruches: ,und wenn es köstlich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen', sich
an mir bewährt. Denn mein Leben war schön, weil es wesentlich erfolgreiche Mühe
lind nützliche Arbeit war. Und wenn ich schließlich der Trauer darüber Ausdruck gebe,
datz es seinem Ende entgegengeht, so bewegt mich dazu der Schmerz, datz ich von
meinen Lieben scheiden mutz, uud datz es mir uicht vergönnt ist, an der vollen Ent-
wicklung des naturwissenschaftlichen Zeitalters erfolgreich weiter zu arbeiten."
Werner v. Siemens.