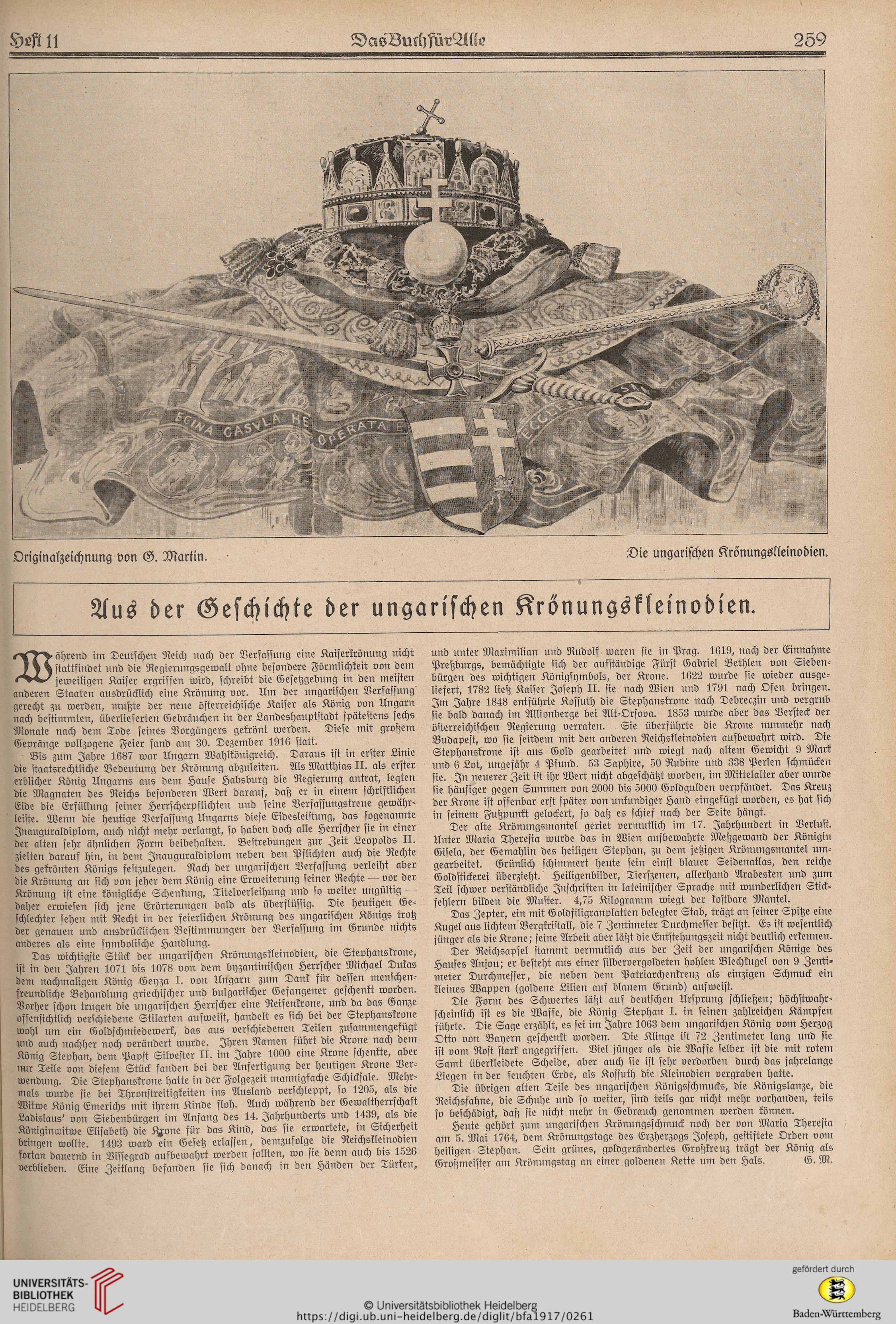Hrst 11
Originalzeichnung von G. Martin. Die ungarischen Krönungslleinodien.
Aus der Geschichte der ungarischen Krönungskleinodien.
ährend im Deutschen Reich nach der Verfassung eine Kaiserkrönung nicht
stattfindet und die Regierungsgewalt ohne besondere Förmlichkeit von dem
jeweiligen Kaiser ergriffen wird, schreibt die Gesetzgebung in den meisten
anderen Staaten ausdrücklich eine Krönung vor. Um der ungarischen Verfassung
gerecht zu werden, mutzte der neue österreichische Kaiser als König von Ungarn
nach bestimmten, überlieferten Gebräuchen in der Landeshauptstadt spätestens sechs
Monate nach dem Tode seines Vorgängers gekrönt werden. Diese mit grotzem
Gepränge vollzogene Feier fand am 30. Dezember 1916 statt.
Bis zum Jahre 1687 war Ungarn Wahlkönigreich. Daraus ist in erster Linie
die staatsrechtliche Bedeutung der Krönung abzuleiten. Als Matthias II. als erster
erblicher König Ungarns aus dem Hause Habsburg die Regierung antrat, legten
die Magnaten des Reichs besonderen Wert darauf, datz er in einem schriftlichen
Eide die Erfüllung seiner Herrscherpflichten und seine Verfassungstreue gewähr-
leiste. Wenn die heutige Verfassung Ungarns diese Eidesleistung, das sogenannte
Jnauguraldiplom, auch nicht mehr verlangt, so haben doch alle Herrscher sie in einer
der alten sehr ähnlichen Form beibehalten. Bestrebungen zur Zeit Leopolds II.
zielten darauf hin, in dem Jnauguraldiplom neben den Pflichten auch die Rechte
des gekrönten Königs festzulegen. Nach der ungarischen Verfassung verleiht aber
die Krönung an sich von jeher dem König eine Erweiterung seiner Rechte — vor der
Krönung ist eine königliche Schenkung, Titelverleihung und so weiter ungültig —
daher erwiesen sich jene Erörterungen bald als überflüssig. Die heutigen Ge-
schlechter sehen mit Recht in der feierlichen Krönung des ungarischen Königs trotz
der genauen und ausdrücklichen Bestimmungen der Verfassung im Grunde nichts
anderes als eine symbolische Handlung.
Das wichtigste Stück der ungarischen Krönungskleinodien, die Stephanskrone,
ist in den Jahren 1071 bis 1078 von dem byzantinischen Herrscher Michael Dukas
dem nachmaligen König Geyza I. von Ungarn zum Dank für dessen menschen-
freundliche Behandlung griechischer und bulgarischer Gefangener geschenkt worden.
Vorher schon trugen die ungarischen Herrscher eine Reifenkrone, und da das Ganze
offensichtlich verschiedene Stilarten aufweist, handelt es sich bei der Stephanskrone
wohl um ein Goldschmiedewerk, das aus verschiedenen Teilen zusammengefügt
und auch nachher noch verändert wurde. Ihren Namen führt die Krone nach dem
König Stephan, dem Papst Silvester II. im Jahre 1000 eine Krone schenkte, aber
nur Teile von diesem Stück fanden bei der Anfertigung der heutigen Krone Ver-
wendung. Die Stephanskrone hatte in der Folgezeit mannigfache Schicksale. Mehr-
mals wurde sie bei Thronstreitigkeiten ins Ausland verschleppt, so 1205, als die
Witwe König Emerichs mit ihrem Kinde floh. Auch während der Gewaltherrschaft
Ladislaus^ von Siebenbürgen im Anfang des 14. Jahrhunderts und 1439, als die
Königinwitwe Elisabeth die Hxone für das Kind, das sie erwartete, in Sicherheit
bringen wollte. 1493 ward ein Gesetz erlassen, demzufolge die Reichskleinodien
fortan dauernd in Vissegrad aufbewahrt werden sollten, wo sie denn auch bis 1526
verblieben. Eine Zeitlang befanden sie sich danach in den Händen der Türken,
und unter Maximilian und Rudolf waren sie in Prag. 1619, nach der Einnahme
Pretzburgs, bemächtigte sich der aufständige Fürst Gabriel Bethlen von Sieben-
bürgen des wichtigen Königsymbols, der Krone. 1622 wurde sie wieder ausge-
liefert, 1782 lieh Kaiser Joseph II. sie nach Wien und 1791 nach Ofen bringen.
Im Jahre 1848 entführte Kossuth die Stephanskrone nach Debreczin und vergrub
sie bald danach im Allionberge bei Alt-Orsova. 1853 wurde aber das Versteck der
österreichischen Regierung verraten. Sie überführte die Krone nunmehr nach
Budapest, wo sie seitdem mit den anderen Reichskleinodien aufbewahrt wird. Die
Stephanskrone ist aus Gold gearbeitet und wiegt nach altem Gewicht 9 Mark
und 6 Lot, ungefähr 4 Pfund. 53 Saphire, 50 Rubine und 338 Perlen schmücken
sie. In neuerer Zeit ist ihr Wert nicht abgeschätzt worden, im Mittelalter aber wurde
sie häufiger gegen Summen von 2000 bis 5000 Goldgulden verpfändet. Das Kreuz
der Krone ist offenbar erst später von unkundiger Hand eingefügt worden, es hat sich
in seinem Futzpunkt gelockert, so datz es schief nach der Seite hängt.
Der alte Krönungsmantel geriet vermutlich im 17. Jahrhundert in Verlust.
Unter Maria Theresia wurde das in Wien aufbewahrte Metzgewand der Königin
Gisela, der Gemahlin des heiligen Stephan, zu dem jetzigen Krönungsmantel um-
gearbeitet. Grünlich schimmert heute sein einst blauer Seidenatlas, den reiche
Goldstickerei überzieht. Heiligenbilder, Tierszenen, allerhand Arabesken und zum
Teil schwer verständliche Inschriften in lateinischer Sprache mit wunderlichen Stick-
fehlern bilden die Muster. 4,75 Kilogramm wiegt der kostbare Mantel.
Das Zepter, ein mit Goldfiligranplatten belegter Stab, trägt an seiner Spitze eine
Kugel aus lichtem Bergkristall, die 7 Zentimeter Durchmesser besitzt. Es ist wesentlich
jünger als die Krone; seine Arbeit aber lätzt die Entstehungszeit nicht deutlich erkennen.
Der Reichsapfel stammt vermutlich aus der Zeit der ungarischen Könige des
Hauses Anjou; er besteht aus einer silbervergoldeten hohlen Blechkugel von 9 Zenti-
meter Durchmesser, die neben dem Patriarchenkreuz als einzigen Schmuck ein
kleines Wappen (goldene Lilien auf blauem Grund) aufweist.
Die Form des Schwertes lätzt auf deutschen Ursprung schlietzen; höchstwahr-
scheinlich ist es die Waffe, die König Stephan I. in seinen zahlreichen Kämpfen
führte. Die Sage erzählt, es sei im Jahre 1063 dem ungarischen König vom Herzog
Otto von Bayern geschenkt worden. Die Klinge ist 72 Zentimeter lang und sie
ist vom Rost stark angegriffen. Viel jünger als die Waffe selber ist die mit rotem
Samt überkleidete Scheide, aber auch sie ist sehr verdorben durch das jahrelange
Liegen in der feuchten Erde, als Kossuth die Kleinodien vergraben hatte.
Die übrigen alten Teile des ungarischen Königsschmucks, die Königslanze, die
Reichsfahne, die Schuhe und so weiter, sind teils gar nicht mehr vorhanden, teils
so beschädigt, datz sie nicht mehr in Gebrauch genommen werden können.
Heute gehört zum ungarischen Krönungsschmuck noch der von Maria Theresia
am 5. Mai 1764, dem Krönungstage des Erzherzogs Joseph, gestiftete Orden vom
heiligen Stephan. Sein grünes, goldgerändertes Grotzkreuz trägt der König als
Grotzmeister am Krönungstag an einer goldenen Kette um den Hals. G. M.
Originalzeichnung von G. Martin. Die ungarischen Krönungslleinodien.
Aus der Geschichte der ungarischen Krönungskleinodien.
ährend im Deutschen Reich nach der Verfassung eine Kaiserkrönung nicht
stattfindet und die Regierungsgewalt ohne besondere Förmlichkeit von dem
jeweiligen Kaiser ergriffen wird, schreibt die Gesetzgebung in den meisten
anderen Staaten ausdrücklich eine Krönung vor. Um der ungarischen Verfassung
gerecht zu werden, mutzte der neue österreichische Kaiser als König von Ungarn
nach bestimmten, überlieferten Gebräuchen in der Landeshauptstadt spätestens sechs
Monate nach dem Tode seines Vorgängers gekrönt werden. Diese mit grotzem
Gepränge vollzogene Feier fand am 30. Dezember 1916 statt.
Bis zum Jahre 1687 war Ungarn Wahlkönigreich. Daraus ist in erster Linie
die staatsrechtliche Bedeutung der Krönung abzuleiten. Als Matthias II. als erster
erblicher König Ungarns aus dem Hause Habsburg die Regierung antrat, legten
die Magnaten des Reichs besonderen Wert darauf, datz er in einem schriftlichen
Eide die Erfüllung seiner Herrscherpflichten und seine Verfassungstreue gewähr-
leiste. Wenn die heutige Verfassung Ungarns diese Eidesleistung, das sogenannte
Jnauguraldiplom, auch nicht mehr verlangt, so haben doch alle Herrscher sie in einer
der alten sehr ähnlichen Form beibehalten. Bestrebungen zur Zeit Leopolds II.
zielten darauf hin, in dem Jnauguraldiplom neben den Pflichten auch die Rechte
des gekrönten Königs festzulegen. Nach der ungarischen Verfassung verleiht aber
die Krönung an sich von jeher dem König eine Erweiterung seiner Rechte — vor der
Krönung ist eine königliche Schenkung, Titelverleihung und so weiter ungültig —
daher erwiesen sich jene Erörterungen bald als überflüssig. Die heutigen Ge-
schlechter sehen mit Recht in der feierlichen Krönung des ungarischen Königs trotz
der genauen und ausdrücklichen Bestimmungen der Verfassung im Grunde nichts
anderes als eine symbolische Handlung.
Das wichtigste Stück der ungarischen Krönungskleinodien, die Stephanskrone,
ist in den Jahren 1071 bis 1078 von dem byzantinischen Herrscher Michael Dukas
dem nachmaligen König Geyza I. von Ungarn zum Dank für dessen menschen-
freundliche Behandlung griechischer und bulgarischer Gefangener geschenkt worden.
Vorher schon trugen die ungarischen Herrscher eine Reifenkrone, und da das Ganze
offensichtlich verschiedene Stilarten aufweist, handelt es sich bei der Stephanskrone
wohl um ein Goldschmiedewerk, das aus verschiedenen Teilen zusammengefügt
und auch nachher noch verändert wurde. Ihren Namen führt die Krone nach dem
König Stephan, dem Papst Silvester II. im Jahre 1000 eine Krone schenkte, aber
nur Teile von diesem Stück fanden bei der Anfertigung der heutigen Krone Ver-
wendung. Die Stephanskrone hatte in der Folgezeit mannigfache Schicksale. Mehr-
mals wurde sie bei Thronstreitigkeiten ins Ausland verschleppt, so 1205, als die
Witwe König Emerichs mit ihrem Kinde floh. Auch während der Gewaltherrschaft
Ladislaus^ von Siebenbürgen im Anfang des 14. Jahrhunderts und 1439, als die
Königinwitwe Elisabeth die Hxone für das Kind, das sie erwartete, in Sicherheit
bringen wollte. 1493 ward ein Gesetz erlassen, demzufolge die Reichskleinodien
fortan dauernd in Vissegrad aufbewahrt werden sollten, wo sie denn auch bis 1526
verblieben. Eine Zeitlang befanden sie sich danach in den Händen der Türken,
und unter Maximilian und Rudolf waren sie in Prag. 1619, nach der Einnahme
Pretzburgs, bemächtigte sich der aufständige Fürst Gabriel Bethlen von Sieben-
bürgen des wichtigen Königsymbols, der Krone. 1622 wurde sie wieder ausge-
liefert, 1782 lieh Kaiser Joseph II. sie nach Wien und 1791 nach Ofen bringen.
Im Jahre 1848 entführte Kossuth die Stephanskrone nach Debreczin und vergrub
sie bald danach im Allionberge bei Alt-Orsova. 1853 wurde aber das Versteck der
österreichischen Regierung verraten. Sie überführte die Krone nunmehr nach
Budapest, wo sie seitdem mit den anderen Reichskleinodien aufbewahrt wird. Die
Stephanskrone ist aus Gold gearbeitet und wiegt nach altem Gewicht 9 Mark
und 6 Lot, ungefähr 4 Pfund. 53 Saphire, 50 Rubine und 338 Perlen schmücken
sie. In neuerer Zeit ist ihr Wert nicht abgeschätzt worden, im Mittelalter aber wurde
sie häufiger gegen Summen von 2000 bis 5000 Goldgulden verpfändet. Das Kreuz
der Krone ist offenbar erst später von unkundiger Hand eingefügt worden, es hat sich
in seinem Futzpunkt gelockert, so datz es schief nach der Seite hängt.
Der alte Krönungsmantel geriet vermutlich im 17. Jahrhundert in Verlust.
Unter Maria Theresia wurde das in Wien aufbewahrte Metzgewand der Königin
Gisela, der Gemahlin des heiligen Stephan, zu dem jetzigen Krönungsmantel um-
gearbeitet. Grünlich schimmert heute sein einst blauer Seidenatlas, den reiche
Goldstickerei überzieht. Heiligenbilder, Tierszenen, allerhand Arabesken und zum
Teil schwer verständliche Inschriften in lateinischer Sprache mit wunderlichen Stick-
fehlern bilden die Muster. 4,75 Kilogramm wiegt der kostbare Mantel.
Das Zepter, ein mit Goldfiligranplatten belegter Stab, trägt an seiner Spitze eine
Kugel aus lichtem Bergkristall, die 7 Zentimeter Durchmesser besitzt. Es ist wesentlich
jünger als die Krone; seine Arbeit aber lätzt die Entstehungszeit nicht deutlich erkennen.
Der Reichsapfel stammt vermutlich aus der Zeit der ungarischen Könige des
Hauses Anjou; er besteht aus einer silbervergoldeten hohlen Blechkugel von 9 Zenti-
meter Durchmesser, die neben dem Patriarchenkreuz als einzigen Schmuck ein
kleines Wappen (goldene Lilien auf blauem Grund) aufweist.
Die Form des Schwertes lätzt auf deutschen Ursprung schlietzen; höchstwahr-
scheinlich ist es die Waffe, die König Stephan I. in seinen zahlreichen Kämpfen
führte. Die Sage erzählt, es sei im Jahre 1063 dem ungarischen König vom Herzog
Otto von Bayern geschenkt worden. Die Klinge ist 72 Zentimeter lang und sie
ist vom Rost stark angegriffen. Viel jünger als die Waffe selber ist die mit rotem
Samt überkleidete Scheide, aber auch sie ist sehr verdorben durch das jahrelange
Liegen in der feuchten Erde, als Kossuth die Kleinodien vergraben hatte.
Die übrigen alten Teile des ungarischen Königsschmucks, die Königslanze, die
Reichsfahne, die Schuhe und so weiter, sind teils gar nicht mehr vorhanden, teils
so beschädigt, datz sie nicht mehr in Gebrauch genommen werden können.
Heute gehört zum ungarischen Krönungsschmuck noch der von Maria Theresia
am 5. Mai 1764, dem Krönungstage des Erzherzogs Joseph, gestiftete Orden vom
heiligen Stephan. Sein grünes, goldgerändertes Grotzkreuz trägt der König als
Grotzmeister am Krönungstag an einer goldenen Kette um den Hals. G. M.