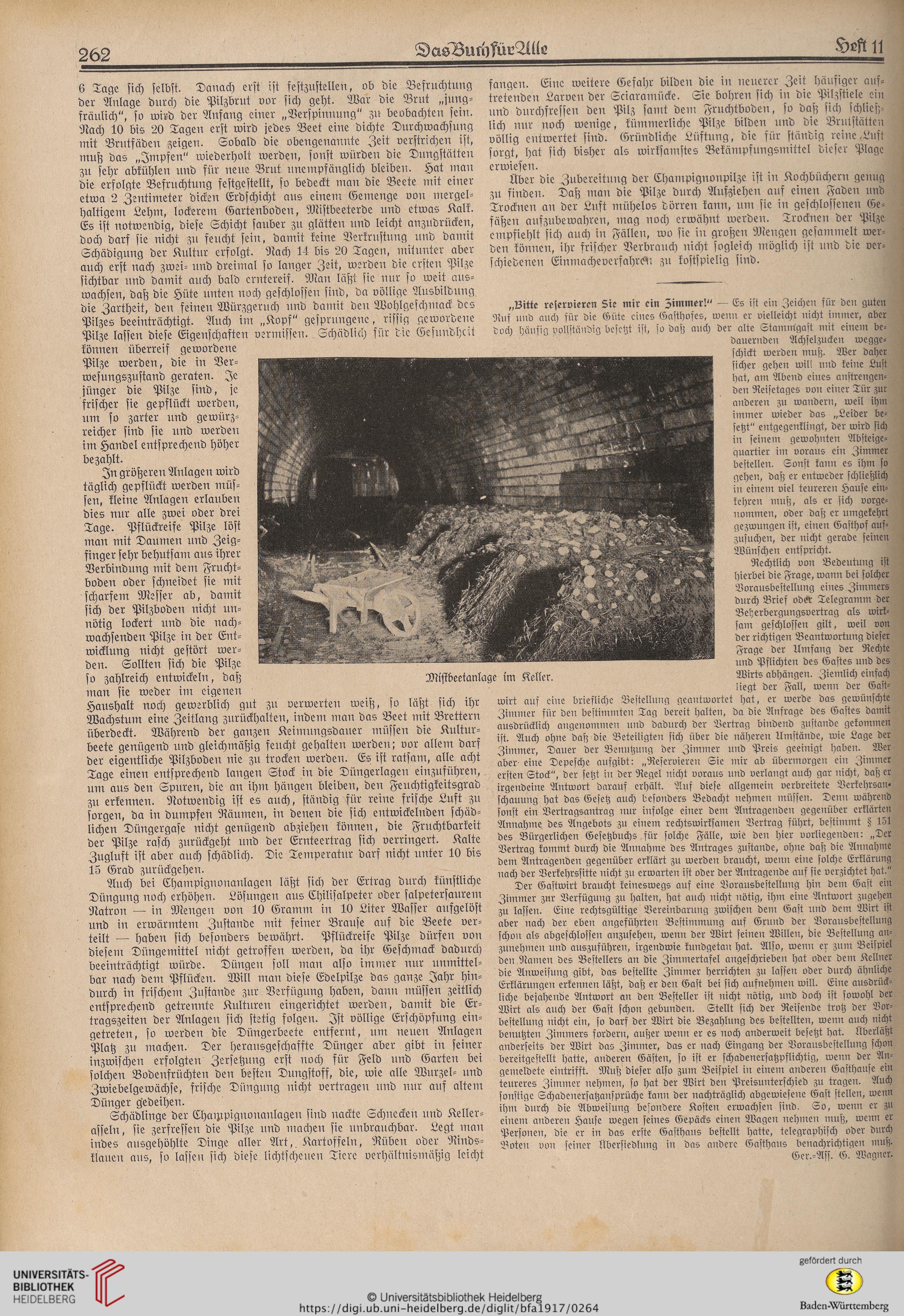262
DasBuchfürAlle
S-ftN
6 Tage sich selbst. Danach erst ist festzustellen, ob die Befruchtung
der Anlage durch die Pilzbrut vor sich geht. War die Brut „jung-
fräulich", fo wird der Anfang einer „Verspinnung" zu beobachten sein.
Nach 10 bis 20 Tagen erst wird jedes Beet eine dichte Durchwachsung
mit Brutfäden zeigen. Sobald die obengenannte Zeit verstrichen ist,
muß das „Impfen" wiederholt werden, sonst würden die Dungstätten
zu sehr abkühlen und für neue Brut unempfänglich bleiben. Hat man
die erfolgte Befruchtung festgestellt, so bedeckt man die Beete nut einer
etwa 2 Zentimeter dicken Erdschicht aus einem Gemenge von mergel-
haltigem Lehm, lockerem Gartenboden, Mistbeeterde und etwas Kalk.
Es ist notwendig, diese Schicht sauber zu glätten und leicht anzudrücken,
doch darf sie nicht zu feucht sein, damit keine Verkrustung und damit
Schädigung der Kultur erfolgt. Nach 14 bis 20 Tagen, mitunter aber
auch erst nach zwei- und dreimal so langer Zeit, werden die ersten Pilze
sichtbar und damit auch bald erntereif. Man läßt sie nur so weit aus-
wachsen, daß die Hüte unten noch geschlossen sind, da völlige Ausbildung
die Zartheit, den feinen Würzgeruch und damit den Wohlgeschmack des
Pilzes beeinträchtigt. Auch im „Kopf" gesprungene, rissig gewordene
Pilze lassen diese Eigenschaften vermissen. Schädlich für die Gesundheit
können überreif gewordene
Pilze werden, die in Ver¬
wesungszustand geraten. Je
jünger die Pilze sind, je
frischer sie gepflückt werden,
um so zarter und gewürz¬
reicher sind sie und werden
im Handel entsprechend höher
bezahlt.
In größeren Anlagen wird
täglich gepflückt werden müs¬
sen, kleine Anlagen erlauben
dies nur alle zwei oder drei
Tage. Pflückreife Pilze löst
man mit Daumen und Zeig¬
finger sehr behutsam aus ihrer
Verbindung nut dem Frucht¬
boden oder schneidet sie mit
scharfem Messer ab, damit
sich der Pilzboden nicht un¬
nötig lockert und die nach¬
wachsenden Pilze in der Ent¬
wicklung nicht gestört wer¬
den. Sollten sich die Pilze
so zahlreich entwickeln, daß
inan sie weder im eigenen
Haushalt noch gewerblich gut zu verwerten weiß, so läßt sich ihr
Wachstum eine Zeitlang zurückhalten, indem inan das Beet mit Brettern
überdeckt. Während der ganzen Keimungsdaner müssen die Kultur-
beete genügend und gleichmäßig feucht gehalten werden; vor allem darf
der eigentliche Pilzboden nie zu trocken werden. Es ist ratsam, alle acht
Tage einen entsprechend langen Stock in die Düngerlagen einzuführen,
um aus den Spuren, die an ihm hängen bleiben, den Feuchtigkeitsgrad
zu erkennen. Notwendig ist es auch, ständig für reine frische Luft zu
sorgen, da in dumpfen Räumen, in denen die sich entwickelnden schäd-
lichen Düngergase nicht genügend abziehen können, die Fruchtbarkeit
der Pilze rasch zurückgeht und der Ernteertrag sich verringert. Kalte
Zugluft ist aber auch schädlich. Die Temperatur darf nicht unter 10 bis
15 Grad zurückgehen.
Auch bei Champignonanlagen läßt sich der Ertrag durch künstliche
Düngung noch erhöhen. Lösungen aus Chilisalpeter oder salpetersaurem
Natron — in Mengen von 10 Gramm in 10 Liter Wasser aufgelöst
und in erwärmtem Zustande mit feiner Brause auf die Beete ver-
teilt — haben sich besonders bewährt. Pflückreife Pilze dürfen von
diesem Düngemittel nicht getroffen werden, da ihr Geschmack dadurch
beeinträchtigt würde. Düngen soll man also immer nur unmittel-
bar nach dein Pflücken. Will man diese Edelpilze das ganze Jahr hin-
durch in frischen: Zustande zur Verfügung haben, dann müssen zeitlich
entsprechend getrennte Kulturen eingerichtet werden, damit die Er-
tragszeiten der Anlagen sich stetig folgen. Ist völlige Erschöpfung ein-
getreten, so werden die Düngerbeete entfernt, um neuen Anlagen
Platz zu machen. Der heransgeschaffte Dünger aber gibt in seiner
inzwischen erfolgten Zersetzung erst noch für Feld und Garten bei
solchen Bodenfrüchten den besten Dungstoff, die, wie alle Wurzel- und
Zwiebelgewächse, frische Düngung nicht vertragen und nur auf altem
Dünger gedeihen.
Schädlinge der Chaippignonanlagen sind nackte Schnecken und Keller-
asseln, sie zerfressen die Pilze und machen sie unbrauchbar. Legt man
indes ausgehöhlte Dinge aller Art,. Kartoffeln, Rüben oder Rinds-
klauen aus, so lassen sich diese lichtscheuen Tiere verhältnismäßig leicht
fangen. Eine weitere Gefahr bilden die in neuerer Zeit häufiger auf-
tretenden Larven der Sciaramücke. Sie bohren sich in die Pilzstiele ein
und durchfressen den Pilz samt dem Fruchtboden, so daß sich schließ-
lich nur noch wenige, kümmerliche Pilze bilden und die Brutstätten
völlig entwertet sind. Gründliche Lüftung, die für ständig reine.Luft
sorgt, hat sich bisher als wirksamstes Bekämpfungsmittel Lieser Plage
erwiesen.
Über die Zubereitung der Lhampignonpilze ist in Kochbüchern genug
zu finden. Daß man die Pilze durch Aufziehen auf einen Faden und
Trocknen an der Luft mühelos dörren kann, um sie in geschlossenen Ge-
fäßen aufzubewahren, mag noch erwähnt werden. Trocknen der Pilze
empfiehlt sich auch in Füllen, wo sie in großen Mengen gesammelt wer-
den können, ihr frischer Verbrauch nicht sogleich möglich ist und die ver-
schiedenen Einnmcheverfahrc^: zu kostspielig sind.
„Bitte reservieren Sie mir ein Zimmer'." — Es ist ein Zeichen für den guten
Nuf und auch für die Güte eines Gasthofes, wenn er vielleicht nicht immer, aber
doch häufig vollständig besetzt ist, so daß auch der alte Stammgast mit einem be-
dauernden Achselzucken wegge-
schickt werden muß. Wer daher
sicher gehen wil! und keine Lust
hat, am Abend eines anstrengen-
den Reisetages von einer Tür zur
anderen zu wandern, weil ihm
immer wieder das „Leider be-
setzt" entgegenklingt, der wird sich
in seinem gewohnten Absteige-
quartier im voraus ein Zimmer
bestellen. Sonst kann es ihm so
gehen, daß er entweder schließlich
in einem viel teureren Hause ein-
kehren muß, als er sich vorge-
nommen, oder daß er umgekehrt
gezwungen ist, einen Gasthof auf-
zusuchen, der nicht gerade seinen
Wünschen entspricht.
Rechtlich von Bedeutung ist
hierbei die Frage, wann bei solcher
Vorausbestellung eines Zimmers
durch Brief oder Telegramm der
Beherbergungsvertrag als wirk-
sam geschlossen gilt, weil von
der richtigen Beantwortung dieser
Frage der Umfang der Rechte
und Pflichten des Gastes und des
Wirts abhängen. Ziemlich einfach
liegt der Fall, wenn der Gast-
wirt auf eine briefliche Bestellung geantwortet hat, er werde das gewünschte
Zimmer für den bestimmten Tag bereit halten, da die Anfrage des Gastes damit
ausdrücklich angenommen und dadurch der Vertrag bindend zustande gekommen
ist. Auch ohne daß die Beteiligten sich über die näheren Umstände, wie Lage der
Zimmer, Dauer der Benutzung der Zimmer und Preis geeinigt haben. Wer
aber eine Depesche anfgibt: „Reservieren Sie mir ab übermorgen ein Zimmer
ersten Stock", der setzt in der Regel nicht voraus und verlangt auch gar nicht, daß er
irgendeine Antwort darauf erhält. Auf diese allgemein verbreitete Verkehrsan-
schauung hat das Gesetz auch besonders Bedacht nehmen müssen. Denn während
sonst ein Vertragsantrag nur infolge einer dem Antragenden gegenüber erklärten
Annahme des Angebots zu einem rechtswirksamen Vertrag führt, bestimmt 8 151
des Bürgerlichen Gesetzbuchs für solche Fälle, wie den hier vorliegenden: „Der
Vertrag kommt durch die Annahme des Antrages zustande, ohne daß die Annahme
dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung
nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat."
Der Gastwirt braucht keineswegs auf eine Vorausbestellung hin dem Gast ein
Zimmer zur Verfügung zu halten, hat auch nicht nötig, ihm eine Antwort zugehen
zu lassen. Eine rechtsgültige Vereinbarung Zwischen den: Gast und dem Wirt ist
aber nach der eben angeführten Bestimmung auf Grund der Vorausbestellung
schon als abgeschlossen anzusehen, wenn der Wirt seinen Willen, die Bestellung an-
zunehmen und auszuführen, irgendwie kundgetan hat. Also, wenn er zum Beispiel
den Rainen des Bestellers an die Zimmertafel airgeschrieben hat oder dem Kellner
die Airweisung gibt, das bestellte Zimmer Herrichten zu lassen oder durch ähnliche
Erklärungen erkennen läßt, daß er den Gast bei sich aufnehmen will. Eine ausdrück-
liche bejahende Antwort an den Besteller ist nicht nötig, und doch ist sowohl der
Wirt als auch der Gast schon gebunden. Stellt sich der Reisende trotz der Vor-
bestellung nicht ein, so darf der Wirt die Bezahlung des bestellten, wenn auch nicht
benutzten Zimmers fordern, außer wenn er es noch anderweit besetzt hat. Überläßt
anderseits der Wirt das Zimmer, das er nach Eingang der Vorairsbestellung schor:
bereitgestellt hatte, anderen Gästen, so ist er schadenersatzpflichtig, wenn der An-
gemeldete eintrifft. Muß dieser also zum Beispiel irr einen: anderer: Gasthause ein
teureres Zimmer nehmen, so hat der Wirt der: Preisunterschied zu tragen. Auch
sonstige Schadenersatzansprüche kam: der nachträglich abgewiesene Gast stellen, wenn
ihn: durch die Abweisung besondere Kosten erwachsen sind. So, wem: er zu
einem anderen Hause wegen seines Gepäcks einen Wagen nehmen muß, wenn er
Personen, die er in das erste Gasthans bestellt hatte, telegraphisch oder durch
Bote:: vor: seiner Übersiedlung in das andere Gasthans benachrichtigen muß.
Ger.-Ass. G. Wagner.
Mistbeetanlage im Keller.
DasBuchfürAlle
S-ftN
6 Tage sich selbst. Danach erst ist festzustellen, ob die Befruchtung
der Anlage durch die Pilzbrut vor sich geht. War die Brut „jung-
fräulich", fo wird der Anfang einer „Verspinnung" zu beobachten sein.
Nach 10 bis 20 Tagen erst wird jedes Beet eine dichte Durchwachsung
mit Brutfäden zeigen. Sobald die obengenannte Zeit verstrichen ist,
muß das „Impfen" wiederholt werden, sonst würden die Dungstätten
zu sehr abkühlen und für neue Brut unempfänglich bleiben. Hat man
die erfolgte Befruchtung festgestellt, so bedeckt man die Beete nut einer
etwa 2 Zentimeter dicken Erdschicht aus einem Gemenge von mergel-
haltigem Lehm, lockerem Gartenboden, Mistbeeterde und etwas Kalk.
Es ist notwendig, diese Schicht sauber zu glätten und leicht anzudrücken,
doch darf sie nicht zu feucht sein, damit keine Verkrustung und damit
Schädigung der Kultur erfolgt. Nach 14 bis 20 Tagen, mitunter aber
auch erst nach zwei- und dreimal so langer Zeit, werden die ersten Pilze
sichtbar und damit auch bald erntereif. Man läßt sie nur so weit aus-
wachsen, daß die Hüte unten noch geschlossen sind, da völlige Ausbildung
die Zartheit, den feinen Würzgeruch und damit den Wohlgeschmack des
Pilzes beeinträchtigt. Auch im „Kopf" gesprungene, rissig gewordene
Pilze lassen diese Eigenschaften vermissen. Schädlich für die Gesundheit
können überreif gewordene
Pilze werden, die in Ver¬
wesungszustand geraten. Je
jünger die Pilze sind, je
frischer sie gepflückt werden,
um so zarter und gewürz¬
reicher sind sie und werden
im Handel entsprechend höher
bezahlt.
In größeren Anlagen wird
täglich gepflückt werden müs¬
sen, kleine Anlagen erlauben
dies nur alle zwei oder drei
Tage. Pflückreife Pilze löst
man mit Daumen und Zeig¬
finger sehr behutsam aus ihrer
Verbindung nut dem Frucht¬
boden oder schneidet sie mit
scharfem Messer ab, damit
sich der Pilzboden nicht un¬
nötig lockert und die nach¬
wachsenden Pilze in der Ent¬
wicklung nicht gestört wer¬
den. Sollten sich die Pilze
so zahlreich entwickeln, daß
inan sie weder im eigenen
Haushalt noch gewerblich gut zu verwerten weiß, so läßt sich ihr
Wachstum eine Zeitlang zurückhalten, indem inan das Beet mit Brettern
überdeckt. Während der ganzen Keimungsdaner müssen die Kultur-
beete genügend und gleichmäßig feucht gehalten werden; vor allem darf
der eigentliche Pilzboden nie zu trocken werden. Es ist ratsam, alle acht
Tage einen entsprechend langen Stock in die Düngerlagen einzuführen,
um aus den Spuren, die an ihm hängen bleiben, den Feuchtigkeitsgrad
zu erkennen. Notwendig ist es auch, ständig für reine frische Luft zu
sorgen, da in dumpfen Räumen, in denen die sich entwickelnden schäd-
lichen Düngergase nicht genügend abziehen können, die Fruchtbarkeit
der Pilze rasch zurückgeht und der Ernteertrag sich verringert. Kalte
Zugluft ist aber auch schädlich. Die Temperatur darf nicht unter 10 bis
15 Grad zurückgehen.
Auch bei Champignonanlagen läßt sich der Ertrag durch künstliche
Düngung noch erhöhen. Lösungen aus Chilisalpeter oder salpetersaurem
Natron — in Mengen von 10 Gramm in 10 Liter Wasser aufgelöst
und in erwärmtem Zustande mit feiner Brause auf die Beete ver-
teilt — haben sich besonders bewährt. Pflückreife Pilze dürfen von
diesem Düngemittel nicht getroffen werden, da ihr Geschmack dadurch
beeinträchtigt würde. Düngen soll man also immer nur unmittel-
bar nach dein Pflücken. Will man diese Edelpilze das ganze Jahr hin-
durch in frischen: Zustande zur Verfügung haben, dann müssen zeitlich
entsprechend getrennte Kulturen eingerichtet werden, damit die Er-
tragszeiten der Anlagen sich stetig folgen. Ist völlige Erschöpfung ein-
getreten, so werden die Düngerbeete entfernt, um neuen Anlagen
Platz zu machen. Der heransgeschaffte Dünger aber gibt in seiner
inzwischen erfolgten Zersetzung erst noch für Feld und Garten bei
solchen Bodenfrüchten den besten Dungstoff, die, wie alle Wurzel- und
Zwiebelgewächse, frische Düngung nicht vertragen und nur auf altem
Dünger gedeihen.
Schädlinge der Chaippignonanlagen sind nackte Schnecken und Keller-
asseln, sie zerfressen die Pilze und machen sie unbrauchbar. Legt man
indes ausgehöhlte Dinge aller Art,. Kartoffeln, Rüben oder Rinds-
klauen aus, so lassen sich diese lichtscheuen Tiere verhältnismäßig leicht
fangen. Eine weitere Gefahr bilden die in neuerer Zeit häufiger auf-
tretenden Larven der Sciaramücke. Sie bohren sich in die Pilzstiele ein
und durchfressen den Pilz samt dem Fruchtboden, so daß sich schließ-
lich nur noch wenige, kümmerliche Pilze bilden und die Brutstätten
völlig entwertet sind. Gründliche Lüftung, die für ständig reine.Luft
sorgt, hat sich bisher als wirksamstes Bekämpfungsmittel Lieser Plage
erwiesen.
Über die Zubereitung der Lhampignonpilze ist in Kochbüchern genug
zu finden. Daß man die Pilze durch Aufziehen auf einen Faden und
Trocknen an der Luft mühelos dörren kann, um sie in geschlossenen Ge-
fäßen aufzubewahren, mag noch erwähnt werden. Trocknen der Pilze
empfiehlt sich auch in Füllen, wo sie in großen Mengen gesammelt wer-
den können, ihr frischer Verbrauch nicht sogleich möglich ist und die ver-
schiedenen Einnmcheverfahrc^: zu kostspielig sind.
„Bitte reservieren Sie mir ein Zimmer'." — Es ist ein Zeichen für den guten
Nuf und auch für die Güte eines Gasthofes, wenn er vielleicht nicht immer, aber
doch häufig vollständig besetzt ist, so daß auch der alte Stammgast mit einem be-
dauernden Achselzucken wegge-
schickt werden muß. Wer daher
sicher gehen wil! und keine Lust
hat, am Abend eines anstrengen-
den Reisetages von einer Tür zur
anderen zu wandern, weil ihm
immer wieder das „Leider be-
setzt" entgegenklingt, der wird sich
in seinem gewohnten Absteige-
quartier im voraus ein Zimmer
bestellen. Sonst kann es ihm so
gehen, daß er entweder schließlich
in einem viel teureren Hause ein-
kehren muß, als er sich vorge-
nommen, oder daß er umgekehrt
gezwungen ist, einen Gasthof auf-
zusuchen, der nicht gerade seinen
Wünschen entspricht.
Rechtlich von Bedeutung ist
hierbei die Frage, wann bei solcher
Vorausbestellung eines Zimmers
durch Brief oder Telegramm der
Beherbergungsvertrag als wirk-
sam geschlossen gilt, weil von
der richtigen Beantwortung dieser
Frage der Umfang der Rechte
und Pflichten des Gastes und des
Wirts abhängen. Ziemlich einfach
liegt der Fall, wenn der Gast-
wirt auf eine briefliche Bestellung geantwortet hat, er werde das gewünschte
Zimmer für den bestimmten Tag bereit halten, da die Anfrage des Gastes damit
ausdrücklich angenommen und dadurch der Vertrag bindend zustande gekommen
ist. Auch ohne daß die Beteiligten sich über die näheren Umstände, wie Lage der
Zimmer, Dauer der Benutzung der Zimmer und Preis geeinigt haben. Wer
aber eine Depesche anfgibt: „Reservieren Sie mir ab übermorgen ein Zimmer
ersten Stock", der setzt in der Regel nicht voraus und verlangt auch gar nicht, daß er
irgendeine Antwort darauf erhält. Auf diese allgemein verbreitete Verkehrsan-
schauung hat das Gesetz auch besonders Bedacht nehmen müssen. Denn während
sonst ein Vertragsantrag nur infolge einer dem Antragenden gegenüber erklärten
Annahme des Angebots zu einem rechtswirksamen Vertrag führt, bestimmt 8 151
des Bürgerlichen Gesetzbuchs für solche Fälle, wie den hier vorliegenden: „Der
Vertrag kommt durch die Annahme des Antrages zustande, ohne daß die Annahme
dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung
nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat."
Der Gastwirt braucht keineswegs auf eine Vorausbestellung hin dem Gast ein
Zimmer zur Verfügung zu halten, hat auch nicht nötig, ihm eine Antwort zugehen
zu lassen. Eine rechtsgültige Vereinbarung Zwischen den: Gast und dem Wirt ist
aber nach der eben angeführten Bestimmung auf Grund der Vorausbestellung
schon als abgeschlossen anzusehen, wenn der Wirt seinen Willen, die Bestellung an-
zunehmen und auszuführen, irgendwie kundgetan hat. Also, wenn er zum Beispiel
den Rainen des Bestellers an die Zimmertafel airgeschrieben hat oder dem Kellner
die Airweisung gibt, das bestellte Zimmer Herrichten zu lassen oder durch ähnliche
Erklärungen erkennen läßt, daß er den Gast bei sich aufnehmen will. Eine ausdrück-
liche bejahende Antwort an den Besteller ist nicht nötig, und doch ist sowohl der
Wirt als auch der Gast schon gebunden. Stellt sich der Reisende trotz der Vor-
bestellung nicht ein, so darf der Wirt die Bezahlung des bestellten, wenn auch nicht
benutzten Zimmers fordern, außer wenn er es noch anderweit besetzt hat. Überläßt
anderseits der Wirt das Zimmer, das er nach Eingang der Vorairsbestellung schor:
bereitgestellt hatte, anderen Gästen, so ist er schadenersatzpflichtig, wenn der An-
gemeldete eintrifft. Muß dieser also zum Beispiel irr einen: anderer: Gasthause ein
teureres Zimmer nehmen, so hat der Wirt der: Preisunterschied zu tragen. Auch
sonstige Schadenersatzansprüche kam: der nachträglich abgewiesene Gast stellen, wenn
ihn: durch die Abweisung besondere Kosten erwachsen sind. So, wem: er zu
einem anderen Hause wegen seines Gepäcks einen Wagen nehmen muß, wenn er
Personen, die er in das erste Gasthans bestellt hatte, telegraphisch oder durch
Bote:: vor: seiner Übersiedlung in das andere Gasthans benachrichtigen muß.
Ger.-Ass. G. Wagner.
Mistbeetanlage im Keller.