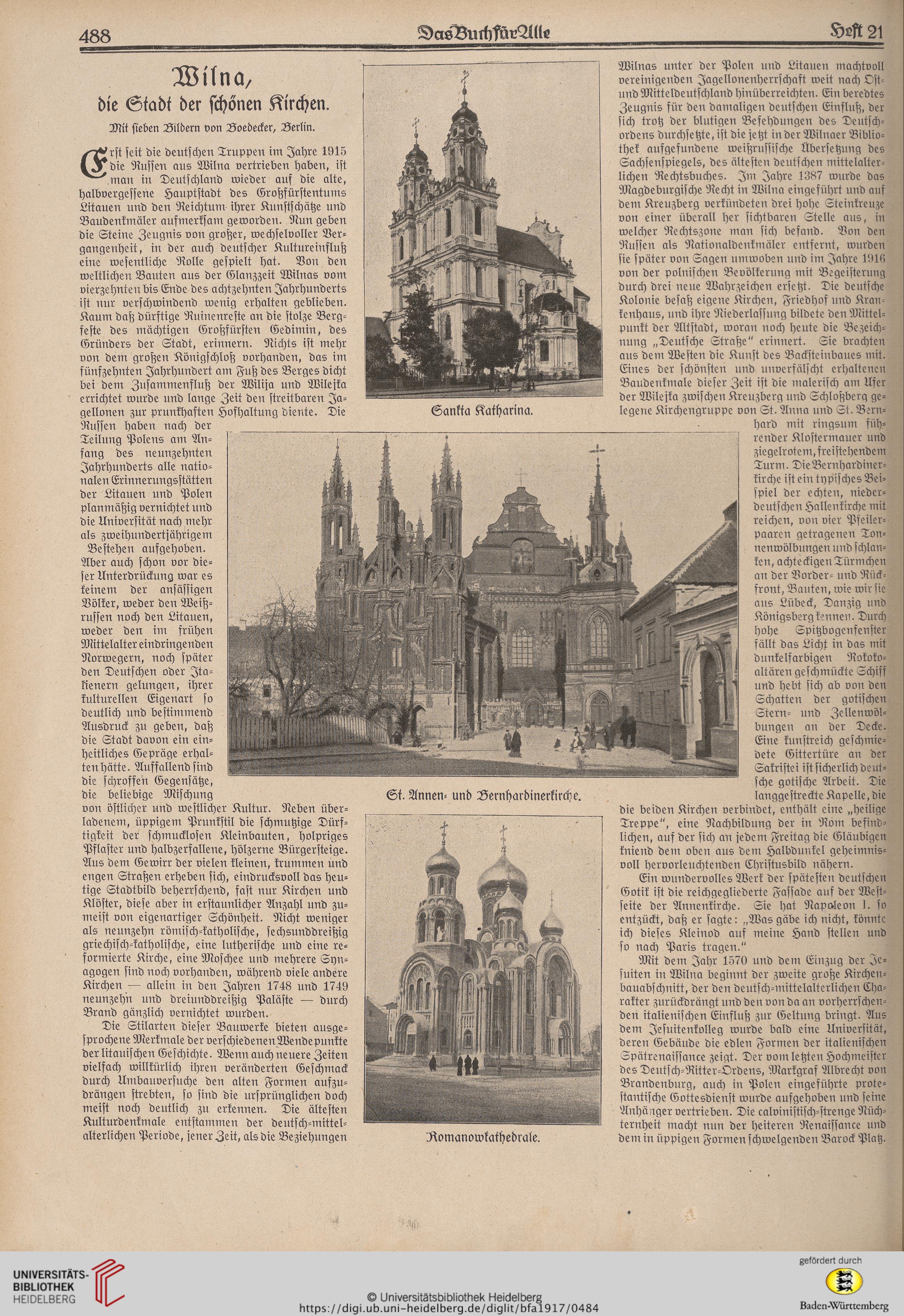-488
DasBuchfüvAlte
Hsft 21
Wilna/
die Stadt der schönen Kirchen.
Mit sieben Bildern von Boedecker, Berlin.
seit die deutschen Truppen im Jahre 1915
EH*die Russen aus Wilna vertrieben haben, ist
^"^.man in Deutschland wieder auf die alte,
halbvergessene Hauptstadt des Großfürstentums
Litauen und den Reichtum ihrer Kunstschätze und
Baudenkmäler aufmerksam geworden. Nun geben
die Steine Zeugnis von großer, wechselvoller Ver-
gangenheit, in der auch deutscher Kultureinfluß
eine wesentliche Rolle gespielt hat. Von den
weltlichen Bauten aus der Glanzzeit Wilnas vom
vierzehnten bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts
ist nur verschwindend wenig erhalten geblieben.
Kaum daß dürftige Ruinenreste an die stolze Berg-
feste des mächtigen Großfürsten Gedimin, des
Gründers der Stadt, erinnern. Nichts ist mehr
von dem großen Königschloß vorhanden, das im
fünfzehnten Jahrhundert am Fuß des Berges dicht
bei dem Zusammenfluß der Wilija und Wilejka
errichtet wurde und lange Zeit den streitbaren Ja-
gellonen zur prunkhaften Hofhaltung diente. Die
Russen haben nach der
Teilung Polens am An-
fang des neunzehnten
Jahrhunderts alle natio-
nalen Erinnerungsstätten
der Litauen und Polen
planmäßig vernichtet und
die Universität nach mehr
als zweihundertjährigem
Bestehen aufgehoben.
Aber auch schon vor die-
ser Unterdrückung war es
keinem der ansässigen
Völker, weder den Weiß-
russen noch den Litauen,
weder den im frühen
Mittelalter eindringenden
Norwegern, noch später
den Deutschen oder Ita-
lienern gelungen, ihrer
kulturellen Eigenart so
deutlich und bestimmend
Ausdruck zu geben, daß
die Stadt davon ein ein-
heitliches Gepräge erhal-
tenhätte. Auffallend sind
die schroffen Gegensätze,
die beliebige Mischung
von östlicher und westlicher Kultur. Neben über-
ladenem, üppigem Prunkstil die schmutzige Dürf-
tigkeit der schmucklosen Kleinbauten, holpriges
Pflaster und halbzerfallene, hölzerne Bürgersteige.
Aus dem Gewirr der vielen kleinen, krummen und
engen Straßen erheben sich, eindrucksvoll das heu-
tige Stadtbild beherrschend, fast nur Kirchen und
Klöster, diese aber in erstaunlicher Anzahl und zu-
meist von eigenartiger Schönheit. Nicht weniger
als neunzehn römisch-katholische, sechsunddreißig
griechisch-katholische, eine lutherische und eine re-
formierte Kirche, eine Moschee und mehrere Syn-
agogen sind noch vorhanden, während viele andere
Kirchen — allein in den Jahren 1748 und 1749
neunzehn und dreiunddreißig Paläste — durch
Brand gänzlich vernichtet wurden.
Die Stilarten dieser Bauwerke bieten ausge-
sprochene Merkmale der verschiedenen Wendepunkte
der litauischen Geschichte. Wenn auch neuere Zeiten
vielfach willkürlich ihren veränderten Geschmack
durch Umbauversuche den alten Formen aufzu-
drängen strebten, so sind die ursprünglichen doch
meist noch deutlich zu erkennen. Die ältesten
Kulturdenkmale entstammen der deutsch-mittel-
alterlichen Periode, jener Zeit, als die Beziehungen
Wilnas unter der Polen und Litauen machtvoll
vereinigenden Jagellonenherrschaft weit nach Ost-
und Mitteldeutschland hinüberreichten. Ein beredtes
Zeugnis für den damaligen deutschen Einfluß, der
sich trotz der blutigen Befehdungen des Deutsch-
ordens durchsetzte, ist die jetzt in der Wilnaer Biblio-
thek aufgefundene weißrussische Übersetzung des
Sachsenspiegels, des ältesten deutschen mittelalter-
lichen Rechtsbuches. In: Jahre 1387 wurde das
Magdeburgische Recht in Wilna eingeführt und auf
dem Kreuzberg verkündeten drei hohe Steinkreuze
von einer überall her sichtbaren Stelle aus, in
welcher Nechtszone man sich befand. Von den
Russen als Nationaldenkmäler entfernt, wurden
sie später von Sagen umwoben und im Jahre 1916
von der polnischen Bevölkerung mit Begeisterung
durch drei neue Wahrzeichen ersetzt. Die deutsche
Kolonie besaß eigene Kirchen, Friedhof und Kran-
kenhaus, und ihre Niederlassung bildete den Mittel-
punkt der Altstadt, woran noch heute die Bezeich-
nung „Deutsche Straße" erinnert. Sie brachten
aus dem Westen die Kunst des Backsteinbaues mit.
Eines der schönsten und unverfälscht erhaltenen
Baudenkmale dieser Zeit ist die malerisch am Ufer
der Wilejka zwischen Kreuzberg und Schloßberg ge-
legene Kirchengruppe von St. Anna und St. Bern-
hard mit ringsum füh-
render Klostermauer und
ziegelrotem, freistehendem
Turm. Die Bernhardiner-
kirche ist ein typisches Bei-
spiel der echten, nieder-
deutschen Hallenkirche mit
reichen, von vier Pfeiler-
paaren getragenen Ton-
nenwölbungen und schlan-
ken, achteckigen Türmchen
an der Vorder- und Rück-
front, Bauten, wie wir sie
aus Lübeck, Danzig und
Königsberg kennen. Durch
hohe Spitzbogenfenster
fällt das Licht in das mit
dunkelfarbigen Rokoko-
altären geschmückte Schiff
und hebt sich ab von den
Schatten der gotischen
Stern- und Zellenwöl-
bungen an der Decke.
Eine kunstreich geschmie-
dete Gittertüre an der
Sakristei ist sicherlich deut-
sche gotische Arbeit. Die
langgestreckte Kapelle, die
die beiden Kirchen verbindet, enthält eine „heilige
Treppe", eine Nachbildung der in Rom befind-
lichen, auf der sich an jedem Freitag die Gläubigen
kniend dem oben aus dem Halbdunkel geheimnis-
voll hervorleuchtenden Christusbild nähern.
Ein wundervolles Werk der spätesten deutschen
Gotik ist die reichgegliederte Fassade auf der West-
seite der Annenkirche. Sie hat Napoleon I. so
entzückt, daß er sagte: „Was gäbe ich nicht, könnte
ich dieses Kleinod auf meine Hand stellen und
so nach Paris tragen."
Mit dem Jahr 1570 und dem Einzug der Je-
suiten in Wilna beginnt der zweite große Kirchen-
bauabschnitt, der den deutsch-mittelalterlichen Cha-
rakter zurückdrängt und den von da an vorherrschen-
den italienischen Einfluß zur Geltung bringt. Aus
dem Jesuitenkolleg wurde bald eine Universität,
deren Gebäude die edlen Formen der italienischen
Spätrenaissance zeigt. Der vom letzten Hochmeister
des Deutsch-Ritter-Ordens, Markgraf Albrecht von
Brandenburg, auch in Polen eingeführte prote-
stantische Gottesdienst wurde aufgehoben und seine
Anhänger vertrieben. Die calvinistisch-strenge Nüch-
ternheit macht nun der heiteren Renaissance und
dem in üppigen Formen schwelgenden Barock Platz.
St. Annen- und Bernhardinerkirche.
iKomanowkathedrale.
Sankia Katharina.
DasBuchfüvAlte
Hsft 21
Wilna/
die Stadt der schönen Kirchen.
Mit sieben Bildern von Boedecker, Berlin.
seit die deutschen Truppen im Jahre 1915
EH*die Russen aus Wilna vertrieben haben, ist
^"^.man in Deutschland wieder auf die alte,
halbvergessene Hauptstadt des Großfürstentums
Litauen und den Reichtum ihrer Kunstschätze und
Baudenkmäler aufmerksam geworden. Nun geben
die Steine Zeugnis von großer, wechselvoller Ver-
gangenheit, in der auch deutscher Kultureinfluß
eine wesentliche Rolle gespielt hat. Von den
weltlichen Bauten aus der Glanzzeit Wilnas vom
vierzehnten bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts
ist nur verschwindend wenig erhalten geblieben.
Kaum daß dürftige Ruinenreste an die stolze Berg-
feste des mächtigen Großfürsten Gedimin, des
Gründers der Stadt, erinnern. Nichts ist mehr
von dem großen Königschloß vorhanden, das im
fünfzehnten Jahrhundert am Fuß des Berges dicht
bei dem Zusammenfluß der Wilija und Wilejka
errichtet wurde und lange Zeit den streitbaren Ja-
gellonen zur prunkhaften Hofhaltung diente. Die
Russen haben nach der
Teilung Polens am An-
fang des neunzehnten
Jahrhunderts alle natio-
nalen Erinnerungsstätten
der Litauen und Polen
planmäßig vernichtet und
die Universität nach mehr
als zweihundertjährigem
Bestehen aufgehoben.
Aber auch schon vor die-
ser Unterdrückung war es
keinem der ansässigen
Völker, weder den Weiß-
russen noch den Litauen,
weder den im frühen
Mittelalter eindringenden
Norwegern, noch später
den Deutschen oder Ita-
lienern gelungen, ihrer
kulturellen Eigenart so
deutlich und bestimmend
Ausdruck zu geben, daß
die Stadt davon ein ein-
heitliches Gepräge erhal-
tenhätte. Auffallend sind
die schroffen Gegensätze,
die beliebige Mischung
von östlicher und westlicher Kultur. Neben über-
ladenem, üppigem Prunkstil die schmutzige Dürf-
tigkeit der schmucklosen Kleinbauten, holpriges
Pflaster und halbzerfallene, hölzerne Bürgersteige.
Aus dem Gewirr der vielen kleinen, krummen und
engen Straßen erheben sich, eindrucksvoll das heu-
tige Stadtbild beherrschend, fast nur Kirchen und
Klöster, diese aber in erstaunlicher Anzahl und zu-
meist von eigenartiger Schönheit. Nicht weniger
als neunzehn römisch-katholische, sechsunddreißig
griechisch-katholische, eine lutherische und eine re-
formierte Kirche, eine Moschee und mehrere Syn-
agogen sind noch vorhanden, während viele andere
Kirchen — allein in den Jahren 1748 und 1749
neunzehn und dreiunddreißig Paläste — durch
Brand gänzlich vernichtet wurden.
Die Stilarten dieser Bauwerke bieten ausge-
sprochene Merkmale der verschiedenen Wendepunkte
der litauischen Geschichte. Wenn auch neuere Zeiten
vielfach willkürlich ihren veränderten Geschmack
durch Umbauversuche den alten Formen aufzu-
drängen strebten, so sind die ursprünglichen doch
meist noch deutlich zu erkennen. Die ältesten
Kulturdenkmale entstammen der deutsch-mittel-
alterlichen Periode, jener Zeit, als die Beziehungen
Wilnas unter der Polen und Litauen machtvoll
vereinigenden Jagellonenherrschaft weit nach Ost-
und Mitteldeutschland hinüberreichten. Ein beredtes
Zeugnis für den damaligen deutschen Einfluß, der
sich trotz der blutigen Befehdungen des Deutsch-
ordens durchsetzte, ist die jetzt in der Wilnaer Biblio-
thek aufgefundene weißrussische Übersetzung des
Sachsenspiegels, des ältesten deutschen mittelalter-
lichen Rechtsbuches. In: Jahre 1387 wurde das
Magdeburgische Recht in Wilna eingeführt und auf
dem Kreuzberg verkündeten drei hohe Steinkreuze
von einer überall her sichtbaren Stelle aus, in
welcher Nechtszone man sich befand. Von den
Russen als Nationaldenkmäler entfernt, wurden
sie später von Sagen umwoben und im Jahre 1916
von der polnischen Bevölkerung mit Begeisterung
durch drei neue Wahrzeichen ersetzt. Die deutsche
Kolonie besaß eigene Kirchen, Friedhof und Kran-
kenhaus, und ihre Niederlassung bildete den Mittel-
punkt der Altstadt, woran noch heute die Bezeich-
nung „Deutsche Straße" erinnert. Sie brachten
aus dem Westen die Kunst des Backsteinbaues mit.
Eines der schönsten und unverfälscht erhaltenen
Baudenkmale dieser Zeit ist die malerisch am Ufer
der Wilejka zwischen Kreuzberg und Schloßberg ge-
legene Kirchengruppe von St. Anna und St. Bern-
hard mit ringsum füh-
render Klostermauer und
ziegelrotem, freistehendem
Turm. Die Bernhardiner-
kirche ist ein typisches Bei-
spiel der echten, nieder-
deutschen Hallenkirche mit
reichen, von vier Pfeiler-
paaren getragenen Ton-
nenwölbungen und schlan-
ken, achteckigen Türmchen
an der Vorder- und Rück-
front, Bauten, wie wir sie
aus Lübeck, Danzig und
Königsberg kennen. Durch
hohe Spitzbogenfenster
fällt das Licht in das mit
dunkelfarbigen Rokoko-
altären geschmückte Schiff
und hebt sich ab von den
Schatten der gotischen
Stern- und Zellenwöl-
bungen an der Decke.
Eine kunstreich geschmie-
dete Gittertüre an der
Sakristei ist sicherlich deut-
sche gotische Arbeit. Die
langgestreckte Kapelle, die
die beiden Kirchen verbindet, enthält eine „heilige
Treppe", eine Nachbildung der in Rom befind-
lichen, auf der sich an jedem Freitag die Gläubigen
kniend dem oben aus dem Halbdunkel geheimnis-
voll hervorleuchtenden Christusbild nähern.
Ein wundervolles Werk der spätesten deutschen
Gotik ist die reichgegliederte Fassade auf der West-
seite der Annenkirche. Sie hat Napoleon I. so
entzückt, daß er sagte: „Was gäbe ich nicht, könnte
ich dieses Kleinod auf meine Hand stellen und
so nach Paris tragen."
Mit dem Jahr 1570 und dem Einzug der Je-
suiten in Wilna beginnt der zweite große Kirchen-
bauabschnitt, der den deutsch-mittelalterlichen Cha-
rakter zurückdrängt und den von da an vorherrschen-
den italienischen Einfluß zur Geltung bringt. Aus
dem Jesuitenkolleg wurde bald eine Universität,
deren Gebäude die edlen Formen der italienischen
Spätrenaissance zeigt. Der vom letzten Hochmeister
des Deutsch-Ritter-Ordens, Markgraf Albrecht von
Brandenburg, auch in Polen eingeführte prote-
stantische Gottesdienst wurde aufgehoben und seine
Anhänger vertrieben. Die calvinistisch-strenge Nüch-
ternheit macht nun der heiteren Renaissance und
dem in üppigen Formen schwelgenden Barock Platz.
St. Annen- und Bernhardinerkirche.
iKomanowkathedrale.
Sankia Katharina.