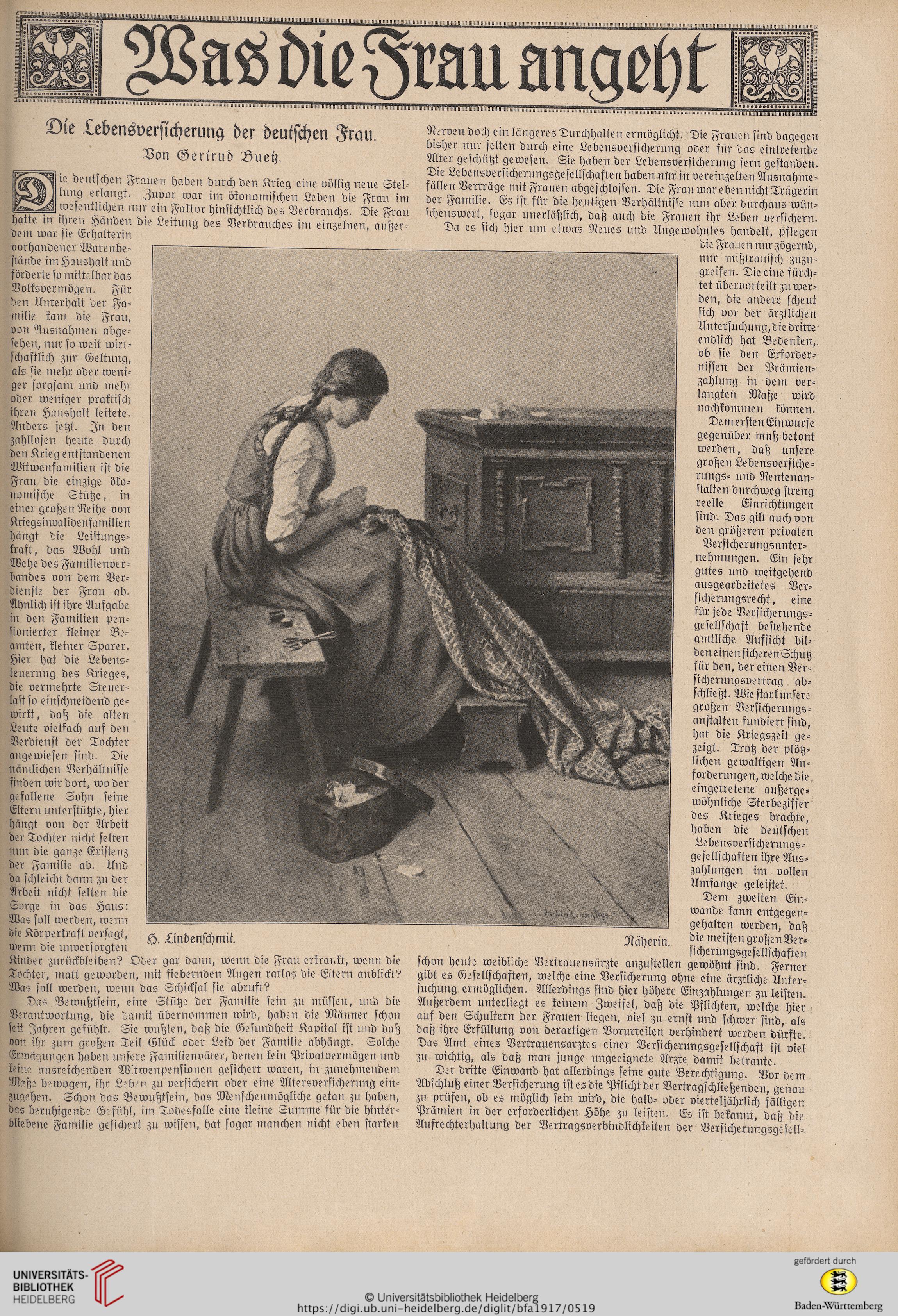Nerven doch ein längeres Durchhalten ermöglicht. Die Frauen sind dagegen
bisher nur selten durch eine Lebensversicherung oder für das eintretende
Alter geschützt gewesen. Sie haben der Lebensversicherung fern gestanden.
Die Lebensversicherungsgesellschaften haben nur in vereinzelten Ausnahme-
füllen Verträge mit Frauen abgeschlossen. Die Frau war eben nicht Trägerin
der Familie. Es ist für die heutigen Verhältnisse nun aber durchaus wün-
schenswert, sogar unerläßlich, daß auch die Frauen ihr Leben versichern.
Da es sich hier um etwas Neues und Ungewohntes handelt, pflegen
die Frauen nur zögernd,
nur mißtrauisch zuzu-
greifen. Die eine fürch-
tet übervorteilt zu wer-
den, die andere scheut
sich vor der ärztlichen
Untersuchung, die dritte
endlich hat Bedenken,
ob sie den Erforder-
nissen der Prämien-
zahlung in dem ver-
langten Maße wird
nachkommen können.
Dem ersten Einwurfe
gegenüber muß betont
werden, daß unsere
großen Lebensversiche-
rungs- und Rentenan-
stalten durchweg streng
reelle Einrichtungen
sind. Das gilt auch von
den größeren privaten
Versicherungsunter-
nehmungen. Ein sehr
gutes und weitgehend
ausgearbeitetes Ver-
sicherungsrecht, eine
für jede Versicherungs-
gesellschaft bestehende
amtliche Aufsicht bil-
den einen sicheren Schutz
für den, der einen Ver-
sicherungsvertrag ab-
schließt. Wie stark unsere
großen Versicherungs-
anstalten fundiert sind,
hat die Kriegszeit ge-
zeigt. Trotz der plötz-
lichen gewaltigen An-
forderungen, welche die
eingetretene außerge-
wöhnliche Sterbeziffer
des Krieges brachte,
haben die deutschen
Lebensversicherungs-
gesellschaften ihre Aus-
zahlungen im vollen
Umfange geleistet.
Dem zweiten Ein-
wande kann entgegen-
gehalten werden, daß
die meisten großen Ver-
sicherungsgesellschaften
schon heute weibliche Vertrauensärzte anzustellen gewöhnt sind. Ferner
gibt es Gesellschaften, welche eine Versicherung ohne eine ärztliche Unter-
suchung ermöglichen. Allerdings sind hier höhere Einzahlungen zu leisten.
Außerdem unterliegt es keinem Zweifel, daß die Pflichten, welche hier-
auf den Schultern der Frauen liegen, viel zu ernst und schwer sind, als
daß ihre Erfüllung von derartigen Vorurteilen verhindert werden dürste.
Das Amt eines Vertrauensarztes einer Versicherungsgesellschaft ist viel
zu wichtig, als daß man junge ungeeignete Ärzte damit betraute.
Der dritte Einwand hat allerdings seine gute Berechtigung. Vor dem
Abschluß einer Versicherung ist es die Pflicht der Vertragschließenden, genau
zu prüfen, ob es möglich sein wird, die halb- oder vierteljährlich fälligen
Prämien in der erforderlichen Höhe zu leisten. Es ist bekannt, daß die
Aufrechterhaltung der Vertragsverbindlichkeiten der Versicherungsgescll-
Naherin.
H. Lindenschmit.
Oie Lebensversicherung der deutschen Frau.
Von Gertrud Vueh.
ie deutschen Frauen haben durch den. Krieg eine völlig neue Stel-
lung erlangt. Zuvor war im ökonomischen Leben die Frau im
_I wesentlichen nur ein Faktor hinsichtlich des Verbrauchs. Die Frau
hatte in ihren Händen die Leitung des Verbrauches im einzelnen, außer-
dem war sie Erhalterin
vorhandener Warenbe¬
stände im Haushalt und
förderte so mittelbar das
Volksvermögen. Für
den Unterhalt der Fa¬
milie kam die Frau,
von Ausnahmen abge¬
sehen, nur so weit wirt¬
schaftlich zur Geltung,
als sie mehr oder weni¬
ger sorgsam und mehr
oder weniger praktisch
ihren Haushalt leitete.
Anders jetzt. In den
zahllosen heute durch
den Krieg entstandenen
Witwenfamilien ist die
Frau die einzige öko¬
nomische Stütze, in
einer großen Reihe von
Kriegsinvalidenfamilien
hängt die Leistungs¬
kraft, das Wohl und
Wehe des Familienver-
bandes von dem Ver¬
dienste der Frau ab.
Ähnlich ist ihre Aufgabe
in den Familien pen¬
sionierter kleiner Be¬
amten, kleiner Sparer.
Hier hat die Lebens¬
teuerung des Krieges,
die vermehrte Steuer¬
last so einschneidend ge¬
wirkt, daß die alten
Leute vielfach auf den
Verdienst der Tochter
angewiesen sind. Die
nämlichen Verhältnisse
finden wir dort, wo der
gefallene Sohn seine
Eltern unterstützte, hier
hängt von der Arbeit
der Tochter nicht selten
nun die ganze Existenz
der Familie ab. Und
da schleicht dann zu der
Arbeit nicht selten die
Sorge in das Haus:
Was soll werden, wenn
die Körperkraft versagt,
wenn die unversorgten
Kinder Zurückbleiben? Oder gar dann, wenn die Frau erkrankt, wenn die
Tochter, matt geworden, mit fiebernden Augen ratlos die Eltern anblick!?
Was soll werden, wenn das Schicksal sie abruft?
Das Bewußtsein, eine Stütze der Familie sein zu müssen, und die
Verantwortung, die damit übernommen wird, haben die Männer schon
seit Jahren gefühlt. Sie wußten, daß die Gesundheit Kapital ist und daß
von ihr zum großen Teil Glück oder Leid der Familie abhüngt. Solche
Erwäcmngen haben unsere Familienväter, denen kein Privatvermögen und
keine ausreichenden Witwenpensionen gesichert waren, in zunehmendem
Maße knwogen, ihr Leben zu versichern oder eine Altersversicherung ein-
zuaehen. Schon das Bewußtsein, das Menschenmögliche getan zu haben,
das beruhigende Gefühl, im Todesfälle eine kleine Summe für die Hinter-
bliebene Familie gesichert zu wissen, hat sogar manchen nicht eben starken