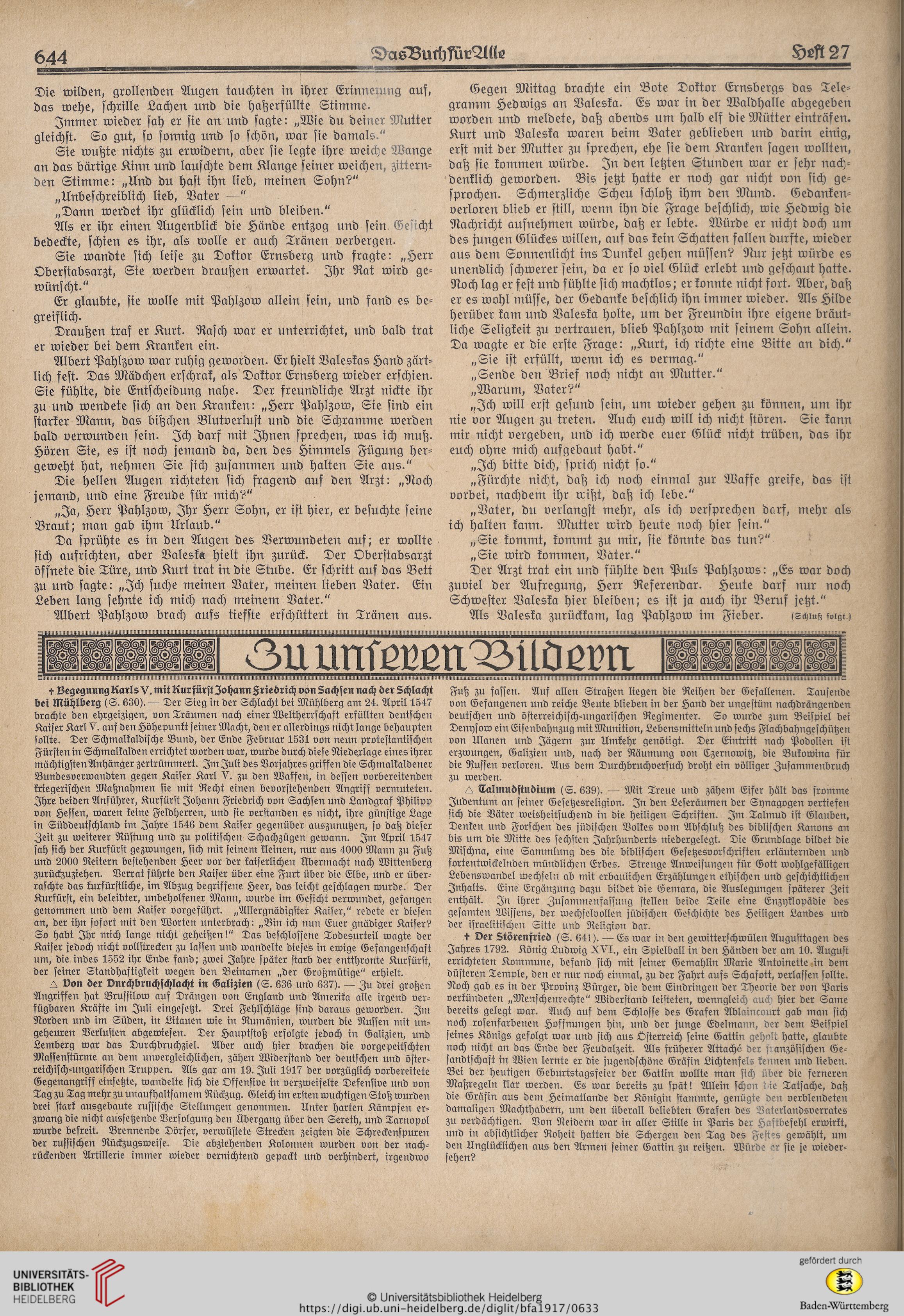DasBuchfüvAlls
SB 27
644
Die wilden, grollenden Augen tauchten in ihrer Erinnerung auf,
das wehe, schrille Lachen und die haßerfüllte Stimme.
Immer wieder sah er sie an und sagte: „Wie du deiner Mutter
gleichst. So gut, so sonnig und so schön, war sie damals
Sie wußte nichts zu erwidern, aber sie legte ihre weiche Wange
an das bärtige Kinn und lauschte dem Klange seiner weichen, zittern-
den Stimme: „Und du hast ihn lieb, meinen Sohn?"
„Unbeschreiblich lieb, Vater —"
„Dann werdet ihr glücklich sein und bleiben."
Als er ihr einen Augenblick die Hände entzog und sein Ge^ cht
bedeckte, schien es ihr, als wolle er auch Tränen verbergen.
Sie wandte sich leise zu Doktor Ernsberg und fragte: „Herr
Oberstabsarzt, Sie werden draußen erwartet. Ihr Rat wird ge-
wünscht."
Er glaubte, sie wolle mit Pahlzow allein sein, und fand es be-
greiflich.
Draußen traf er Kurt. Rasch war er unterrichtet, und bald trat
er wieder bei dem Kranken ein.
Albert Pahlzow war ruhig geworden. Erhielt Valeskas Hand zärt-
lich fest. Das Mädchen erschrak, als Doktor Ernsberg wieder erschien.
Sie fühlte, die Entscheidung nahe. Der freundliche Arzt nickte ihr
zu und wendete sich an den Kranken: „Herr Pahlzow, Sie sind ein
starker Mann, das bißchen Blutverlust und die Schramme werden
bald verwunden sein. Ich darf mit Ihnen sprechen, was ich muß.
Hören Sie, es ist noch jemand da, den des Himmels Fügung her-
geweht hat, nehmen Sie sich zusammen und halten Sie aus."
Die Hellen Augen richteten sich fragend auf den Arzt: „Noch
jemand, und eine Freude für mich?"
„Ja, Herr Pahlzow, Ihr Herr Sohn, er ist hier, er besuchte seine
Braut; man gab ihm Urlaub."
Da sprühte es in den Augen des Verwundeten auf; er wollte
sich aufrichten, aber Valeska hielt ihn zurück. Der Oberstabsarzt
öffnete die Türe, und Kurt trat in die Stube. Er schritt auf das Bett
zu und sagte: „Ich suche meinen Vater, meinen lieben Vater. Ein
Leben lang sehnte ich mich nach meinem Vater."
Albert Pahlzow brach aufs tiefste erschüttert in Tränen aus.
Gegen Mittag brachte ein Bote Doktor Ernsbergs das Tele-
gramm Hedwigs an Valeska. Es war in der Waldhalle abgegeben
worden und meldete, daß abends um halb elf die Mütter einträfen.
Kurt und Valeska waren beim Vater geblieben und darin einig,
erst mit der Mutter Zu sprechen, ehe sie dem Kranken sagen wollten,
daß sie kommen würde. In den letzten Stunden war er sehr nach-
denklich geworden. Bis jetzt hatte er noch gar nicht von sich ge-
sprochen. Schmerzliche Scheu schloß ihm den Mund. Gedanken-
verloren blieb er still, wenn ihn die Frage beschlich, wie Hedwig die
Nachricht aufnehmen würde, daß er lebte. Würde er nicht doch um
des jungen Glückes willen, auf das kein Schatten fallen durfte, wieder
aus dem Sonnenlicht ins Dunkel gehen müssen? Nur jetzt würde es
unendlich schwerer sein, da er so viel Glück erlebt und geschaut hatte.
Noch lag er fest und fühlte sich machtlos; er konnte nicht fort. Aber, daß
er es wohl müsse, der Gedanke beschlich ihn immer wieder. Als Hilde
herüber kam und Valeska holte, um der Freundin ihre eigene bräut-
liche Seligkeit zu vertrauen, blieb Pahlzow mit seinem Sohn allein.
Da wagte er die erste Frage: „Kurt, ich richte eine Bitte an dich."
„Sie ist erfüllt, wenn ich es vermag."
„Sende den Brief noch nichr an Mutter."
„Warum, Vater?"
„Ich will erst gesund sein, um wieder gehen zu können, um ihr
nie vor Augen zu treten. Auch euch will ich nicht stören. Sie kann
mir nicht vergeben, und ich werde euer Glück nicht trüben, das ihr
euch ohne mich aufgebaut habt."
„Ich bitte dich, sprich nicht so."
„Fürchte nicht, daß ich noch einmal zur Waffe greife, das ist
vorbei, nachdem ihr wißt, daß ich lebe."
„Vater, du verlangst mehr, als ich versprechen darf, mehr als
ich halten kann. Mutter wird heute noch hier sein."
„Sie kommt, kommt zu mir, sie könnte das tun?"
„Sie wird kommen, Väter."
Der Arzt trat ein und fühlte den Puls Pahlzows: „Es war doch
zuviel der Aufregung, Herr Referendar. Heute darf nur noch
Schwester Valeska hier bleiben; es ist ja auch ihr Beruf jetzt."
Als Valeska zurückkam, lag Pahlzow im Fieber. (Schluß folgt.)
WWW8W
L>u unsMeuVllüevn.
WWKKW
-r- Begegnung Karls V.mil Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen nach der Schlacht
bei Mühlberg (S. 630). — Der Sieg in der Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1847
brachte den ehrgeizigen, von Träumen nach einer Weltherrschaft erfüllten deutschen
Kaiser Karl V. auf den Höhepunkt seiner Macht, den er allerdings nicht lange behaupten
sollte. Der Schmalkaldische Bund, der Ende Februar 1531 von neun protestantischen
Fürsten in Schmalkalden errichtet worden war, wurde durch diese Niederlage eines ihrer
mächtigsten Anhänger zertrümmert. Im Juli des Vorjahres griffen die Schmalkaldener
Bundesverwandten gegen Kaiser Karl V. zu den Waffen, in dessen vorbereitenden
kriegerischen Maßnahmen sie mit Recht einen bevorstehenden Angriff vermuteten.
Ihre beiden Anführer, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp
von Hessen, waren keine Feldherren, und sie verstanden es nicht, ihre günstige Lage
in Süddeutschland im Jahre 1546 dem Kaiser gegenüber auszunutzen, so daß dieser
Zeit zu weiterer Rüstung und zu politischen Schachzügen gewann. Im April 1547
sah sich der Kurfürst gezwungen, sich mit seinem kleinen, nur aus 4000 Mann zu Fuß
und 2000 Reitern bestehenden Heer vor der kaiserlichen Übermacht nach Wittenberg
zurückzuziehen. Verrat führte den Kaiser über eine Furt über die Elbe, und er über-
raschte das kurfürstliche, im Abzug begriffene Heer, das leicht geschlagen wurde. Der
Kurfürst, ein beleibter, unbeholfener Mann, wurde im Gesicht verwundet, gefangen
genommen und dem Kaiser vorgeführt. „Allergnädigster Kaiser," redete er diesen
an, der ihn sofort mit den Worten unterbrach: „Bin ich nun Euer gnädiger Kaiser?
So habt Ihr mich lange nicht geheißen!" Das beschlossene Todesurteil wagte der
Kaiser jedoch nicht vollstrecken zu lassen und wandelte dieses in ewige Gefangenschaft
um, die indes 1552 ihr Ende fand; zwei Jahre später starb der entthronte Kurfürst,
der seiner Standhaftigkeit wegen den Beinamen „der Großmütige" erhielt.
X von der Durchbruch schlacht in Galizien (S. 636 und 637). — Zu drei großen
Angriffen hat Brussilow auf Drängen von England und Amerika alle irgend ver-
fügbaren Kräfte im Juli eingesetzt. Drei Fehlschläge sind daraus geworden. In:
Norden und im Süden, in Litauen wie in Rumänien, wurden die Russen mit un-
geheuren Verlusten abgewiesen. Der Hauptstoß erfolgte jedoch in Galizien, und
Lemberg war das Durchbruchziel. Aber auch hier brachen die vorgepeitschten
Massenstürme an dem unvergleichlichen, zähen Widerstand der deutschen und öster-
reichisch-ungarischen Truppen. Als gar am 19. Juli 1917 der vorzüglich vorbereitete
Gegenangriff einsetzte, wandelte sich die Offensive in verzweifelte Defensive und von
Tag zu Tag mehr zu unaufhaltsamem Rückzug. Gleich im ersten wuchtigen Stoß wurden
drei stark ausgebaute russische Stellungen genommen. Unter harten Kämpfen er-
zwang die nicht aussetzende Verfolgung den Übergang über den Sereth, und Tarnopol
wurde befreit. Brennende Dörfer, verwüstete Strecken zeigten die Schreckenspuren
der russischen Rückzugsweise. Die abziehenden Kolonnen wurden von der nach-
rückenden Artillerie immer wieder vernichtend gepackt und verhindert, irgendwo
Fuß zu fassen. Auf allen Straßen liegen die Reihen der Gefallenen. Tausende
von Gefangenen und reiche Beute blieben in der Hand der ungestüm nachdrängenden
deutschen und österreichisch-ungarischen Regimenter. So wurde zum Beispiel bei
Denysow ein Eisenbahnzug mit Munition, Lebensmitteln und sechs Flachbahngeschützen
von Ulanen und Jägern zur Umkehr genötigt. Der Eintritt nach Podolien ist
erzwungen, Galizien und, nach der Räumung von Czernowitz, die Bukowina für
die Russen verloren. Aus dem Durchbruchversuch droht ein völliger Zusammenbruch
zu werden.
X Talmudstudium (S. 639). — Mit Treue und zähem Eifer hält das fromme
Judentum an seiner Gesetzesreligion. In den Leseräumen der Synagogen vertiefen
sich die Väter weisheitsuchend in die heiligen Schriften. Im Talmud ist Glauben,
Denken und Forschen des jüdischen Volkes vom Abschluß des biblischen Kanons an
bis um die Mitte des sechsten Jahrhunderts niedergelegt. Die Grundlage bildet die
Mischna, eine Sammlung des die biblischen Gesetzesvorschriften erläuternden und
fortentwickelnden mündlichen Erbes. Strenge Anweisungen für Gott wohlgefälligen
Lebenswandel wechseln ab mit erbaulichen Erzählungen ethischen und geschichtlichen
Inhalts. Eine Ergänzung dazu bildet die Eemara, die Auslegungen späterer Zeit
enthält. In ihrer Zusammenfassung stellen beide Teile eine Enzyklopädie des
gesamten Wissens, der wechselvollen jüdischen Geschichte des Heiligen Landes und
der israelitischen Sitte und Religion dar.
1- Der Störenfried (S. 641). — Es war in den gewitterschwülen Augusttagen des
Jahres 1792. König Ludwig XVI., ein Spielball in den Händen der am 10. August
errichteter: Kommune, befand sich mit seiner Gemahlin Marie Antoinette in dem
düsteren Temple, den er nur noch einmal, zu der Fahrt aufs Schafott, verlassen sollte.
Noch gab es in der Provinz Bürger, die dem Eindringen der Theorie der von Paris
verkündeten „Menschenrechte" Widerstand leisteten, wenngleich > ux hier der Same
bereits gelegt war. Auch auf dem Schlosse des Grafen Ablmncl urt gab man sich
noch rosenfarbenen Hoffnungen hin, und der junge Edelma m, der dem Beispiel
seines Königs gefolgt war und sich aus Österreich seine Gattin gehXr hatte, glaubte
noch nicht an das Ende der Feudalzeit. Als früherer Attache der i anzösischen Ge-
sandtschaft in Wien lernte er die jugendschöne Gräfin Lichtenfeie kennen und lieben.
Bei der heutigen Geburtstagsfeier der Gattin wollte man sick : er die ferneren
Maßregeln klar werden. Es war bereits zu spät! Allein scher ie Tatsache, daß
die Gräfin aus dem Heimatlande der Königin stammte, genüge den verblendeten
damaligen Machthabern, um den überall beliebten Grafen des Vaterlandsverrates
zu verdächtigen. Von Neidern war in aller Stille in Paris der >, -befehl erwirkt,
und in absichtlicher Roheit hatten die Schergen den Tag des Feiles gewählt, um
den Unglücklichen aus den Armen seiner Gattin zu reißen. Würde er sie je Wieder-
sehen?
SB 27
644
Die wilden, grollenden Augen tauchten in ihrer Erinnerung auf,
das wehe, schrille Lachen und die haßerfüllte Stimme.
Immer wieder sah er sie an und sagte: „Wie du deiner Mutter
gleichst. So gut, so sonnig und so schön, war sie damals
Sie wußte nichts zu erwidern, aber sie legte ihre weiche Wange
an das bärtige Kinn und lauschte dem Klange seiner weichen, zittern-
den Stimme: „Und du hast ihn lieb, meinen Sohn?"
„Unbeschreiblich lieb, Vater —"
„Dann werdet ihr glücklich sein und bleiben."
Als er ihr einen Augenblick die Hände entzog und sein Ge^ cht
bedeckte, schien es ihr, als wolle er auch Tränen verbergen.
Sie wandte sich leise zu Doktor Ernsberg und fragte: „Herr
Oberstabsarzt, Sie werden draußen erwartet. Ihr Rat wird ge-
wünscht."
Er glaubte, sie wolle mit Pahlzow allein sein, und fand es be-
greiflich.
Draußen traf er Kurt. Rasch war er unterrichtet, und bald trat
er wieder bei dem Kranken ein.
Albert Pahlzow war ruhig geworden. Erhielt Valeskas Hand zärt-
lich fest. Das Mädchen erschrak, als Doktor Ernsberg wieder erschien.
Sie fühlte, die Entscheidung nahe. Der freundliche Arzt nickte ihr
zu und wendete sich an den Kranken: „Herr Pahlzow, Sie sind ein
starker Mann, das bißchen Blutverlust und die Schramme werden
bald verwunden sein. Ich darf mit Ihnen sprechen, was ich muß.
Hören Sie, es ist noch jemand da, den des Himmels Fügung her-
geweht hat, nehmen Sie sich zusammen und halten Sie aus."
Die Hellen Augen richteten sich fragend auf den Arzt: „Noch
jemand, und eine Freude für mich?"
„Ja, Herr Pahlzow, Ihr Herr Sohn, er ist hier, er besuchte seine
Braut; man gab ihm Urlaub."
Da sprühte es in den Augen des Verwundeten auf; er wollte
sich aufrichten, aber Valeska hielt ihn zurück. Der Oberstabsarzt
öffnete die Türe, und Kurt trat in die Stube. Er schritt auf das Bett
zu und sagte: „Ich suche meinen Vater, meinen lieben Vater. Ein
Leben lang sehnte ich mich nach meinem Vater."
Albert Pahlzow brach aufs tiefste erschüttert in Tränen aus.
Gegen Mittag brachte ein Bote Doktor Ernsbergs das Tele-
gramm Hedwigs an Valeska. Es war in der Waldhalle abgegeben
worden und meldete, daß abends um halb elf die Mütter einträfen.
Kurt und Valeska waren beim Vater geblieben und darin einig,
erst mit der Mutter Zu sprechen, ehe sie dem Kranken sagen wollten,
daß sie kommen würde. In den letzten Stunden war er sehr nach-
denklich geworden. Bis jetzt hatte er noch gar nicht von sich ge-
sprochen. Schmerzliche Scheu schloß ihm den Mund. Gedanken-
verloren blieb er still, wenn ihn die Frage beschlich, wie Hedwig die
Nachricht aufnehmen würde, daß er lebte. Würde er nicht doch um
des jungen Glückes willen, auf das kein Schatten fallen durfte, wieder
aus dem Sonnenlicht ins Dunkel gehen müssen? Nur jetzt würde es
unendlich schwerer sein, da er so viel Glück erlebt und geschaut hatte.
Noch lag er fest und fühlte sich machtlos; er konnte nicht fort. Aber, daß
er es wohl müsse, der Gedanke beschlich ihn immer wieder. Als Hilde
herüber kam und Valeska holte, um der Freundin ihre eigene bräut-
liche Seligkeit zu vertrauen, blieb Pahlzow mit seinem Sohn allein.
Da wagte er die erste Frage: „Kurt, ich richte eine Bitte an dich."
„Sie ist erfüllt, wenn ich es vermag."
„Sende den Brief noch nichr an Mutter."
„Warum, Vater?"
„Ich will erst gesund sein, um wieder gehen zu können, um ihr
nie vor Augen zu treten. Auch euch will ich nicht stören. Sie kann
mir nicht vergeben, und ich werde euer Glück nicht trüben, das ihr
euch ohne mich aufgebaut habt."
„Ich bitte dich, sprich nicht so."
„Fürchte nicht, daß ich noch einmal zur Waffe greife, das ist
vorbei, nachdem ihr wißt, daß ich lebe."
„Vater, du verlangst mehr, als ich versprechen darf, mehr als
ich halten kann. Mutter wird heute noch hier sein."
„Sie kommt, kommt zu mir, sie könnte das tun?"
„Sie wird kommen, Väter."
Der Arzt trat ein und fühlte den Puls Pahlzows: „Es war doch
zuviel der Aufregung, Herr Referendar. Heute darf nur noch
Schwester Valeska hier bleiben; es ist ja auch ihr Beruf jetzt."
Als Valeska zurückkam, lag Pahlzow im Fieber. (Schluß folgt.)
WWW8W
L>u unsMeuVllüevn.
WWKKW
-r- Begegnung Karls V.mil Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen nach der Schlacht
bei Mühlberg (S. 630). — Der Sieg in der Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1847
brachte den ehrgeizigen, von Träumen nach einer Weltherrschaft erfüllten deutschen
Kaiser Karl V. auf den Höhepunkt seiner Macht, den er allerdings nicht lange behaupten
sollte. Der Schmalkaldische Bund, der Ende Februar 1531 von neun protestantischen
Fürsten in Schmalkalden errichtet worden war, wurde durch diese Niederlage eines ihrer
mächtigsten Anhänger zertrümmert. Im Juli des Vorjahres griffen die Schmalkaldener
Bundesverwandten gegen Kaiser Karl V. zu den Waffen, in dessen vorbereitenden
kriegerischen Maßnahmen sie mit Recht einen bevorstehenden Angriff vermuteten.
Ihre beiden Anführer, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp
von Hessen, waren keine Feldherren, und sie verstanden es nicht, ihre günstige Lage
in Süddeutschland im Jahre 1546 dem Kaiser gegenüber auszunutzen, so daß dieser
Zeit zu weiterer Rüstung und zu politischen Schachzügen gewann. Im April 1547
sah sich der Kurfürst gezwungen, sich mit seinem kleinen, nur aus 4000 Mann zu Fuß
und 2000 Reitern bestehenden Heer vor der kaiserlichen Übermacht nach Wittenberg
zurückzuziehen. Verrat führte den Kaiser über eine Furt über die Elbe, und er über-
raschte das kurfürstliche, im Abzug begriffene Heer, das leicht geschlagen wurde. Der
Kurfürst, ein beleibter, unbeholfener Mann, wurde im Gesicht verwundet, gefangen
genommen und dem Kaiser vorgeführt. „Allergnädigster Kaiser," redete er diesen
an, der ihn sofort mit den Worten unterbrach: „Bin ich nun Euer gnädiger Kaiser?
So habt Ihr mich lange nicht geheißen!" Das beschlossene Todesurteil wagte der
Kaiser jedoch nicht vollstrecken zu lassen und wandelte dieses in ewige Gefangenschaft
um, die indes 1552 ihr Ende fand; zwei Jahre später starb der entthronte Kurfürst,
der seiner Standhaftigkeit wegen den Beinamen „der Großmütige" erhielt.
X von der Durchbruch schlacht in Galizien (S. 636 und 637). — Zu drei großen
Angriffen hat Brussilow auf Drängen von England und Amerika alle irgend ver-
fügbaren Kräfte im Juli eingesetzt. Drei Fehlschläge sind daraus geworden. In:
Norden und im Süden, in Litauen wie in Rumänien, wurden die Russen mit un-
geheuren Verlusten abgewiesen. Der Hauptstoß erfolgte jedoch in Galizien, und
Lemberg war das Durchbruchziel. Aber auch hier brachen die vorgepeitschten
Massenstürme an dem unvergleichlichen, zähen Widerstand der deutschen und öster-
reichisch-ungarischen Truppen. Als gar am 19. Juli 1917 der vorzüglich vorbereitete
Gegenangriff einsetzte, wandelte sich die Offensive in verzweifelte Defensive und von
Tag zu Tag mehr zu unaufhaltsamem Rückzug. Gleich im ersten wuchtigen Stoß wurden
drei stark ausgebaute russische Stellungen genommen. Unter harten Kämpfen er-
zwang die nicht aussetzende Verfolgung den Übergang über den Sereth, und Tarnopol
wurde befreit. Brennende Dörfer, verwüstete Strecken zeigten die Schreckenspuren
der russischen Rückzugsweise. Die abziehenden Kolonnen wurden von der nach-
rückenden Artillerie immer wieder vernichtend gepackt und verhindert, irgendwo
Fuß zu fassen. Auf allen Straßen liegen die Reihen der Gefallenen. Tausende
von Gefangenen und reiche Beute blieben in der Hand der ungestüm nachdrängenden
deutschen und österreichisch-ungarischen Regimenter. So wurde zum Beispiel bei
Denysow ein Eisenbahnzug mit Munition, Lebensmitteln und sechs Flachbahngeschützen
von Ulanen und Jägern zur Umkehr genötigt. Der Eintritt nach Podolien ist
erzwungen, Galizien und, nach der Räumung von Czernowitz, die Bukowina für
die Russen verloren. Aus dem Durchbruchversuch droht ein völliger Zusammenbruch
zu werden.
X Talmudstudium (S. 639). — Mit Treue und zähem Eifer hält das fromme
Judentum an seiner Gesetzesreligion. In den Leseräumen der Synagogen vertiefen
sich die Väter weisheitsuchend in die heiligen Schriften. Im Talmud ist Glauben,
Denken und Forschen des jüdischen Volkes vom Abschluß des biblischen Kanons an
bis um die Mitte des sechsten Jahrhunderts niedergelegt. Die Grundlage bildet die
Mischna, eine Sammlung des die biblischen Gesetzesvorschriften erläuternden und
fortentwickelnden mündlichen Erbes. Strenge Anweisungen für Gott wohlgefälligen
Lebenswandel wechseln ab mit erbaulichen Erzählungen ethischen und geschichtlichen
Inhalts. Eine Ergänzung dazu bildet die Eemara, die Auslegungen späterer Zeit
enthält. In ihrer Zusammenfassung stellen beide Teile eine Enzyklopädie des
gesamten Wissens, der wechselvollen jüdischen Geschichte des Heiligen Landes und
der israelitischen Sitte und Religion dar.
1- Der Störenfried (S. 641). — Es war in den gewitterschwülen Augusttagen des
Jahres 1792. König Ludwig XVI., ein Spielball in den Händen der am 10. August
errichteter: Kommune, befand sich mit seiner Gemahlin Marie Antoinette in dem
düsteren Temple, den er nur noch einmal, zu der Fahrt aufs Schafott, verlassen sollte.
Noch gab es in der Provinz Bürger, die dem Eindringen der Theorie der von Paris
verkündeten „Menschenrechte" Widerstand leisteten, wenngleich > ux hier der Same
bereits gelegt war. Auch auf dem Schlosse des Grafen Ablmncl urt gab man sich
noch rosenfarbenen Hoffnungen hin, und der junge Edelma m, der dem Beispiel
seines Königs gefolgt war und sich aus Österreich seine Gattin gehXr hatte, glaubte
noch nicht an das Ende der Feudalzeit. Als früherer Attache der i anzösischen Ge-
sandtschaft in Wien lernte er die jugendschöne Gräfin Lichtenfeie kennen und lieben.
Bei der heutigen Geburtstagsfeier der Gattin wollte man sick : er die ferneren
Maßregeln klar werden. Es war bereits zu spät! Allein scher ie Tatsache, daß
die Gräfin aus dem Heimatlande der Königin stammte, genüge den verblendeten
damaligen Machthabern, um den überall beliebten Grafen des Vaterlandsverrates
zu verdächtigen. Von Neidern war in aller Stille in Paris der >, -befehl erwirkt,
und in absichtlicher Roheit hatten die Schergen den Tag des Feiles gewählt, um
den Unglücklichen aus den Armen seiner Gattin zu reißen. Würde er sie je Wieder-
sehen?