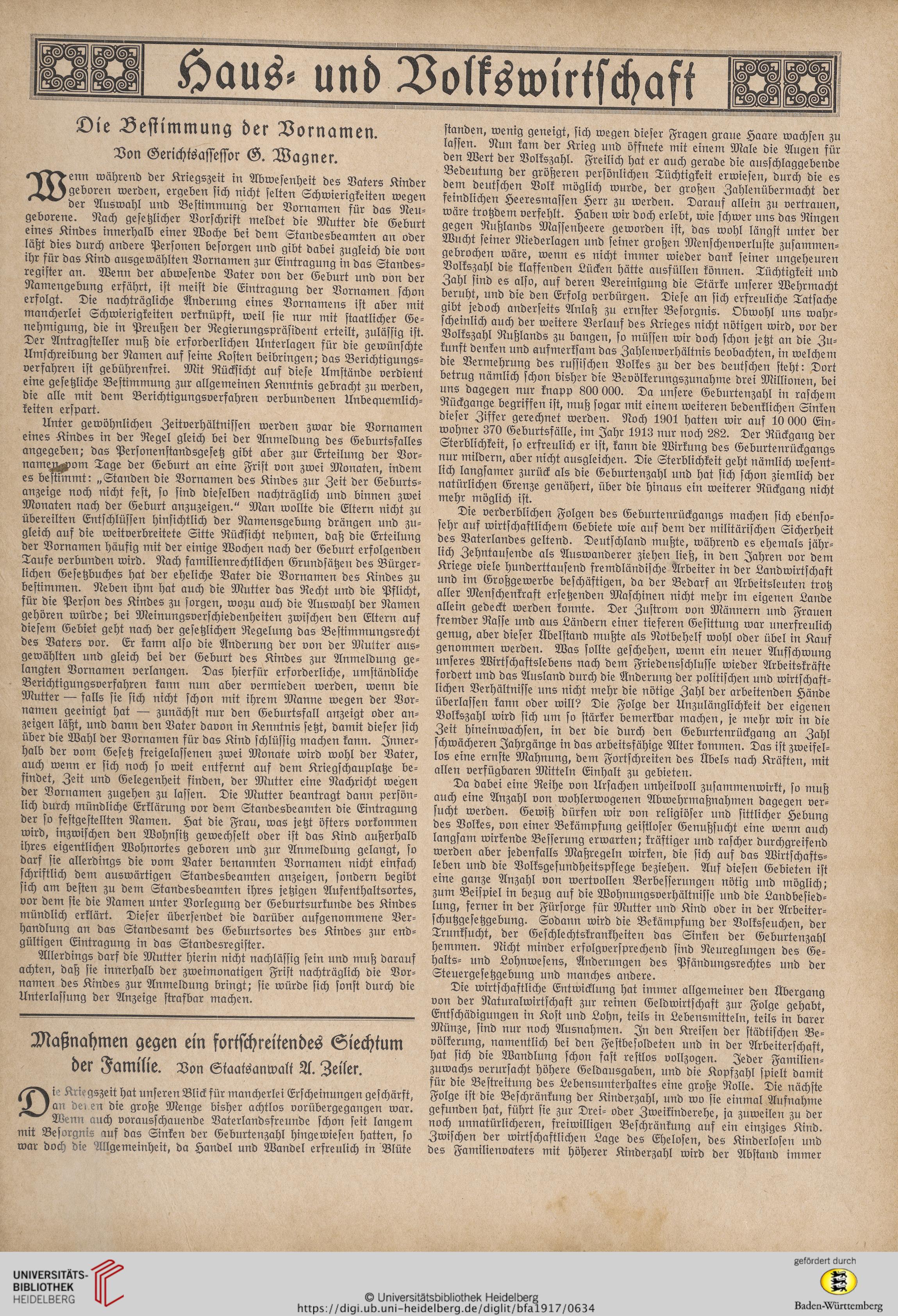Oie Bestimmung der Vornamen.
Von Gerichisaffessor G. Wagner.
enn während der Kriegszeit in Abwesenheit des Vaters Kinder
geboren werden, ergeben sich nicht selten Schwierigkeiten wegen
der Auswahl und Bestimmung der Vornamen für das Neu-
geborene. Nach gesetzlicher Vorschrift meldet die Mutter die Geburt
eines Kindes innerhalb einer Woche bei dem Standesbeamten an oder
läßt dies durch andere Personen besorgen und gibt dabei zugleich die von
ihr für das Kind ausgewählten Vornamen zur Eintragung in das Standes-
register an. Wenn der abwesende Vater von der Geburt und von der
Namengebung erfährt, ist meist die Eintragung der Vornamen schon
erfolgt. Die nachträgliche Änderung eines Vornamens ist aber mit
mancherlei Schwierigkeiten verknüpft, weil sie nur mit staatlicher Ge-
nehmigung, die in Preußen der Regierungspräsident erteilt, zulässig ist.
Der Antragsteller mutz die erforderlichen Unterlagen für die gewünschte
Umschreibung der Namen auf seine Kosten beibringen; das Berichtigungs-
verfahren ist gebührenfrei. Mit Rücksicht auf diese Umstände verdient
eine gesetzliche Bestimmung zur allgemeinen Kenntnis gebracht zu werden,
die alle mit dem Berichtigungsverfahren verbundenen Unbequemlich-
keiten erspart.
Unter gewöhnlichen Zeitverhältnissen werden zwar die Vornamen
eines Kindes in der Regel gleich bei der Anmeldung des Geburtsfalles
angegeben; das Personenstandsgesetz gibt aber zur Erteilung der Vor-
namMKwm Tage der Geburt an eine Frist von zwei Monaten, indem
es bestimmt: „Standen die Vornamen des Kindes zur Zeit der Geburts-
anzeige noch nicht fest, so sind dieselben nachträglich und binnen zwei
Monaten nach der Geburt anzuzeigen." Man wollte die Eltern nicht zu
übereilten Entschlüssen hinsichtlich der Namensgebung drängen und zu-
gleich auf die weitverbreitete Sitte Rücksicht nehmen, daß die Erteilung
der Vornamen häufig mit der einige Wochen nach der Geburt erfolgenden
Taufe verbunden wird. Nach familienrechtlichen Grundsätzen des Bürger-
lichen Gesetzbuches hat der eheliche Vater die Vornamen des Kindes zu
bestimmen. Neben ihm hat auch die Mutter das Recht und die Pflicht,
für die Person des Kindes zu sorgen, wozu auch die Auswahl der Namen
gehören würde; bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern auf
diesem Gebiet geht nach der gesetzlichen Regelung das Bestimmungsrecht
des Vaters vor. Er kann also die Änderung der von der Mutter aus-
gewählten und gleich bei der Geburt des Kindes zur Anmeldung ge-
langten Vornamen verlangen. Das hierfür erforderliche, umständliche
Berichtigungsverfahren kann nun aber vermieden werden, wenn die
Mutter — falls sie sich nicht schon mit ihrem Manne wegen der Vor-
namen geeinigt hat — zunächst nur den Geburtsfall anzeigt oder an-
zeigen läßt, und dann den Vater davon in Kenntnis setzt, damit dieser sich
über die Wahl der Vornamen für das Kind schlüssig machen kann. Inner-
halb der vom Gesetz freigelassenen zwei Monate wird wohl der Vater,
auch wenn er sich noch so weit entfernt auf dem Kriegschauplatze be-
findet, Zeit und Gelegenheit finden, der Mutter eine Nachricht wegen
der Vornamen zugehen zu lassen. Die Mutter beantragt dann persön-
lich durch mündliche Erklärung vor dem Standesbeamten die Eintragung
der so festgestellten Namen. Hat die Frau, was jetzt öfters vorkommen
wird, inzwischen den Wohnsitz gewechselt oder ist das Kind außerhalb
ihres eigentlichen Wohnortes geboren und zur Anmeldung gelangt, so
darf sie allerdings die vom Vater benannten Vornamen nicht einfach
schriftlich dem auswärtigen Standesbeamten anzeigen, sondern begibt
sich am besten zu dem Standesbeamten ihres jetzigen Aufenthaltsortes,
vor dem sie die Namen unter Vorlegung der Geburtsurkunde des Kindes
mündlich erklärt. Dieser übersendet die darüber aufgenommene Ver-
handlung an das Standesamt des Geburtsortes des Kindes zur end-
gültigen Eintragung in das Standesregister.
Allerdings darf die Mutter hierin nicht nachlässig sein und muß darauf
achten, daß sie innerhalb der zweimonatigen Frist nachträglich die Vor-
namen des Kindes zur Anmeldung bringt; sie würde sich sonst durch die
Unterlassung der Anzeige strafbar machen.
Maßnahmen gegen ein fortschreitendes Siechtum
der Familie. Von Staatsanwall A. Zeller.
i K gszeit hat unseren Blick für mancherlei Erscheinungen geschärft,
an de> en die große Menge bisher achtlos vorübergegangen war.
Wenn auch vorausschauende Vaterlandsfreunde schon seit langem
mit Besorgnis auf das Sinken der Geburtenzahl hingewiesen hatten, so
war doch die Allgemeinheit, da Handel und Wandel erfreulich in Blüte
standen, wenig geneigt, sich wegen dieser Fragen graue Haare wachsen zu
lassen. Nun kam der Krieg und öffnete mit einem Male die Augen für
den Wert der Volkszahl. Freilich hat er auch gerade die ausschlaggebende
Bedeutung der größeren persönlichen Tüchtigkeit erwiesen, durch die es
dem deutschen Volk möglich wurde, der großen Zahlenübermacht der
feindlichen Heeresmassen Herr zu werden. Darauf allein zu vertrauen,
wäre trotzdem verfehlt. Haben wir doch erlebt, wie schwer uns das Ringen
gegen Rußlands Massenheere geworden ist, das wohl längst unter der
Wucht seiner Niederlagen und seiner großen Menschenverluste zusammen-
gebrochen wäre, wenn es nicht immer wieder dank seiner ungeheuren
Volkszahl die klaffenden Lücken hätte ausfüllen können. Tüchtigkeit und
Zahl sind es also, auf deren Vereinigung die Stärke unserer Wehrmacht
beruht, und die den Erfolg verbürgen. Diese an sich erfreuliche Tatsache
gibt jedoch anderseits Anlaß zu ernster Besorgnis. Obwohl uns wahr-
scheinlich auch der weitere Verlauf des Krieges nicht nötigen wird, vor der
Volkszahl Rußlands zu bangen, so müssen wir doch schon jetzt an die Zu-
kunft denken und aufmerksam das Zahlenverhältnis beobachten, in welchem
die Vermehrung des russischen Volkes zu der des deutschen steht: Dort
betrug nämlich schon bisher die Bevölkerungszunahme drei Millionen, bei
uns dagegen nur knapp 800 000. Da unsere Geburtenzahl in raschem
Rückgänge begriffen ist, muß sogar mit einem weiteren bedenklichen Sinken
dieser Ziffer gerechnet werden. Noch 1901 hatten wir auf 10 000 Ein-
wohner 370 Geburtsfälle, im Jahr 1913 nur noch 282. Der Rückgang der
Sterblichkeit, so erfreulich er ist, kann die Wirkung des Geburtenrückgangs
nur mildern, aber nicht ausgleichen. Die Sterblichkeit geht nämlich wesent-
lich langsamer zurück als die Geburtenzahl und hat sich schon ziemlich der
natürlichen Grenze genähert, über die hinaus ein weiterer Rückgang nicht
mehr möglich ist.
Die verderblichen Folgen des Geburtenrückgangs machen sich ebenso-
sehr auf wirtschaftlichem Gebiete wie auf dem der militärischen Sicherheit
des Vaterlandes geltend. Deutschland mußte, während es ehemals jähr-
lich Zehntausende als Auswanderer ziehen ließ, in den Jahren vor dem
Kriege viele hunderttausend fremdländische Arbeiter in der Landwirtschaft
und im Großgewerbe beschäftigen, da der Bedarf an Arbeitsleuten trotz
aller Menschenkraft ersetzenden Maschinen nicht mehr im eigenen Lande
allein gedeckt werden konnte. Der Zustrom von Männern und Frauen
fremder Rasse und aus Ländern einer tieferen Gesittung war unerfreulich
genug, aber dieser Melstand mußte als Notbehelf wohl oder übel in Kauf
genommen werden. Was sollte geschehen, wenn ein neuer Aufschwung
unseres Wirtschaftslebens nach dem Friedensschlüsse wieder Arbeitskräfte
fordert und das Ausland durch die Änderung der politischen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse uns nicht mehr die nötige Zahl der arbeitenden Hände
überlassen kann oder will? Die Folge der Unzulänglichkeit der eigenen
Volkszahl wird sich um so stärker bemerkbar machen, je mehr wir in die
Zeit hineinwachsen, in der die durch den Geburtenrückgang an Zahl
schwächeren Jahrgänge in das arbeitsfähige Alter kommen. Das ist zweifel-
los eine ernste Mahnung, dem Fortschreiten des Übels nach Kräften, mit
allen verfügbaren Mitteln Einhalt zu gebieten.
Da dabei eine Reihe von Ursachen unheilvoll zusammenwirkt, so muß
auch eine Anzahl von wohlerwogenen Abwehrmaßnahmen dagegen ver-
sucht werden. Gewiß dürfen wir von religiöser und sittlicher Hebung
des Volkes, von einer Bekämpfung geistloser Genußsucht eine wenn auch
langsam wirkende Besserung erwarten; kräftiger und rascher durchgreifend
werden aber jedenfalls Maßregeln wirken, die sich auf das Wirtschafts-
leben und die Volksgesundheitspflege beziehen. Auf diesen Gebieten ist
eine ganze Anzahl von wertvollen Verbesserungen nötig und möglich;
zum Beispiel in bezug auf die Wohnungsverhältnisse und die Landbesied-
lung, ferner in der Fürsorge für Mutter und Kind oder in der Arbeiter-
schutzgesetzgebung. Sodann wird die Bekämpfung der Volksseuchen, der
Trunksucht, der Geschlechtskrankheiten das Sinken der Geburtenzahl
hemmen. Nicht minder erfolgversprechend sind Neureglungen des Ge-
halts- und Lohnwesens, Änderungen des Pfändungsrechtes und der
Steuergesetzgebung und manches andere.
Die wirtschaftliche Entwicklung hat immer allgemeiner den Übergang
von der Naturalwirtschaft zur reinen Geldwirtschaft zur Folge gehabt,
Entschädigungen in Kost und Lohn, teils in Lebensmitteln, teils in barer
Münze, sind nur noch Ausnahmen. In den Kreisen der städtischen Be-
völkerung, namentlich bei den Festbesoldeten und in der Arbeiterschaft,
hat sich die Wandlung schon fast restlos vollzogen. Jeder Familien-
zuwachs verursacht höhere Geldausgaben, und die Kopfzahl spielt damit
für die Bestreitung des Lebensunterhaltes eine große Rolle. Die nächste
Folge ist die Beschränkung der Kinderzahl, und wo sie einmal Aufnahme
gefunden hat, führt sie zur Drei- oder Zweikinderehe, ja zuweilen zu der
noch unnatürlicheren, freiwilligen Beschränkung auf ein einziges Kind.
Zwischen der wirtschaftlichen Lage des Ehelosen, des Kinderlosen und
des Familienvaters mit höherer Kinderzahl wird der Abstand immer