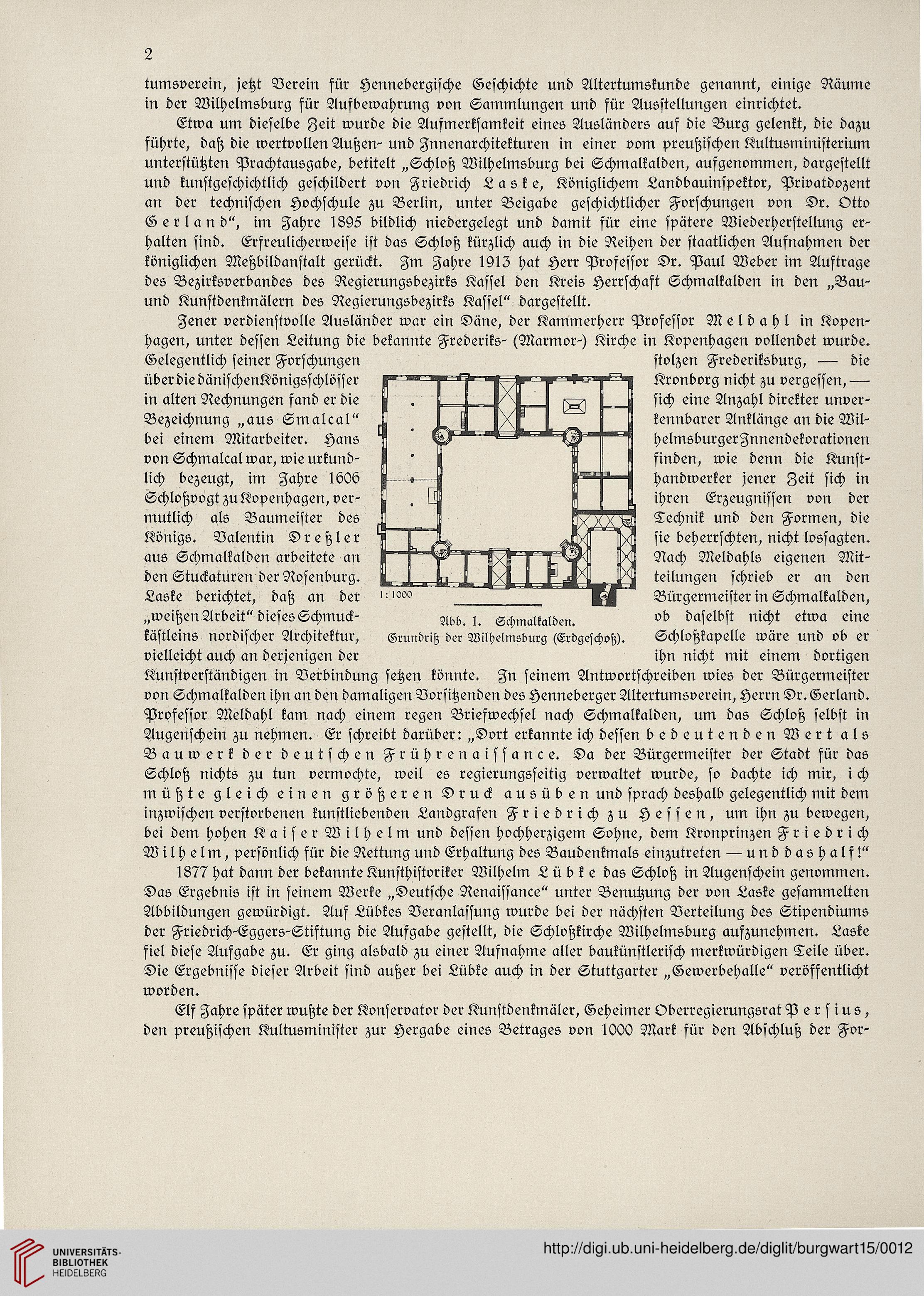2
tumsverein, jetzt Verein sür Hennebergische Geschichte und Altertumskunde genannt, einige Räume
in der Wilhelmsburg sür Ausbewahrung von Sammlungen und sür Ausstellungen einrichtet.
Etwa um dieselbe Zeit wurde die Ausmerksamkeit eines Ausländers aus die Burg gelenkt, die dazu
sührte, datz die wertvollen Autzen- und Annenarchitekturen in einer vom preutzischen Kultusministerium
unterstützten Prachtausgabe, betitelt „Schlotz Wilhelmsburg bei Schmalkalden, aufgenommen, dargestellt
und kunstgeschichtlich geschildert von Zriedrich L a s k e, Königlichem Landbauinspektor, Privatdozent
an der technischen Hochschule zu Berlin, unter Beigabe geschichtlicher Forschungen von Dr. Otto
Gerland", im Aahre 1896 bildlich niedergelegt und damit für eine spätere Wiederherstellung er-
halten sind. Ersreulicherweise ist das Schlotz kürzlich auch in die Reihen der staatlichen Ausnahmen der
königlichen Metzbildanstalt gerückt. Am Aahre 1913 hat Herr Professor Dr. Paul Weber im Austrage
des Bezirksverbandes des Regierungsbezirks Kassel den Kreis Herrschaft Schmalkalden in den „Bau-
und Kunstdenkmälern des Regierungsbezirks Kassel" dargestellt.
Aener verdienstvolle Ausländer war ein Däne, der Kammerherr Prosessor Meldahl in Kopen-
hagen, unter dessen Leitung die bekannte Frederiks- (Marmor-) 5kirche in Kopenhagen vollendet wurde.
Gelegentlich seiner Forschungen
über die dänischenKönigsschlösser
in alten Nechnungen fand er die
Bezeichnung „aus Smalcal"
bei einem Mitarbeiter. Hans
von Schmalcal war, wie urkund-
lich bezeugt, im Iahre 1606
SchlotzvogtzuKopenhagen, ver-
mutlich als Baumeister des
Königs. Valentin Dretzler
aus Schmalkalden arbeitete an
den Stuckaturen der Rosenburg.
Laske berichtet, datz an der
„weitzen Arbeit" dieses Schmuck-
kästleins nordischer Architektur,
vielleicht auch an derjenigen der
n woo
Abb. 1. Schmalkalden.
Grimdrlß der Wilhelmsburg (Erdgeschoß).
stolzen Frederiksburg, — die
Kronborg nicht zu vergessen,—
sich eine Anzahl direkter unver-
kennbarer Anklänge an die Wil-
helmsburgerAnnendekorationen
sinden, wie denn die Kunst-
handwerker jener Zeit sich in
ihren Erzeugnissen von der
Technik und den Formen, die
sie beherrschten, nicht lossagten.
Nach Meldahls eigenen Mit-
teilungen schrieb er an den
Bürgermeister in Schmalkalden,
ob daselbst nicht etwa eine
Schloßkapelle wäre und ob er
ihn nicht mit einem dortigen
Kunstverständigen in Verbindung setzen könnte. In seinem Antwortschreiben wies der Bürgermeister
von Schmalkalden ihn an den damaligen Vorsitzenden des Henneberger Altertumsverein, Herrn Dr. Gerland.
Prosessor Meldahl kam nach einem regen Brieswechsel nach Schmalkalden, um das Schlotz selbst in
Augenschein zu nehmen. Er schreibt darüber: „Dort erkannte ich dessen bedeutenden Wert als
Bauwerk der deutschen F r ü h r e n a i s s a n c e. Da der Bürgermeister der Stadt sür das
Schloß nichts zu tun vermochte, weil es regierungsseitig verwaltet wurde, so dachte ich mir, i ch
mützte gleich einen grötzeren Druck ausüben und sprach deshalb gelegentlich mit dem
inzwischen verstorbenen kunstliebenden Landgrasen Friedrich zu Hessen, um ihn zu bewegen,
bei dem hohen Kaiser Wilhelm und dessen hochherzigem Sohne, dem Kronprinzen Friedrich
Wilhelm, persönlich für die Rettung und Crhaltung des Baudenkmals einzutreten — und dashals!"
1877 hat dann der bekannte Kunsthistoriker Wilhelm Lübke das Schlotz in Augenschein genommen.
Das Crgebnis ist in seinem Werke „Deutsche Renaissance" unter Benuhung der von Laske gesammelten
Abbildungen gewürdigt. Aus Lübkes Veranlassung wurde bei der nächsten Verteilung des Stipendiums
der Friedrich-Eggers-Stiftung die Aufgabe gestellt, die Schlotzkirche Wilhelmsburg aufzunehmen. Laske
siel diese Ausgabe zu. Er ging alsbald zu einer Ausnahme aller baukünstlerisch merkwürdigen Teile über.
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind autzer bei Lübke auch in der Stuttgarter „Gewerbehalle" veröfsentlicht
worden.
Elf Iahre später wutzte der Konservator der Kunstdenkmäler, Geheimer Oberregierungsrat Persius,
den preußischen Kultusminister zur Hergabe eines Betrages von 1000 Mark sür den Abschlutz der For-
tumsverein, jetzt Verein sür Hennebergische Geschichte und Altertumskunde genannt, einige Räume
in der Wilhelmsburg sür Ausbewahrung von Sammlungen und sür Ausstellungen einrichtet.
Etwa um dieselbe Zeit wurde die Ausmerksamkeit eines Ausländers aus die Burg gelenkt, die dazu
sührte, datz die wertvollen Autzen- und Annenarchitekturen in einer vom preutzischen Kultusministerium
unterstützten Prachtausgabe, betitelt „Schlotz Wilhelmsburg bei Schmalkalden, aufgenommen, dargestellt
und kunstgeschichtlich geschildert von Zriedrich L a s k e, Königlichem Landbauinspektor, Privatdozent
an der technischen Hochschule zu Berlin, unter Beigabe geschichtlicher Forschungen von Dr. Otto
Gerland", im Aahre 1896 bildlich niedergelegt und damit für eine spätere Wiederherstellung er-
halten sind. Ersreulicherweise ist das Schlotz kürzlich auch in die Reihen der staatlichen Ausnahmen der
königlichen Metzbildanstalt gerückt. Am Aahre 1913 hat Herr Professor Dr. Paul Weber im Austrage
des Bezirksverbandes des Regierungsbezirks Kassel den Kreis Herrschaft Schmalkalden in den „Bau-
und Kunstdenkmälern des Regierungsbezirks Kassel" dargestellt.
Aener verdienstvolle Ausländer war ein Däne, der Kammerherr Prosessor Meldahl in Kopen-
hagen, unter dessen Leitung die bekannte Frederiks- (Marmor-) 5kirche in Kopenhagen vollendet wurde.
Gelegentlich seiner Forschungen
über die dänischenKönigsschlösser
in alten Nechnungen fand er die
Bezeichnung „aus Smalcal"
bei einem Mitarbeiter. Hans
von Schmalcal war, wie urkund-
lich bezeugt, im Iahre 1606
SchlotzvogtzuKopenhagen, ver-
mutlich als Baumeister des
Königs. Valentin Dretzler
aus Schmalkalden arbeitete an
den Stuckaturen der Rosenburg.
Laske berichtet, datz an der
„weitzen Arbeit" dieses Schmuck-
kästleins nordischer Architektur,
vielleicht auch an derjenigen der
n woo
Abb. 1. Schmalkalden.
Grimdrlß der Wilhelmsburg (Erdgeschoß).
stolzen Frederiksburg, — die
Kronborg nicht zu vergessen,—
sich eine Anzahl direkter unver-
kennbarer Anklänge an die Wil-
helmsburgerAnnendekorationen
sinden, wie denn die Kunst-
handwerker jener Zeit sich in
ihren Erzeugnissen von der
Technik und den Formen, die
sie beherrschten, nicht lossagten.
Nach Meldahls eigenen Mit-
teilungen schrieb er an den
Bürgermeister in Schmalkalden,
ob daselbst nicht etwa eine
Schloßkapelle wäre und ob er
ihn nicht mit einem dortigen
Kunstverständigen in Verbindung setzen könnte. In seinem Antwortschreiben wies der Bürgermeister
von Schmalkalden ihn an den damaligen Vorsitzenden des Henneberger Altertumsverein, Herrn Dr. Gerland.
Prosessor Meldahl kam nach einem regen Brieswechsel nach Schmalkalden, um das Schlotz selbst in
Augenschein zu nehmen. Er schreibt darüber: „Dort erkannte ich dessen bedeutenden Wert als
Bauwerk der deutschen F r ü h r e n a i s s a n c e. Da der Bürgermeister der Stadt sür das
Schloß nichts zu tun vermochte, weil es regierungsseitig verwaltet wurde, so dachte ich mir, i ch
mützte gleich einen grötzeren Druck ausüben und sprach deshalb gelegentlich mit dem
inzwischen verstorbenen kunstliebenden Landgrasen Friedrich zu Hessen, um ihn zu bewegen,
bei dem hohen Kaiser Wilhelm und dessen hochherzigem Sohne, dem Kronprinzen Friedrich
Wilhelm, persönlich für die Rettung und Crhaltung des Baudenkmals einzutreten — und dashals!"
1877 hat dann der bekannte Kunsthistoriker Wilhelm Lübke das Schlotz in Augenschein genommen.
Das Crgebnis ist in seinem Werke „Deutsche Renaissance" unter Benuhung der von Laske gesammelten
Abbildungen gewürdigt. Aus Lübkes Veranlassung wurde bei der nächsten Verteilung des Stipendiums
der Friedrich-Eggers-Stiftung die Aufgabe gestellt, die Schlotzkirche Wilhelmsburg aufzunehmen. Laske
siel diese Ausgabe zu. Er ging alsbald zu einer Ausnahme aller baukünstlerisch merkwürdigen Teile über.
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind autzer bei Lübke auch in der Stuttgarter „Gewerbehalle" veröfsentlicht
worden.
Elf Iahre später wutzte der Konservator der Kunstdenkmäler, Geheimer Oberregierungsrat Persius,
den preußischen Kultusminister zur Hergabe eines Betrages von 1000 Mark sür den Abschlutz der For-