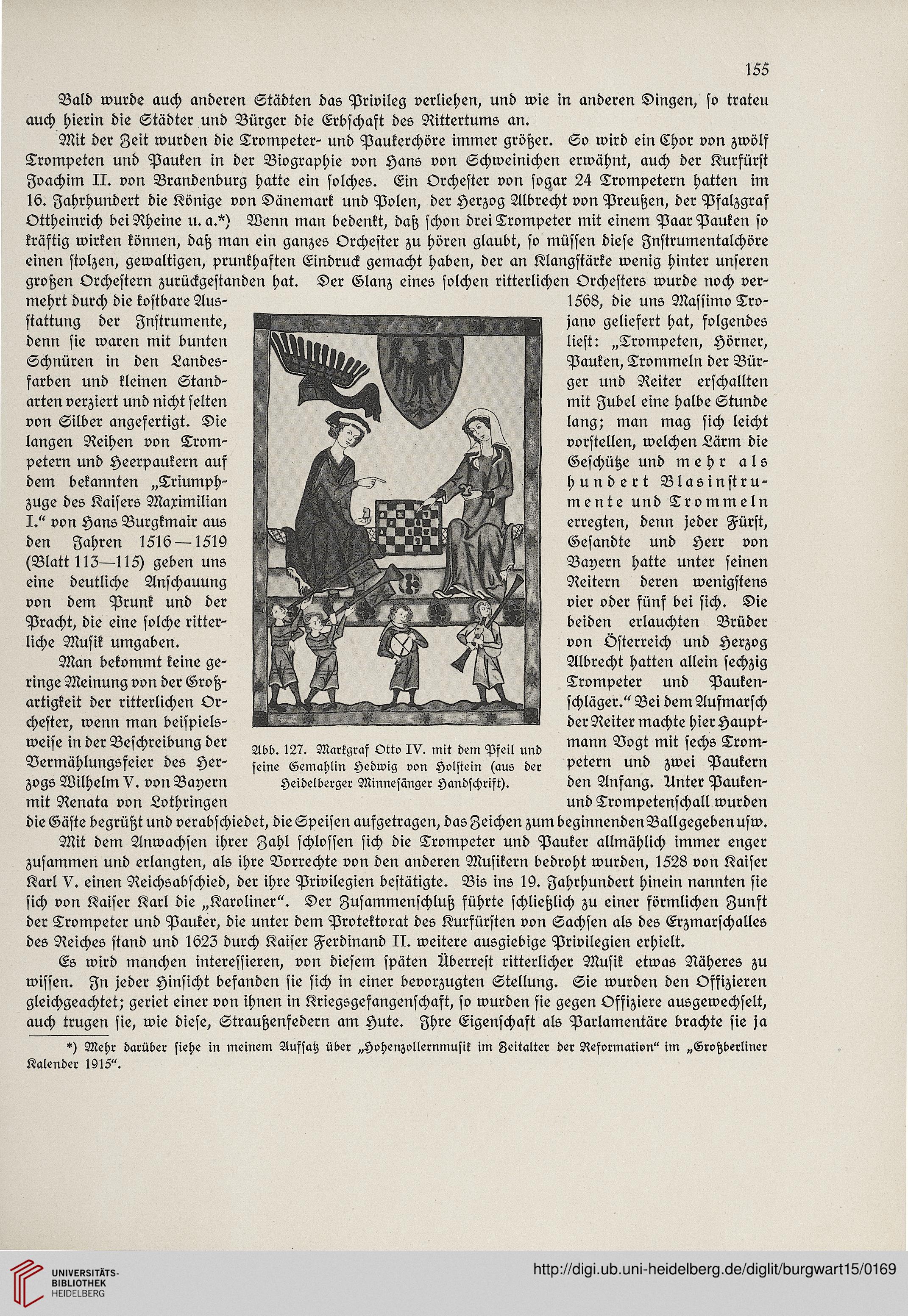155
Bald wurde auch anderen Städten das Privileg verliehen, und wie in anderen Dingen, so trateu
auch hierin die Städter und Bürger die Erbschast des Nittertums an.
Mit der Zeit wurden die Trompeter- und Paukerchöre immer größer. So wird ein Chor von zwöls
Trompeten und Pauken in der Biographie von Hans von Schweinichen erwähnt, auch der Kurfürst
Ioachim II. von Brandenburg hatte ein solches. Ein Orchester von sogar 24 Trompetern hatten im
16. Iahrhundert die Könige von Dänemark und Polen, der Herzog Albrecht von Preußen, der Psalzgras
Ottheinrich bei Rheine u. a.^) Wenn man bedenkt, daß schon drei Trompeter mit einem Paar Pauken so
krästig wirken können, daß man ein ganzes Orchester zu hören glaubt, so müssen diese Instrumentalchöre
einen stolzen, gewaltigen, prunkhasten Eindruck gemacht haben, der an Klangstärke wenig hinter unseren
großen Orchestern zurückgestanden hat. Der Glanz eines solchen ritterlichen Orchesters wurde noch ver-
mehrt durch die kostbare Aus-
stattung der Instrumente,
denn sie waren mit bunten
Schnüren in den Landes-
farben und kleinen Stand-
arten verziert und nicht selten
von Silber angesertigt. Die
langen Reihen von Lrom-
petern und Heerpaukern aus
dem bekannten „Triumph-
zuge des Kaisers Maximilian
I." von Hans Burgkmair aus
den Iahren 1516 —1519
(Blatt llZ—115) geben uns
eine deutliche Anschauung
von dem Prunk und der
Pracht, die eine solche ritter-
liche Musik umgaben.
Man bekommt keine ge-
ringe Meinung von der Groß-
artigkeit der ritterlichen Or-
chester, wenn man beispiels-
weise in der Beschreibung der
Vermählungsseier des Her-
zogs Wilhelm V. von Bayern
mit Nenata von Lothringen
Abb. 127. Markgraf Otto IV. mit dem Pseil und
seine Gemahlin Hedwig von Holstein (aus der
Heidelberger Minnesanger Handschrift).
1568, die uns Massimo Tro-
jano geliesert hat, solgendes
liest: „Trompeten, Hörner,
Pauken, Trommeln der Bür-
ger und Reiter erschallten
mit Iubel eine halbe Stunde
lang; man mag sich leicht
vorstellen, welchen Lärm die
Geschühe und mehr als
hundert Blasinstru-
mente und Trommeln
erregten, denn jeder Fürst,
Gesandte und Herr von
Bayern hatte unter seinen
Neitern deren wenigstens
vier oder süns bei sich. Die
beiden erlauchten Brüder
von Osterreich und Herzog
Albrecht hatten allein sechzig
Trompeter und Pauken-
schläger." Bei dem Ausmarsch
derNeiter machte hierHaupt-
mann Vogt mit sechs Trom-
petern und zwei Paukern
den Ansang. Unter Pauken-
und Trompetenschall wurden
die Gäste begrüßt und verabschiedet, die Speisen ausgetragen, das Zeichen zum beginnendenBallgegebenusw.
Mit dem Anwachsen ihrer Zahl schlossen sich die Trompeter und Pauker allmählich immer enger
zusammen und erlangten, als ihre Vorrechte von den anderen Musikern bedroht wurden, 1528 von Kaiser
Karl V. einen Reichsabschied, der ihre Privilegien bestätigte. Bis ins 19. Iahrhundert hinein nannten sie
sich von Kaiser Karl die „Karoliner". Der Zusammenschluh sührte schließlich zu einer sörmlichen Zunft
der Trompeter und Pauker, die unter dem Protektorat des Kurfürsten von Sachsen als des Erzmarschalles
des Neiches stand und 1623 durch Kaiser Ferdinand II. weitere ausgiebige Privilegien erhielt.
Es wird manchen interessieren, von diesem späten Äberrest ritterlicher Musik etwas Näheres zu
wissen. In jeder Hinsicht befanden sie sich in einer bevorzugten Stellung. Sie wurden den Ossizieren
gleichgeachtet; geriet einer von ihnen in Kriegsgefangenschast, so wurden sie gegen Ossiziere ausgewechselt,
auch trugen sie, wie diese, Straußensedern am Hute. Ihre Eigenschast als Parlamentäre brachte sie ja
*) Mehr darüber siehe in meinem Aussah über „Hohenzollernmusik im Zeitalter der Neformation" im „Grohberliner
Kalender 1915".
Bald wurde auch anderen Städten das Privileg verliehen, und wie in anderen Dingen, so trateu
auch hierin die Städter und Bürger die Erbschast des Nittertums an.
Mit der Zeit wurden die Trompeter- und Paukerchöre immer größer. So wird ein Chor von zwöls
Trompeten und Pauken in der Biographie von Hans von Schweinichen erwähnt, auch der Kurfürst
Ioachim II. von Brandenburg hatte ein solches. Ein Orchester von sogar 24 Trompetern hatten im
16. Iahrhundert die Könige von Dänemark und Polen, der Herzog Albrecht von Preußen, der Psalzgras
Ottheinrich bei Rheine u. a.^) Wenn man bedenkt, daß schon drei Trompeter mit einem Paar Pauken so
krästig wirken können, daß man ein ganzes Orchester zu hören glaubt, so müssen diese Instrumentalchöre
einen stolzen, gewaltigen, prunkhasten Eindruck gemacht haben, der an Klangstärke wenig hinter unseren
großen Orchestern zurückgestanden hat. Der Glanz eines solchen ritterlichen Orchesters wurde noch ver-
mehrt durch die kostbare Aus-
stattung der Instrumente,
denn sie waren mit bunten
Schnüren in den Landes-
farben und kleinen Stand-
arten verziert und nicht selten
von Silber angesertigt. Die
langen Reihen von Lrom-
petern und Heerpaukern aus
dem bekannten „Triumph-
zuge des Kaisers Maximilian
I." von Hans Burgkmair aus
den Iahren 1516 —1519
(Blatt llZ—115) geben uns
eine deutliche Anschauung
von dem Prunk und der
Pracht, die eine solche ritter-
liche Musik umgaben.
Man bekommt keine ge-
ringe Meinung von der Groß-
artigkeit der ritterlichen Or-
chester, wenn man beispiels-
weise in der Beschreibung der
Vermählungsseier des Her-
zogs Wilhelm V. von Bayern
mit Nenata von Lothringen
Abb. 127. Markgraf Otto IV. mit dem Pseil und
seine Gemahlin Hedwig von Holstein (aus der
Heidelberger Minnesanger Handschrift).
1568, die uns Massimo Tro-
jano geliesert hat, solgendes
liest: „Trompeten, Hörner,
Pauken, Trommeln der Bür-
ger und Reiter erschallten
mit Iubel eine halbe Stunde
lang; man mag sich leicht
vorstellen, welchen Lärm die
Geschühe und mehr als
hundert Blasinstru-
mente und Trommeln
erregten, denn jeder Fürst,
Gesandte und Herr von
Bayern hatte unter seinen
Neitern deren wenigstens
vier oder süns bei sich. Die
beiden erlauchten Brüder
von Osterreich und Herzog
Albrecht hatten allein sechzig
Trompeter und Pauken-
schläger." Bei dem Ausmarsch
derNeiter machte hierHaupt-
mann Vogt mit sechs Trom-
petern und zwei Paukern
den Ansang. Unter Pauken-
und Trompetenschall wurden
die Gäste begrüßt und verabschiedet, die Speisen ausgetragen, das Zeichen zum beginnendenBallgegebenusw.
Mit dem Anwachsen ihrer Zahl schlossen sich die Trompeter und Pauker allmählich immer enger
zusammen und erlangten, als ihre Vorrechte von den anderen Musikern bedroht wurden, 1528 von Kaiser
Karl V. einen Reichsabschied, der ihre Privilegien bestätigte. Bis ins 19. Iahrhundert hinein nannten sie
sich von Kaiser Karl die „Karoliner". Der Zusammenschluh sührte schließlich zu einer sörmlichen Zunft
der Trompeter und Pauker, die unter dem Protektorat des Kurfürsten von Sachsen als des Erzmarschalles
des Neiches stand und 1623 durch Kaiser Ferdinand II. weitere ausgiebige Privilegien erhielt.
Es wird manchen interessieren, von diesem späten Äberrest ritterlicher Musik etwas Näheres zu
wissen. In jeder Hinsicht befanden sie sich in einer bevorzugten Stellung. Sie wurden den Ossizieren
gleichgeachtet; geriet einer von ihnen in Kriegsgefangenschast, so wurden sie gegen Ossiziere ausgewechselt,
auch trugen sie, wie diese, Straußensedern am Hute. Ihre Eigenschast als Parlamentäre brachte sie ja
*) Mehr darüber siehe in meinem Aussah über „Hohenzollernmusik im Zeitalter der Neformation" im „Grohberliner
Kalender 1915".