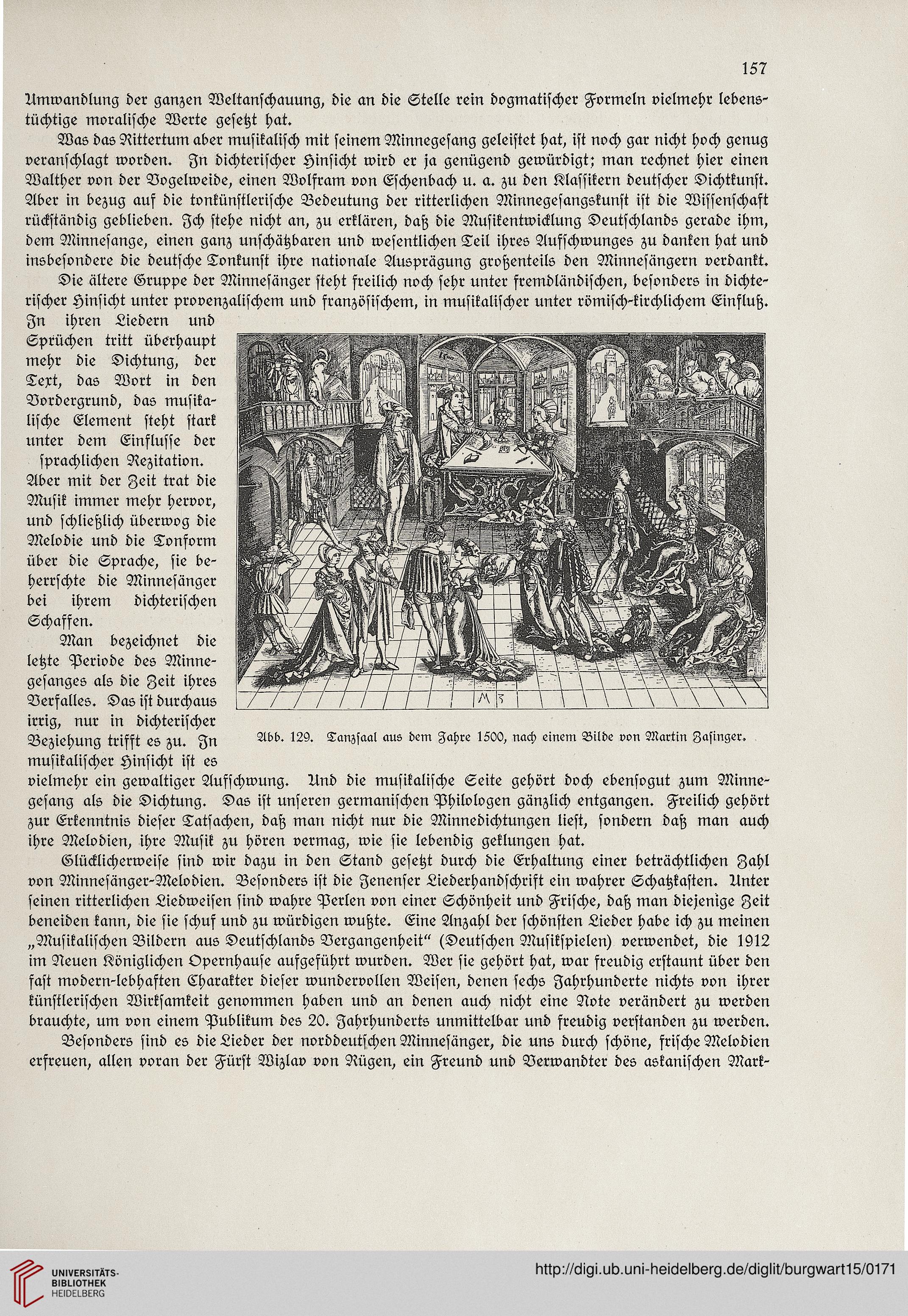157
Amwandlung der ganzen Weltanschauung, die an die Stelle rein dogmatischer Formeln vielmehr lebens-
tüchtige moralische Werte gesetzt hat.
Was das Nittertum aber musikalisch mit seinem Minnegesang geleistet hat, ist noch gar nicht hoch genug
veranschlagt worden. In dichterischer Hinsicht wird er ja genügend gewürdigt: man rechnet hier einen
Walther von der Vogelweide, einen Wolfram von Eschenbach u. a. zu den Klassikern deutscher Dichtkunst.
Aber in bezug aus die tonkünstlerische Bedeutung der ritterlichen Minnegesangskunst ist die Wissenschast
rückständig geblieben. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß die Musikentwick'lung Deutschlands gerade ihm,
dem Minnesange, einen ganz unschätzbaren und wesentlichen Teil ihres Aufschwunges zu danken hat und
insbesondere die deutsche Tonkunst ihre nationale Ausprägung grotzenteils den Minnesängern verdankt.
Die ältere Gruppe der Minnesänger steht freilich noch sehr unter fremdländischen, besonders in dichte-
rischer Hinsicht unter provenzalischem und französischem, in musikalischer unter römisch-kirchlichem Einsluß.
In ihren Liedern und
Sprüchen tritt überhaupt
mehr die Dichtung, der
Text, das Wort in den
Vordergrund, das musika-
lische Element steht stark
unter dem Einflusse der
sprachlichen Rezitation.
Aber mit der Zeit trat die
Musik immer mehr hervor,
und schließlich überwog die
Melodie und die Tonform
über die Sprache, sie be-
herrschte die Minnesänger
bei ihrem dichterischen
Schafsen.
Man bezeichnet die
letzte Periode des Minne-
gesanges als die Zeit ihres
Versalles. Das ist durchaus
irrig, nur in dichterischer
Beziehung trisft es zu. In
musikalischer Hinsicht ist es
vielmehr ein gewaltiger Aufschwung. And die musikalische Seite gehört doch ebensogut zum Minne-
gesang als die Dichtung. Das ist unseren germanischen Philologen gänzlich entgangen. Freilich gehört
zur Erkenntnis dieser Tatsachen, daß man nicht nur die Minnedichtungen liest, sondern daß man auch
ihre Melodien, ihre Musik zu hören vermag, wie sie lebendig geklungen hat.
Glücklicherweise sind wir dazu in den Stand gesetzt durch die Erhaltung einer beträchtlichen Zahl
von Minnesänger-Melodien. Besonders ist die Ienenser Liederhandschrist ein wahrer Schatzkasten. Unter
seinen ritterlichen Liedweisen sind wahre Perlen von einer Schönheit und Frische, daß man diejenige Zeit
beneiden kann, die sie schus und zu würdigen wußte. Eine Anzahl der schönsten Lieder habe ich zu meinen
„Musikalischen Bildern aus Deutschlands Vergangenheit" (Deutschen Musikspielen) verwendet, die 1912
im Neuen Königlichen Opernhause ausgeführt wurden. Wer sie gehört hat, war freudig erstaunt über den
fast modern-lebhaften Charakter dieser wundervollen Weisen, denen sechs Iahrhunderte nichts von ihrer
künstlerischen Wirksamkeit genommen haben und an denen auch nicht eine Note verändert zu werden
brauchte, um von einem Publikum des 2O. Iahrhunderts unmittelbar und freudig verstanden zu werden.
Besonders sind es die Lieder der norddeutschen Minnesänger, die uns durch schöne, frische Melodien
erfreuen, allen voran der Fürst Wizlav von Rügen, ein Freund und Verwandter des askanischen Mark-
Amwandlung der ganzen Weltanschauung, die an die Stelle rein dogmatischer Formeln vielmehr lebens-
tüchtige moralische Werte gesetzt hat.
Was das Nittertum aber musikalisch mit seinem Minnegesang geleistet hat, ist noch gar nicht hoch genug
veranschlagt worden. In dichterischer Hinsicht wird er ja genügend gewürdigt: man rechnet hier einen
Walther von der Vogelweide, einen Wolfram von Eschenbach u. a. zu den Klassikern deutscher Dichtkunst.
Aber in bezug aus die tonkünstlerische Bedeutung der ritterlichen Minnegesangskunst ist die Wissenschast
rückständig geblieben. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß die Musikentwick'lung Deutschlands gerade ihm,
dem Minnesange, einen ganz unschätzbaren und wesentlichen Teil ihres Aufschwunges zu danken hat und
insbesondere die deutsche Tonkunst ihre nationale Ausprägung grotzenteils den Minnesängern verdankt.
Die ältere Gruppe der Minnesänger steht freilich noch sehr unter fremdländischen, besonders in dichte-
rischer Hinsicht unter provenzalischem und französischem, in musikalischer unter römisch-kirchlichem Einsluß.
In ihren Liedern und
Sprüchen tritt überhaupt
mehr die Dichtung, der
Text, das Wort in den
Vordergrund, das musika-
lische Element steht stark
unter dem Einflusse der
sprachlichen Rezitation.
Aber mit der Zeit trat die
Musik immer mehr hervor,
und schließlich überwog die
Melodie und die Tonform
über die Sprache, sie be-
herrschte die Minnesänger
bei ihrem dichterischen
Schafsen.
Man bezeichnet die
letzte Periode des Minne-
gesanges als die Zeit ihres
Versalles. Das ist durchaus
irrig, nur in dichterischer
Beziehung trisft es zu. In
musikalischer Hinsicht ist es
vielmehr ein gewaltiger Aufschwung. And die musikalische Seite gehört doch ebensogut zum Minne-
gesang als die Dichtung. Das ist unseren germanischen Philologen gänzlich entgangen. Freilich gehört
zur Erkenntnis dieser Tatsachen, daß man nicht nur die Minnedichtungen liest, sondern daß man auch
ihre Melodien, ihre Musik zu hören vermag, wie sie lebendig geklungen hat.
Glücklicherweise sind wir dazu in den Stand gesetzt durch die Erhaltung einer beträchtlichen Zahl
von Minnesänger-Melodien. Besonders ist die Ienenser Liederhandschrist ein wahrer Schatzkasten. Unter
seinen ritterlichen Liedweisen sind wahre Perlen von einer Schönheit und Frische, daß man diejenige Zeit
beneiden kann, die sie schus und zu würdigen wußte. Eine Anzahl der schönsten Lieder habe ich zu meinen
„Musikalischen Bildern aus Deutschlands Vergangenheit" (Deutschen Musikspielen) verwendet, die 1912
im Neuen Königlichen Opernhause ausgeführt wurden. Wer sie gehört hat, war freudig erstaunt über den
fast modern-lebhaften Charakter dieser wundervollen Weisen, denen sechs Iahrhunderte nichts von ihrer
künstlerischen Wirksamkeit genommen haben und an denen auch nicht eine Note verändert zu werden
brauchte, um von einem Publikum des 2O. Iahrhunderts unmittelbar und freudig verstanden zu werden.
Besonders sind es die Lieder der norddeutschen Minnesänger, die uns durch schöne, frische Melodien
erfreuen, allen voran der Fürst Wizlav von Rügen, ein Freund und Verwandter des askanischen Mark-