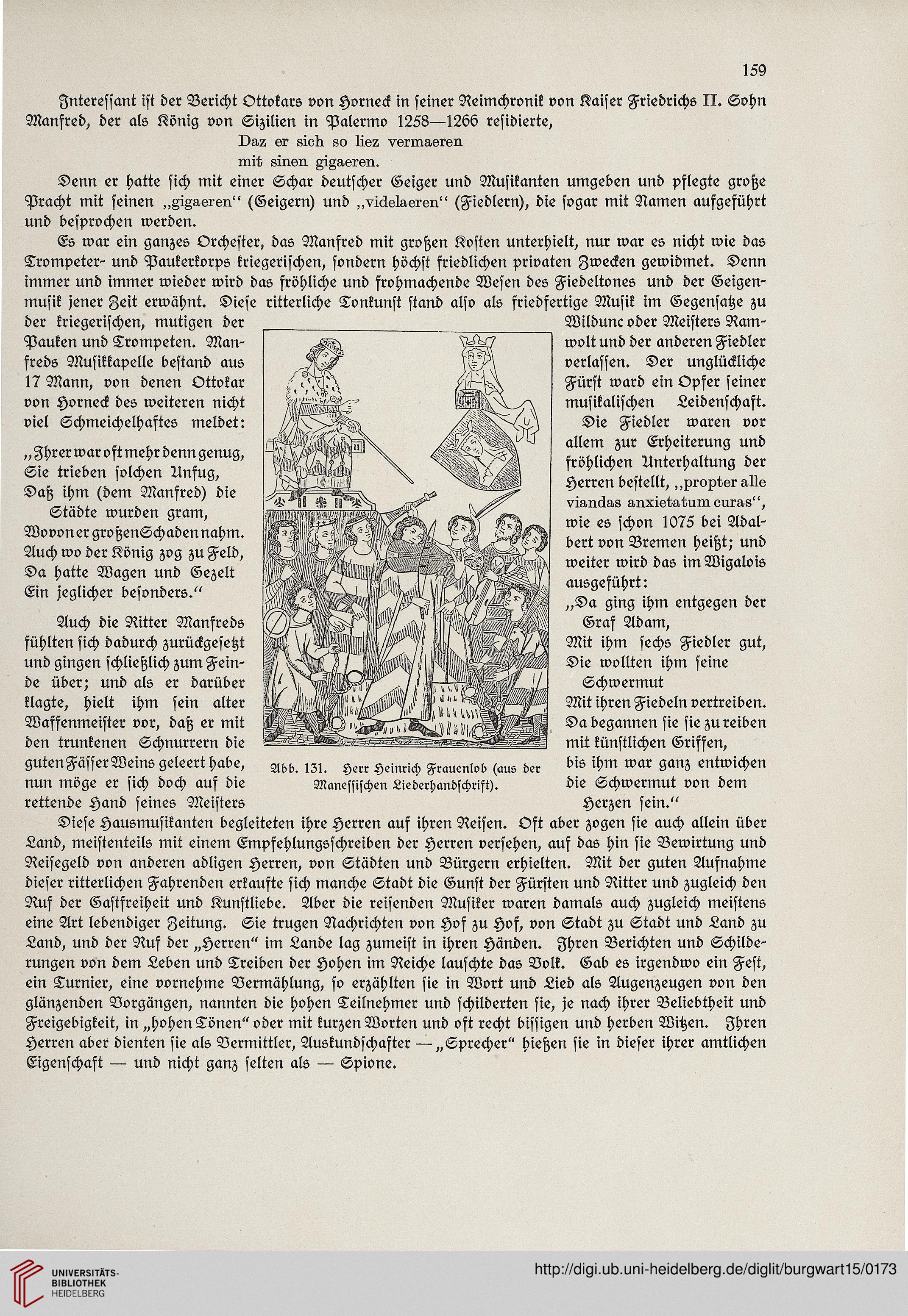159
Interessant ist der Bericht Ottokars von Horneck in seiner Reimchronik von Kaiser Friedrichs II. Sohn
Mansred, der als König von Sizilien in Palermo 1258—1266 residierte,
er sioli so 1i62 vormaoron.
mil 8M6N AiZasron.
Denn er hatte sich mit einer Schar deutscher Geiger und Musikanten umgeben und pslegte grohe
Pracht mit seinen „ZiZaeren" (Geigern) und „viäelaersn" (Fiedlern), die sogar mit Namen aufgesührt
und besprochen werden.
Es war ein ganzes Orchester, das Manfred mit grotzen Kosten unterhielt, nur war es nicht wie das
Trompeter- und Paukerkorps kriegerischen, sondern höchst sriedlichen privaten Zwecken gewidmet. Denn
inimer und immer wieder wird das sröhliche und frohmachende Wesen des Fiedeltones und der Geigen-
musik jener Zeit erwähnt. Diese ritterliche Tonkunst stand also als sriedfertige Musik im Gegensahe zu
der kriegerischen, mutigen der
Pauken und Trompeten. Man-
freds Musikkapelle bestand aus
17 Mann, von denen Ottokar
von Horneck des weiteren nicht
viel Schmeichelhaftes meldet:
„ Ahrer war oft mehr denn genug,
Sie trieben solchen Unsug,
Daß ihm (dem Manfred) die
Städte wurden gram,
Wovoner großenSchadennahm.
Auch wo der König zog zu Feld,
Da hatte Wagen und Gezelt
Ein jeglicher besonders."
Auch die Ritter Manfreds
fühlten sich dadurch zurückgesetzt
und gingen schließlich zum Fein-
de über; und als er darüber
klagte, hielt ihm sein alter
Waffenmeister vor, daß er mit
den trunkenen Schnurrern die
gutenFässerWeins geleert habe,
nun möge er sich doch auf die
rettende Hand seines Meisters
Diese Hausmusikanten begleiteten ihre Herren auf ihren Neisen. Oft aber zogen sie auch allein über
Land, meistenteils mit einem Empsehlungsschreiben der Herren versehen, aus das hin sie Bewirtung und
Neisegeld von anderen adligen Herren, von Städten und Bürgern erhielten. Mit der guten Ausnahme
dieser ritterlichen Fahrenden erkauste sich manche Stadt die Gunst der Fürsten und Ritter und zugleich den
Ruf der Gastsreiheit und Kunstliebe. Aber die reisenden Musiker waren damals auch zugleich meistens
eine Art lebendiger Zeitung. Sie trugen Nachrichten von Hos zu Hof, von Stadt zu Stadt und Land zu
Land, und der Rus der „Herren" im Lande lag zumeist in ihren Händen. Ihren Berichten und Schilde-
rungen von dem Leben und Treiben der Hohen im Reiche lauschte das Volk. Gab es irgendwo ein Fest,
ein Turnier, eine vornehme Vermählung, so erzählten sie in Wort und Lied als Augenzeugen von den
glänzenden Vorgängen, nannten die hohen Teilnehmer und schilderten sie, je nach ihrer Beliebtheit und
Freigebigkeit, in „hohen Tönen" oder mit kurzen Worten und ost recht bissigen und herben Witzen. Ihren
Herren aber dienten sie als Vermittler, Auskundschaster — „Sprecher" hießen sie in dieser ihrer amtlichen
Eigenschast — und nicht ganz selten als — Spione.
Abb. 131. Herr Heinrich Frauenlob (aus der
Manessischen Liederhandschrist).
Wildunc oder Meisters Nam-
wolt und der anderen Fiedler
verlassen. Der unglückliche
Fürst ward ein Opfer seiner
musikalischen Leidenschast.
Die Fiedler waren vor
allem zur Erheiterung und
sröhlichen Unterhaltung der
Herren bestellt, „propter alle
vianäas anxielalurn eura^",
wie es schon 1075 bei Adal-
bert von Bremen heißt; und
weiter wird das im Wigalois
ausgesührt:
„Da ging ihm entgegen der
Gras Adam,
Mit ihm sechs Fiedler gut,
Die wollten ihm seine
Schwermut
Mit ihren Fiedeln vertreiben.
Da begannen sie sie zu reiben
mit künstlichen Grisfen,
bis ihm war ganz entwichen
die Schwermut von dem
Herzen sein."
Interessant ist der Bericht Ottokars von Horneck in seiner Reimchronik von Kaiser Friedrichs II. Sohn
Mansred, der als König von Sizilien in Palermo 1258—1266 residierte,
er sioli so 1i62 vormaoron.
mil 8M6N AiZasron.
Denn er hatte sich mit einer Schar deutscher Geiger und Musikanten umgeben und pslegte grohe
Pracht mit seinen „ZiZaeren" (Geigern) und „viäelaersn" (Fiedlern), die sogar mit Namen aufgesührt
und besprochen werden.
Es war ein ganzes Orchester, das Manfred mit grotzen Kosten unterhielt, nur war es nicht wie das
Trompeter- und Paukerkorps kriegerischen, sondern höchst sriedlichen privaten Zwecken gewidmet. Denn
inimer und immer wieder wird das sröhliche und frohmachende Wesen des Fiedeltones und der Geigen-
musik jener Zeit erwähnt. Diese ritterliche Tonkunst stand also als sriedfertige Musik im Gegensahe zu
der kriegerischen, mutigen der
Pauken und Trompeten. Man-
freds Musikkapelle bestand aus
17 Mann, von denen Ottokar
von Horneck des weiteren nicht
viel Schmeichelhaftes meldet:
„ Ahrer war oft mehr denn genug,
Sie trieben solchen Unsug,
Daß ihm (dem Manfred) die
Städte wurden gram,
Wovoner großenSchadennahm.
Auch wo der König zog zu Feld,
Da hatte Wagen und Gezelt
Ein jeglicher besonders."
Auch die Ritter Manfreds
fühlten sich dadurch zurückgesetzt
und gingen schließlich zum Fein-
de über; und als er darüber
klagte, hielt ihm sein alter
Waffenmeister vor, daß er mit
den trunkenen Schnurrern die
gutenFässerWeins geleert habe,
nun möge er sich doch auf die
rettende Hand seines Meisters
Diese Hausmusikanten begleiteten ihre Herren auf ihren Neisen. Oft aber zogen sie auch allein über
Land, meistenteils mit einem Empsehlungsschreiben der Herren versehen, aus das hin sie Bewirtung und
Neisegeld von anderen adligen Herren, von Städten und Bürgern erhielten. Mit der guten Ausnahme
dieser ritterlichen Fahrenden erkauste sich manche Stadt die Gunst der Fürsten und Ritter und zugleich den
Ruf der Gastsreiheit und Kunstliebe. Aber die reisenden Musiker waren damals auch zugleich meistens
eine Art lebendiger Zeitung. Sie trugen Nachrichten von Hos zu Hof, von Stadt zu Stadt und Land zu
Land, und der Rus der „Herren" im Lande lag zumeist in ihren Händen. Ihren Berichten und Schilde-
rungen von dem Leben und Treiben der Hohen im Reiche lauschte das Volk. Gab es irgendwo ein Fest,
ein Turnier, eine vornehme Vermählung, so erzählten sie in Wort und Lied als Augenzeugen von den
glänzenden Vorgängen, nannten die hohen Teilnehmer und schilderten sie, je nach ihrer Beliebtheit und
Freigebigkeit, in „hohen Tönen" oder mit kurzen Worten und ost recht bissigen und herben Witzen. Ihren
Herren aber dienten sie als Vermittler, Auskundschaster — „Sprecher" hießen sie in dieser ihrer amtlichen
Eigenschast — und nicht ganz selten als — Spione.
Abb. 131. Herr Heinrich Frauenlob (aus der
Manessischen Liederhandschrist).
Wildunc oder Meisters Nam-
wolt und der anderen Fiedler
verlassen. Der unglückliche
Fürst ward ein Opfer seiner
musikalischen Leidenschast.
Die Fiedler waren vor
allem zur Erheiterung und
sröhlichen Unterhaltung der
Herren bestellt, „propter alle
vianäas anxielalurn eura^",
wie es schon 1075 bei Adal-
bert von Bremen heißt; und
weiter wird das im Wigalois
ausgesührt:
„Da ging ihm entgegen der
Gras Adam,
Mit ihm sechs Fiedler gut,
Die wollten ihm seine
Schwermut
Mit ihren Fiedeln vertreiben.
Da begannen sie sie zu reiben
mit künstlichen Grisfen,
bis ihm war ganz entwichen
die Schwermut von dem
Herzen sein."