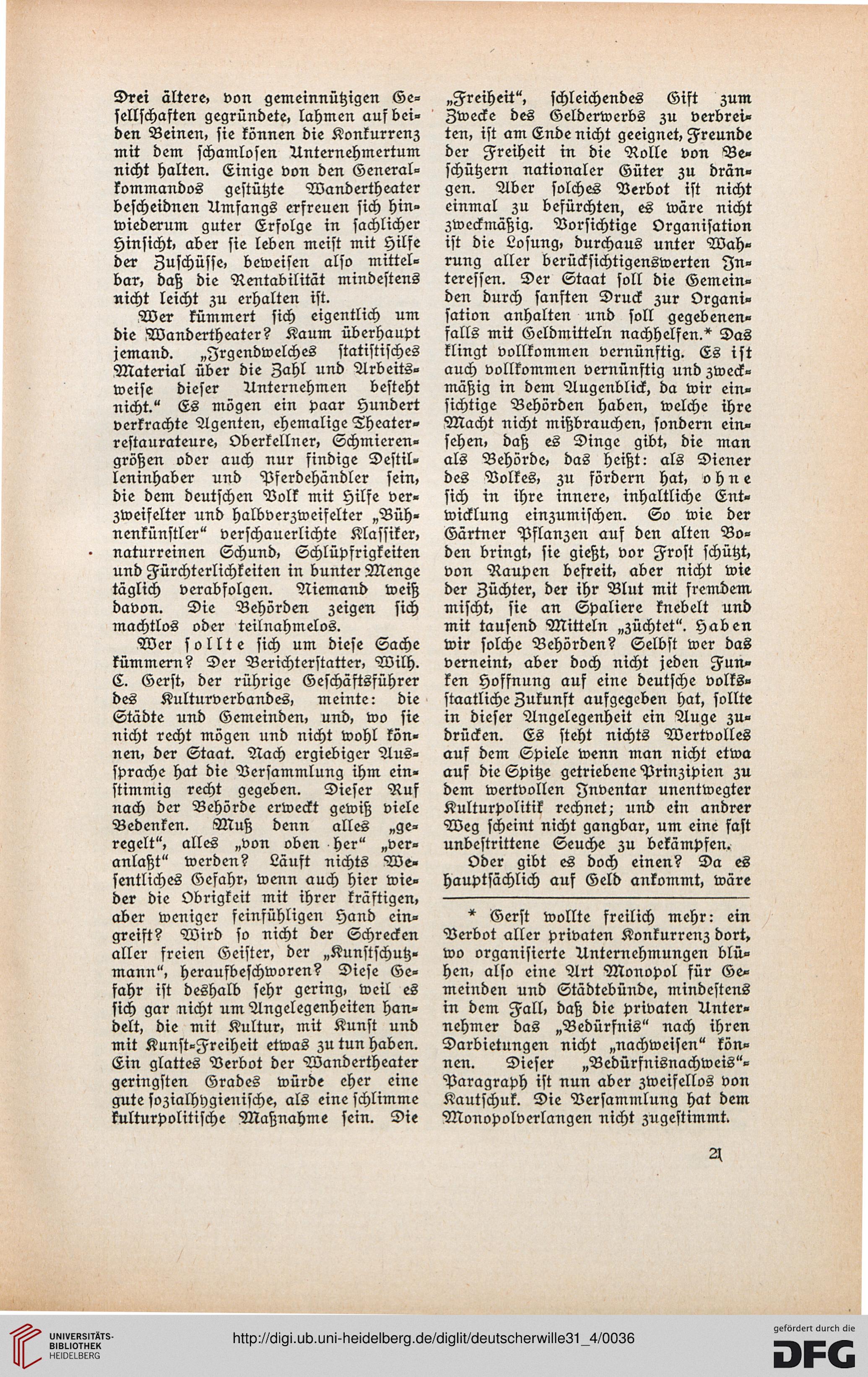Drei ältere, von gemeinnützigen Ge-
sellschaften gegründete, lahmen anf bei-
den Beinen, sie können die Konkurrenz
mit dem schamlosen Itnternehmertum
nicht halten. Einige von den General-
kommandos gestützte Wandertheater
bescheidnen Umfangs erfreuen sich hin--
wiederum guter Erfolge in sachlicher
Hinsicht, aber sie leben meist mit Hilfe
der Zuschüsse, beweisen also mittel-
bar, daß die Rentabilität mindestens
nicht leicht zn erhalten ist.
Wer kümmert sich eigentlich um
die Wandertheater? Kaum überhaupt
jemand. „Frgendwelches statistisches
Material über die Zahl und Arbeits-
weise dieser Unternehmsn besteht
nicht." Es mögen ein paar Hundert
verkrachte Agenten, ehemalige Theater-
restaurateure, Oberkellner, Schmieren-
größen oder auch nur findige Destil«
leninhaber und Pferdehändler sein,
die dem deutschen Volk mit Hilfe ver-
zweifelter und halbverzweifelter „Büh-
nenkünstler" verschauerlichte Klassiker,
naturreinen Schund, Schlüpfrigkeiten
und Fürchterlichkeiten in bunter Menge
täglich verabfolgen. Niemand weiß
davon. Die Behörden zeigen sich
machtlos oder teilnahmelos.
Wer sollte sich um diese Sache
kümmern? Der Berichterstatter, Wilh.
C. Gerst, der rührige Geschäftsführer
des Kulturverbandes, meinte: die
Städte und Gemeinden, und, wo sie
nicht recht mögen und nicht wohl kön-
nen, der Staat. Nach ergiebiger Aus-
sprache hat die Versammlung ihm ein-
stimmig recht gegeben. Dieser Ruf
nach der Behörde erweckt gewiß viele
Bedenken. Muß denn alles „ge-
regelt", alles „von oben her" „ver-
anlaßt" werden? Läuft nichts We-
sentliches Gefahr, wenn auch hier wie»
der die Obrigkeit mit ihrer kräftigen,
aber weniger feinfühligen Hand ein-
greist? Wird so nicht der Schrecken
aller freien Geister, der „Kunstschutz-
mann", heraufbeschworen? Diese Ge-
fahr ist deshalb sehr gering, weil es
sich gar nicht um Angelegenheiten han-
delt, die mit Kultur, mit Kunst und
mit Kunst-Freiheit etwas zu tun haben.
Ein glattes Verbot der Wandertheater
geringsten Grades würde eher eine
gute sozialhhgienische, als eine schlimme
kulturpolitische Maßnahme sein. Die
„Freihest", schleichendes Gift zum
Zwecke des Gelderwerbs zu verbrei-
ten, ist am Ende nicht geeignet, Freunde
der Freihest in die Rolle von Be»
schützern nationaler Güter zu drän-
gen. Aber solches Verbot ist nicht
einmal zu befürchten, es wäre nicht
zweckmäßig. Vorsichtige Organisation
ist die Losung, durchaus unter Wah»
rung aller berücksichtigenswerten In°
teressen. Der Staat soll die Gemein-
den durch sansten Druck zur Organi-
sation anhalten und soll gegebenen-
falls mst Geldmstteln nachhelfen.* Das
klingt vollkommen vernünftig. Es ist
auch vollkommen vernünftig und zweck-
mäßig in dem Augenblick, da wir ein-
sichtige Behörden haben, welche ihre
Macht nicht mißbrauchen, sondern ein-
sehen, daß es Dinge gibt, die man
als Behörde, das heißt: als Diener
des Volkes, zu fördern hat, ohne
sich in ihre innere, inhaltliche Ent»
wicklung einzumischen. So wie der
Gärtner Pslanzen auf den alten Bo-
den bringt, sie gießt, vor Frost schützt,
von Raupen befreit, aber nicht wie
der Züchter, der ihr Blut mit sremdem
mischt, sie an Spaliere knebelt und
mit tausend Mitteln „züchtet". Haben
wir solche Behörden? Selbst wer das
verneint, aber doch nicht jeden Fun»
ken Hoffnung auf eine deutsche volks-
staatliche Zukunft aufgegeben hat, sollte
in dieser Angelegenheit ein Auge zu-
drücken. Es steht nichts Wertvolles
auf dem Spiele wenn man nicht etwa
auf die Spitze getriebene Prinzipien zu
dem wertvollen Inventar unentwegter
Kulturpolitik rechnet; und ein andrer
Weg scheint nicht gangbar, um eine fast
unbestrittene Seuche zu bekämpfen.
Oder gibt es doch einen? Da es
hauptsächlich auf Geld ankommt, wäre
* Gerst wollte freilich mehr: ein
Verbot aller privaten Konkurrenz dort,
wo organisierte Unternehmungen blü-
hen, also eine Art Monopol für Ge»
meinden und Städtebünde, mindestens
in dem Fall, daß die privaten Unter-
nehmer das „Bedürfnis" nach ihren
Darbietungen nicht „nachweisen" kön-
nen. Dieser „Bedürfnisnachweis"-
Paragraph ist nun aber zweifellos von
Kautschuk. Die Versammlung hat dem
Monopolverlangen nicht zugestimmt.
2l
sellschaften gegründete, lahmen anf bei-
den Beinen, sie können die Konkurrenz
mit dem schamlosen Itnternehmertum
nicht halten. Einige von den General-
kommandos gestützte Wandertheater
bescheidnen Umfangs erfreuen sich hin--
wiederum guter Erfolge in sachlicher
Hinsicht, aber sie leben meist mit Hilfe
der Zuschüsse, beweisen also mittel-
bar, daß die Rentabilität mindestens
nicht leicht zn erhalten ist.
Wer kümmert sich eigentlich um
die Wandertheater? Kaum überhaupt
jemand. „Frgendwelches statistisches
Material über die Zahl und Arbeits-
weise dieser Unternehmsn besteht
nicht." Es mögen ein paar Hundert
verkrachte Agenten, ehemalige Theater-
restaurateure, Oberkellner, Schmieren-
größen oder auch nur findige Destil«
leninhaber und Pferdehändler sein,
die dem deutschen Volk mit Hilfe ver-
zweifelter und halbverzweifelter „Büh-
nenkünstler" verschauerlichte Klassiker,
naturreinen Schund, Schlüpfrigkeiten
und Fürchterlichkeiten in bunter Menge
täglich verabfolgen. Niemand weiß
davon. Die Behörden zeigen sich
machtlos oder teilnahmelos.
Wer sollte sich um diese Sache
kümmern? Der Berichterstatter, Wilh.
C. Gerst, der rührige Geschäftsführer
des Kulturverbandes, meinte: die
Städte und Gemeinden, und, wo sie
nicht recht mögen und nicht wohl kön-
nen, der Staat. Nach ergiebiger Aus-
sprache hat die Versammlung ihm ein-
stimmig recht gegeben. Dieser Ruf
nach der Behörde erweckt gewiß viele
Bedenken. Muß denn alles „ge-
regelt", alles „von oben her" „ver-
anlaßt" werden? Läuft nichts We-
sentliches Gefahr, wenn auch hier wie»
der die Obrigkeit mit ihrer kräftigen,
aber weniger feinfühligen Hand ein-
greist? Wird so nicht der Schrecken
aller freien Geister, der „Kunstschutz-
mann", heraufbeschworen? Diese Ge-
fahr ist deshalb sehr gering, weil es
sich gar nicht um Angelegenheiten han-
delt, die mit Kultur, mit Kunst und
mit Kunst-Freiheit etwas zu tun haben.
Ein glattes Verbot der Wandertheater
geringsten Grades würde eher eine
gute sozialhhgienische, als eine schlimme
kulturpolitische Maßnahme sein. Die
„Freihest", schleichendes Gift zum
Zwecke des Gelderwerbs zu verbrei-
ten, ist am Ende nicht geeignet, Freunde
der Freihest in die Rolle von Be»
schützern nationaler Güter zu drän-
gen. Aber solches Verbot ist nicht
einmal zu befürchten, es wäre nicht
zweckmäßig. Vorsichtige Organisation
ist die Losung, durchaus unter Wah»
rung aller berücksichtigenswerten In°
teressen. Der Staat soll die Gemein-
den durch sansten Druck zur Organi-
sation anhalten und soll gegebenen-
falls mst Geldmstteln nachhelfen.* Das
klingt vollkommen vernünftig. Es ist
auch vollkommen vernünftig und zweck-
mäßig in dem Augenblick, da wir ein-
sichtige Behörden haben, welche ihre
Macht nicht mißbrauchen, sondern ein-
sehen, daß es Dinge gibt, die man
als Behörde, das heißt: als Diener
des Volkes, zu fördern hat, ohne
sich in ihre innere, inhaltliche Ent»
wicklung einzumischen. So wie der
Gärtner Pslanzen auf den alten Bo-
den bringt, sie gießt, vor Frost schützt,
von Raupen befreit, aber nicht wie
der Züchter, der ihr Blut mit sremdem
mischt, sie an Spaliere knebelt und
mit tausend Mitteln „züchtet". Haben
wir solche Behörden? Selbst wer das
verneint, aber doch nicht jeden Fun»
ken Hoffnung auf eine deutsche volks-
staatliche Zukunft aufgegeben hat, sollte
in dieser Angelegenheit ein Auge zu-
drücken. Es steht nichts Wertvolles
auf dem Spiele wenn man nicht etwa
auf die Spitze getriebene Prinzipien zu
dem wertvollen Inventar unentwegter
Kulturpolitik rechnet; und ein andrer
Weg scheint nicht gangbar, um eine fast
unbestrittene Seuche zu bekämpfen.
Oder gibt es doch einen? Da es
hauptsächlich auf Geld ankommt, wäre
* Gerst wollte freilich mehr: ein
Verbot aller privaten Konkurrenz dort,
wo organisierte Unternehmungen blü-
hen, also eine Art Monopol für Ge»
meinden und Städtebünde, mindestens
in dem Fall, daß die privaten Unter-
nehmer das „Bedürfnis" nach ihren
Darbietungen nicht „nachweisen" kön-
nen. Dieser „Bedürfnisnachweis"-
Paragraph ist nun aber zweifellos von
Kautschuk. Die Versammlung hat dem
Monopolverlangen nicht zugestimmt.
2l